52x-Objekte der vergangenen Monate
Hier finden Sie alle Objekte des Monats aus der Veranstaltungsreihe "52x Esslingen und der Erste Weltkrieg".
November 2018 - Kriegsende und Revolution: Lithographie "Sturm auf das Wilhelmspalais" von Otto Schwerdtner
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Kriegsende und Revolution: Lithographie „Sturm auf das Wilhelmspalais“ von Otto Schwerdtner,
Papier, 40 x 45 cm,
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 004553)

Otto Schwerdtners (1883-1957) Kreidelithographie zeigt das zentrale Revolutionsereignis in Württemberg: den Sturm auf das Stuttgarter Wilhelmspalais am Nachmittag des 9. November 1918. Der damals 35jährige Maler und Graphiker Schwerdtner hatte nach einer Xylographenausbildung seit 1903 in der Stuttgarter Kunstakademie studiert und den Krieg in voller Länge mitgemacht.
Streiks bestimmten Anfang November 1918 die Lage in Württemberg. Am 4. November trat der erste Arbeiter- und Soldatenrat des Landes im Stuttgarter Gewerkschaftshaus zusammen. Die konkurrierenden sozialdemokratischen Flügelparteien von Mehrheitssozialisten (MSPD) und Unabhängige Sozialisten (USPD), übernahmen das Heft des Handelns. Vergeblich versuchte das Stellvertretende Generalkommando des 13. Armeekorps in Stuttgart, die alten Machtstrukturen zu sichern.
Mit der Parole „Vorwärts zur sozialen Republik!“ rief am 9. November 1918 die sozialdemokratische Schwäbische Tagwacht zu Demonstrationen in allen industriellen Zentren des Landes auf. Auf dem Weg von Degerloch in die Stadt beobachtete der künftige Ministerpräsident Wilhelm Blos (1849–1927) das Geschehen auf den Stuttgarter Straßen: „Am Karlsplatz, auf der Planie, in der Esslingerstraße und am Wilhelmspalast herrschte ein ungeheures Getümmel. […] Man sah auf den ersten Blick, dass die Soldaten sich mit dem Volk verbrüdert hatten“. König Wilhelm II. (1848–1921) schilderte die Szenen vor und in seinem Palais am frühen Nachmittag: „Zehntausende standen vor dem Vorgarten. Eine Rotte drang dann ein, verlangte die Einziehung meiner Flagge und Hissung der rothen. Während mir dies eröffnet wurde, geschah es mit Gewalt. Dann zogen sie sich allmälig zurück. Es war trotz allem eine merkwürdige Disziplin in der Masse“. Unter dem Schutz des Soldatenrats fuhren König und Königin noch am gleichen Abend nach Bebenhausen, das Wilhelm, der formal erst am 30. November abdankte, bis zu seinem Tod kaum mehr verließ.
Das in Württemberg schon in der Monarchie geübte Miteinander wurde in der Revolution in eine breitestmögliche Kooperation politischer Kräfte überführt. Am 9. November bildete sich unter Wilhelm Blos eine aus MSPD, USPD, Zentrum, DP und Fortschrittlicher Volkspartei gebildete provisorische Regierung, die sowohl von den Arbeiter- und Soldatenräten als auch von den Militärs unterstützt wurde. Dadurch wurden Blutvergießen verhindert und spartakistische Absichten unterbunden, ein Rätesystem nach sowjetischem Vorbild einzurichten.
Auch vom Esslinger Rathausbalkon wehten in den Revolutionstagen rote Fahnen, wovon aber keine Bilder erhalten sind. Am Morgen des 9. November veranstalteten Esslinger Arbeiter eine Kundgebung mit 5.000 Teilnehmern auf dem Marktplatz. Wie andernorts forderte man sofortigen Friedensschluss, Entmilitarisierung und Übergang zur Friedenswirtschaft, die Einführung der Republik und die Abschaffung von Adelsprivilegien sowie das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen. Nach der Kundgebung wurde in der „Traube“, einem bekannten SPD-Lokal unterhalb der Frauenkirche, ein Arbeiterrat aus Vertretern von MSPD und USPD gewählt, dem sich am 10. November der Soldatenrat des Ersatz-Bataillons 246 anschloss.
Am 14. November, drei Tage nach Eintritt des Waffenstillstandes am 11. November um 12 Uhr, tagte der Esslinger Arbeiter- und Soldatenrat mit örtlichen Arbeitgebern. Die Sitzung leitete Oberbürgermeisters von Mülberger: Wichtigstes Thema war, wie die Frontheimkehrer in Arbeit gebracht werden könnten.
Die selbstgestellte Aufgabe des Arbeiter- und Soldatenrates, Ruhe und Ordnung zu wahren, brachte ihn in Esslingen bald in einen seltsamen Konflikt. Die Arbeiter von den Fildern, die in der Baumwollspinnerei und Weberei auf dem Brühl oder bei der Maschinenfabrik Esslingen in Mettingen arbeiteten, hatten immer um die königliche Domäne Weil herumgehen müssen. Nun rissen sie die Zäune nieder und gingen direkt durch das Gestüt. Mahnungen des Arbeiter- und Soldatenrates, dass das Privateigentum zu respektieren und Betreten verboten sei, halfen nichts. Selbst Militärposten wurden ignoriert. Daraufhin duldete man die Abkürzung. Der Arbeiter- und Soldatenrat riskierte keine offene Konfrontation und agierte zusehends wie eine nachgeordnete Dienststelle der provisorischen Regierung. Oberbürgermeister von Mülberger behielt das Heft des Handelns in der Hand.
Oktober 2018 - Angst! Munitonsverpackungen aus dem Hengstenberg-Areal 1918/19
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Angst! Munitionsverpackungen aus dem Hengstenberg-Areal 1918/19
Vier Kartons, Pappe, 30 × 9 × 13 cm mit Tragegurten aus Jute, 39 Schachteln Pappe 8,8 × 6,4 × 2,9 cm, vier Gurte Baumwolle 120 × 9 cm
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006472)

Am 28. Mai 2015 wurde die Esslinger Polizei über einen Munitionsfund im Keller der ehemaligen Hengstenberg-Villa auf dem Firmengelände an der Mettingerstraße informiert. Bei Sanierungsarbeiten war ein Hohlraum freigelegt worden, in dem 1,8 Tonnen Militärmunition aus der Zeit des Ersten Weltkrieges gelagert waren: ca. 60.000 Gewehrpatronen des Kalibers 7,92 x 57 mm, verpackt in Schachteln und Patronentragegurten, die noch in ihren „Packhülsen“, den Original-Tragekartons der Hersteller, der Polte Maschinenfabrik AG Magdeburg und der Munitions- und Pulverfabrik Dachau, steckten.
Vier Munitionskartons, 39 Patronenschachteln und vier Patronentragegurte – ohne ihren todbringenden Inhalt! – wurden dem Stadtarchiv übergeben. Die Kartons besitzen eine Trageschlaufe aus grober Jute. Sie tragen Aufkleber mit Kürzeln: „Patr. S (Rille)“ steht für die 1903 als Standardpatrone für Gewehre und Maschinengewehre des Reichsheeres eingeführte „Patrone S“. Der Zusatz „Rille“ verweist auf die seit 1915 gefertigte Version, bei der eine umlaufende Rille am Geschoss ermöglichte, Geschoss und Hülse stabiler zu verbinden. „Pmf“ ist das Herstellerkürzel der 1916 bis 1924 bestehenden Munitions- und Pulverfabrik Dachau. Die Datierungen „19.9.17“ und „29.8.1918“ zeigen das Produktionsdatum an. Drei Kartons tragen zusätzlich die Aufschrift: „Nur als Übungsmunition in der Heimat verwendbar“. Sie dürften „Schlachtfeldmunition“ enthalten haben, Patronen, die aus dem Frontbereich stammten. Bei ihnen befürchtete man eine geringere Zuverlässigkeit aufgrund zeitweise unsachgemäßer Lagerung. Die mittlerweile ans Stadtmuseum übergebenen Patronenschachteln sind ebenfalls gekennzeichnet, etwa mit den Produktionsdaten September 1917, August 1918 und Oktober 1919. Die Schachteln waren eine jüngere Verpackungsform. Ursprünglich wurde die Munition in Patronentragegurten ins Feld geliefert. Aus grauem Baumwollgewebe gefertigt bot jeder Gurt 14 Taschen, die je einen Ladestreifen von fünf Patronen aufnahmen. Leere Gurte sollten eingesammelt und zur neuen Befüllung in die Heimat geschickt werden. Wegen Baumwollknappheit wurden die Gurte im Kriegsverlauf mehr und mehr durch Schachteln ersetzt.
Wann, warum und wie die Munition an ihren Fundort gelangt ist, ließ sich nicht ermitteln – trotz Unterstützung durch die Familie Hengstenberg und ihr Firmen-archiv. Rüstete man sich am Kriegsende für einen Bürgerkrieg, zumindest für Zeiten des Chaos und der Anarchie? Mit Blick auf den konkreten Fall bleibt viel Raum für Spekulation. Aus einer weiter gefassten Perspektive ist der Munitionsfund ein guter Ausgangspunkt, um den Zusammenhang von Ängsten und Gewaltbereitschaft im Umbruch vom Kaiserreich zur Weimarer Republik zu verfolgen.
Aus Sicht der weit überwiegend national-konservativ eingestellten „besseren Kreise“ war die Fallhöhe des Reiches im Herbst und Winter 1918 fürchterlich. In Armee und Gesellschaft zeigten sich Auflösungserscheinungen. Bei Kriegsende bewegten sich bis zu einer Million Deserteure durchs Land. 1,9 Millionen Gewehre, 8.500 Maschinengewehre und 400 leichte Mörser kamen dem Militär bis Jahresende 1918 „abhanden“. Im Alltag hatten Erschöpfung, Hunger und Schwarzmarkt schon längst zu einer Erosion dessen geführt, was als „Sitte und Anstand“ galt. Die Eßlinger Zeitung berichtete im gesamten Jahr 1918 auffallend häufig über Gewalttätigkeiten, Krawalle und eine Zunahme der Kriminalität. Alptraum der Konservativen war eine bolschewistische Revolution. Sie fürchteten um Besitz und Leben und machten die Linke für Deutschlands Niederlage verantwortlich. Und noch eine weitere Bedrohung lastete auf den Gemütern: die Spanische Grippe. Traueranzeigen für ihre Opfer füllten im Herbst und Winter 1918 an manchen Tagen ganze Seiten der Eßlinger Zeitung.
Zwar verlief die Novemberrevolution tatsächlich fast ohne Gewalttaten und „biederer“ als erwartet. Mit der Weimarer Republik stabilisierte sich zugleich die bürgerliche Gesellschaft. Aber dennoch hielten die aristokratischen und großbürgerlichen Kreise an ihrem national-chauvinistischen Stolz und ihrem Herrschaftsanspruch fest.
September 2018 - Kriegsschriftsteller, Gaukulturwart, Ehrenbürger: "Haubitzen vor!" von Georg Schmückle
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Kriegsschriftsteller, Gaukulturwart, Ehrenbürger
"Haubitzen vor!" von Georg Schmückle
Georg Schmückle: Haubitzen vor! Vormarscherinnerungen eines nachführenden Offiziers, Stuttgart 1923
(Stadtarchiv Esslingen, Bibliothek 11882)

„Haubitzen vor!“ von 1923 enthält die Kriegserinnerungen des am 19. August 1880 in Esslingen geborenen Georg Schmückle. Der schmale Band war nach dem Gedichtband „Lichter überm Weg“ (1921) seine zweite unabhängige Publikation. Zahlreiche sollten folgen.
Der Text schildert subjektiv die Erlebnisse Schmückles als Leutnant einer Batterie im 3. Württembergischen Feldartillerie-Regiment Nr. 49, das bald nach Kriegsbeginn in den Argonnen in schwere Kämpfe verwickelt wurde. Besonderen Raum nehmen die eigenen Heldentaten, vor allem die Säuberung des Ortes Mussy-la-Ville von belgischen Franctireurs (Partisanen), ein. Das fand seinen Höhepunkt darin, was der Autor verherrlichend als „Blutnacht von Sommaisne“ bezeichnete. Mit dem baldigen Rückzug endet der Text: „Die Tage des Vormarschs waren zu Ende! Weit voraus hatten die Schwaben die Reichssturmfahne getragen und kein Truppenteil des deutschen Heeres hatte geblutet wie die Schwaben beim Sturm ins französische Land!“
Der kleine Band ist ein Beispiel für die Erinnerungsliteratur von Offizieren. Sein Verfasser gehört zu den Teilnehmern des Ersten Weltkriegs, die später als Exponenten und Profiteure des nationalsozialistischen Regimes hervortreten sollten. Dabei war Schmückle im Jahr 1914 kein junger, entwurzelter, sich radikalisierender Weltkriegsteilnehmer, sondern ein wohlhabender 34jähriger Akademiker mit abgeschlossenem juristischem Hochschulstudium und einer sicheren Lebensperspektive im Staatsdienst.
Schmückle wuchs in San Remo, wo der Vater vornehme Hotels betrieb, in Silvaplana und Backnang auf. Als Witwe zog die begüterte Mutter mit ihren beiden Söhnen ins elterliche Esslingen, wo die Familie 1897 die repräsentative „Villa Schmückle / Eberspächer“ (Berliner Straße 17) bezog. 1900 bestand Schmückle am Gymnasium sein Abitur, legte 1909, nach Studium, Referendariat und Promotion, die zweite Staatsprüfung ab und ging in den württembergischen Justizdienst.
Die militärische Karriere des Leutnants der Reserve Schmückle war von psychischen Störungen überschattet. Ab Ende 1917 frontuntauglich, wurde Schmückle ins Kriegsarchiv versetzt, wo er drei Bände der Reihe „Schwäbische Kunde aus dem großen Krieg“ bearbeitete. 1920 verließ er, der 1915 eine Cannstatter Fabrikantentochter geheiratet hatte und damit finanziell unabhängig war, freiwillig den Justizdienst. Kurzzeitig gab er die revanchistische Monatsschrift „Der Schwäbische Bund“, später: „Oberdeutschland“ heraus.
1924 provozierte Schmückle einen reichsweiten Skandal, als er wegen des Singens der „Marseillaise“ in einer Aufführung von Büchners „Dantons Tod“ den Intendanten des Stuttgarter Landestheater schriftlich verunglimpfte. Im nachfolgenden Beleidigungsprozess vor dem Reichsgericht wurde er freigesprochen: Seine Popularität in nationalistischen Kreisen nahm zu. Mit seinem größten literarischen Erfolg, „Engel Hiltensperger“ von 1930, erwies sich Schmückle als ein Schriftsteller, der im Gewand des Historienromans - die Handlung spielt im Schwaben der Lutherzeit - das gesamte Arsenal nationalsozialistischer Ideologie transportierte: Endzeitstimmung, völkische Ideologie, Sozialdarwinismus, Führerkult und -erwartung.
Ab 1931 NSDAP-Mitglied, machte Schmückle als Günstling des aus Esslingen stammenden Nationalsozialisten und späteren Gauleiters, Staatspräsidenten und Reichsstatthalter in Württemberg, Wilhelm Murr (1888-1845), Karriere. Der schlichte ehemalige kleine Angestellte der Maschinenfabrik Esslingen sorgte für Schmückles Rückkehr in den Staatsdienst, ab 1937 als sein persönlicher juristischer Berater in Kulturfragen.
Parallel sammelte Schmückle Posten in der Kulturverwaltung: Gaukulturwart, Landesleiter des „Kampfbundes für deutsche Kultur“, Landesleiter der Reichsschrifttumskammer Württemberg-Hohenzollern und Vertreter Württembergs im Landesverband Deutscher Schriftsteller. Außerdem war er ab Januar 1939 Vorsitzender des Schwäbischen Schillervereins (heute: Deutsche Schillergesellschaft) und damit Direktor des Schiller-Nationalmuseums in Marbach. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, seine Stücke feierten auf der Bühne des Landestheaters Stuttgart ihre Premiere, Schmückle wurde vielfach geehrt. So verlieh ihm seine Heimatstadt Esslingen am 14. Oktober 1936 die Ehrenbürgerwürde.
Mit dem Ende der NS-Zeit endeten auch für den extrem profit- und geradezu krankhaft ehrversessenen Schmückle, einen persönlich skrupellosen Propagandisten und Profiteur des NS-Unrechtsregimes, die literarischen Erfolge, die einflussreichen Posten und die Auszeichnungen. Er wurde zwischen September 1945 und April 1947 im bayerischen Lager Moosburg inhaftiert, seine beiden Ehrenbürgerwürden (Strümpfelbach und Esslingen) wurden ihm aberkannt. Unweit seines Hofgutes Schmalzgrub bei Stötten am Auerberg ist Georg Schmückle am 8. September 1948 mit 68 Jahren verstorben. Sein literarisches Werk ist heute zu Recht vergessen.
August 2018 - Lederwaren für den Krieg: Tornisterriemen aus Esslingen
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Lederwaren für den Krieg: Tornisterriemen aus Esslingen
Tornister M 1915
Segeltuch, Leder, Metall, Holz
Maße: 41x31x12cm
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 005724)

Tornister waren seit dem 17. Jahrhundert als Rückengepäck für Soldaten gebräuchlich. Nach der Reichsgründung wurde 1895 der typische Tornister aus Rinder- bzw. Kalbfell und Leder eingeführt. Dieser erlebte 1907 und 1913 einige Änderungen, mit denen sich das Tragegewicht von 11,5 auf 9,7 Kilogramm verringerte. Nach Kriegsbeginn ersetzten grauer bzw. „schilfgrüner“ Stoff (und andere Ersatzstoffe) bisher aus Leder gefertigte Teile. Die Umstellung der Herstellung auf Segeltuch wie beim gezeigten Objekt erfolgte seit 1915, da es an Kalbfellen mangelte.
Der Tornister enthielt alles, was der Soldat benötigte. Neben einigen Munitionspäckchen waren dies Wäsche, Ersatzschuhe, das Waschzeug und das Sold- und Gesangbuch, aber auch die „Eiserne Ration“. Diese bestand aus Zwieback, Kaffee, Konserven mit Gemüse, Fleisch und Fett und etwas Salz. Zusätzlich wurden Mantel und Zeltbahn aufgeschnallt und außen an der Klappe das Kochgeschirr befestigt. Getragen wurde das Gepäckstück mit Hilfe der angebrachten Trageriemen. An ihnen war ein weiterer Riemen zum Einhängen in das Koppel angenietet. Dies führte zu einer besseren Verteilung der Last.
Den Kasten des ausgestellten Tornisters aus „schilfgrünem“ Segeltuch stabilisiert ein mit Stoff überzogener hölzerner Rahmen. Leder findet sich nur an den Außenkanten und am Tragesystem, den Trageriemen, Ösen zur Befestigung weiterer Ausrüstungsgegenstände sowie an der rückseitigen Unterkante. Im Innern befinden sich Stempel, die auf seine Verwendung beim Infanterieregiment 126 (8. Württembergisches) und das verantwortliche Armeekommando hinweisen. Ein anderer, kaum leserlicher Stempel dürfte mit der zuständigen Beschaffungsstelle in Verbindung zu bringen sein. Auf die mögliche Verwendung bei der Württembergischen Polizei nach 1918 deutet ein weiterer Stempel hin. Handschriftlich hat ein früherer Besitzer seine Initialen „A.Z.“ angebracht.
Die Lederteile wurden von drei Sattlereien hergestellt. Den rechten Tragriemen fertigte die Gerberei- und Treibriemenfabrik Gebrüder Steus in Esslingen, die ihren Sitz in der Krummenackerstraße 15 hatte. Die Brüder Wilhelm und Carl Steus gründeten sie 1872, nachdem Wilhelm Steus die dortige „Hemmingersche Hammerschmiede“ erworben hatte. Hergestellt wurden Treibriemen aus Ochsenleder für Transmissionen. Zur Firma gehörte eine eigene Gerberei, seit 1883 auch eine Sattlerei. 1886 wurde Wilhelm Steus Alleininhaber. Nach seinem Tod 1896 führten seine Witwe und die beiden Söhne Richard (1881-1958) und Theodor (1876-1935), die seit 1906 Inhaber waren, das Geschäft. Bis 1914 entwickelte sich die Firma gut. Es gab in regelmäßigen Abständen Investitionen, und zusätzliche Fabrikgebäude wurden gebaut.
Der Kriegsbeginn brachte dann nach Aussage von Richard Steus im Jahr 1922 „eine vollständige Stockung“ der Geschäfte. Dies ist eine in vielen Wirtschaftszweigen anzutreffende und als „Kriegsstoß“ bezeichnete Auswirkung der Umstellung von Friedens- auf Rüstungsproduktion. Durch den raschen Rückgang der Nachfrage nach Waren der Friedensproduktion und die erst allmählich einsetzende steigende Nachfrage nach Rüstungsgütern kam es häufig zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Wenig später kamen die Geschäfte allmählich wieder in Gang – auch wegen des gestiegenen Lederbedarfs des Militärs - und Gebrüder Steus stellte die Produktion weitgehend auf militärische Bedürfnisse um. Da die Firma jedoch bei den Beschaffungsämtern bisher nicht als Lieferant eingeführt war, war dies mit einigen Anstrengungen verbunden. Als die Fabrik später stillgelegt werden sollte, konnte dies zumindest in Teilen verhindert werden. Allerdings ging der Betrieb nur eingeschränkt weiter: Während die Gerberei viel Arbeit hatte, musste die Treibriemenfabrikation 1916 eingestellt werden, da angeordnet worden war, dass nur noch zwei Firmen in Württemberg Transmissionsriemen herstellen durften. Immerhin wurde der Firma gestattet, beschädigte Riemen weiterhin auszubessern. Besonders ärgerlich wird es gewesen sein, dass das in der Gerberei hergestellte Leder der Konkurrenz zur Verfügung gestellt werden musste. Dies galt auch für eingehende andere Aufträge. Im September 1918 begann dann aber wieder die Herstellung von Transmissionsriemen. Auch die Sattlerei fertigte Heeresaufträge, wie der Tragriemen des ausgestellten Tornisters zeigt. Über deren Umfang ist jedoch keine Aussage möglich. Das Schicksal der Firma während des Ersten Weltkrieges zeigt, wie stark sich auch in Esslingen die Auswirkungen der Kriegswirtschaft bemerkbar machten. Sie existierte bis 1979, verlegte 1972 ihren Sitz nach Stuttgart und wurde seit 1960 als "Großhandlung mit Transportbändern" geführt.
Juli 2018 - Brieftaubenmeldung: Kommunikation in höchster Not
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Brieftaubenmeldung: Kommunikation in höchster Not
Meldezettel und Originaltragehülse, 1918
(Stadtarchiv Esslingen, Nachlass Kielmeyer)
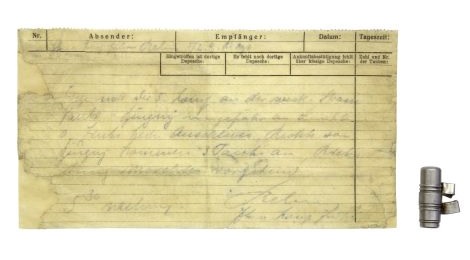
Zum Nachlass des Esslinger Kanoniers Richard Kielmeyer (1891–1946) gehört ein ganz besonderes Front-Souvenir: eine nur 3 cm lange Kapsel aus Aluminium zum Transport von Nachrichten auf dem Rücken einer Brieftaube. Die Kapsel enthält einen zusammengefalteten und -gerollten Zettel von 18,5 x 10 cm, der an ein Telegramm erinnert. Es ist eine Meldung aus vorderster Linie, von einem deutschen Offizier in dramatischer Lage abgesetzt. Der Text lautet: „Liege mit 5. Kompanie an der westlichen Strasse Vaulx-Beugny ungefähr an Punkt 0. Links kein Anschluss, rechts von Beugny kommen 3 Tanks an, Richtung Morchies vorgehend. 5:30 nachmittags. Rehm Leutnant und Kompanie Führer“.
Die Meldung ist undatiert und Leutnant Rehm nicht identifiziert, anders die Ortsangaben: Vaulx, Beugny und Morchies liegen ca. 5 km östlich von Bapaume. Der Ort wurde von den Deutschen am 24. März 1918 in ihrer Frühjahrsoffensive erobert. Denkbar ist, dass Rehms Leute beim Vorrücken auf Tanks – also Panzer – stießen, die den britischen Rückzug deckten. Möglich ist aber auch ein anderes Szenario: Nach der Räumung Bapaumes durch die Deutschen am 29. August 1918 waren Beugny und Morchies Ziel britischer Panzer-Vorstöße.
Die ersten Panzer wurden 1915 in England gebaut. Zur Geheimhaltung nannte man sie nach ihrem klobigen Aussehen „Tanks“. Zum Einsatz brachten die Briten Panzer erstmals am 15. September 1916 an der Somme, die Franzosen am 16. April 1917 auf der Hochebene von Craonne. In geringer Zahl anrollend wurden anfangs jedoch fast alle Kampfwagen von der deutschen Artillerie zerschossen. Daher unterschätzte die deutsche Oberste Heeresleitung die neue Waffe. Man verzichtete auf eine nennenswerte Produktion eigener Tanks. Auch erhielt die Infanterie keine wirksamen Abwehrwaffen. Im Ernstfall blieb ihr nur die Alarmierung der Artillerie.
Im Ersten Weltkrieg war die Feldtelefonie das wichtigste Kommunikationsmittel. Fernsprechleitungen wurden aber bei heftigem Geschützfeuer regelmäßig zerstört. So kamen gerade in kritischen Situationen Blinkapparate, Leuchtpistolen, Signalhörner, Meldegänger, Meldehunde und eben auch Brieftauben zum Einsatz.
Tauben haben die Fähigkeit, von einem beliebigen Abflugort zu ihrem Heimatschlag zurückzufinden. Das machte sich das Militär zu Nutze. Etwa 15 km hinter den vorderen Linien entstanden Taubenschläge: 1.000 gab es 1918 auf deutscher Seite. Von dort wurden die Tiere in Tragkörben in die Kampfstellungen geschafft. Auch Panzer, Flugzeuge und Ballons konnten Tauben mitführen. Für die Tiere gab es eigene Gasschutzkästen. An ihren Abflugstellen setzte man sie auf Diät: hungrige Tauben haben es mit dem Rückflug eiliger als satte.
Wir wissen nicht, ob Leutnant Rehm und seine Leute den Abflug ihrer Brieftaube lange überlebt haben und ob die Botschaft die Adressaten erreicht hat. Die Alliierten hatten im Lauf des Jahres 1917 eine neue, auf Masse setzende Einsatzweise ihrer Panzer entwickelt. Erstmals praktizierten sie die Briten am 20. November 1917 bei Cambrai. Dort griffen 400 Tanks die deutsche Front völlig überraschend an – unterstützt von speziell trainierter Infanterie, Artillerie und Schlachtflugzeugen. Am Abend des Tages hatten sie das Grabensystem durchstoßen und waren 9 km vorangekommen. Im Stellungskrieg war das nie zuvor gelungen. Nach Eindämmung der deutschen Frühjahrsoffensive gelangen den Alliierten 1918 erneut spektakuläre Großangriffe. Am 18. Juli 1918 brachen die Franzosen mit 337 Tanks aus dem Wald von Villers-Cotterets hervor. Am 8. August 1918, dem „schwarzen Tag“ des deutschen Heeres, attackierten die Engländer bei Amiens. Weitere Schläge folgten.
Motorisierung war das Rezept des Sieges. Doch griffen alle Armeen bis zuletzt exzessiv auf den Einsatz von Tieren zurück. Wohl 130.000 Brieftauben flogen für die deutsche Armee. 15.000 Hunde zählte das Heer der französischen Republik. 10–16 Millionen Pferde wurden im Krieg von allen Parteien eingesetzt – überwiegend als Zugtiere. Etwa acht Millionen sollen durch Strapazen, Krankheiten, Beschuss und Futtermangel zugrunde gegangen sein. Zwar inszenierte man einzelne Tiere als Helden: So wurde die Taube, die 1916 die letzte Meldung aus dem Fort Vaux bei Verdun gebracht hatte, in Paris posthum mit dem Kreuz der Ehrenlegion dekoriert. Doch verbrämten solche Auszeichnungen letztlich eine Praxis, die Tiere vor allem verbraucht und verschlissen hat.
Juni 2018 - Fliegerheld? Die Kriegsbriefe des Esslingers Oskar Bechtle
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Fliegerheld? Die Kriegsbriefe des Esslingers Oskar Bechtle
1916
(Stadtarchiv Esslingen, Nachlass Oskar Bechtle)

Im Ersten Weltkrieg wurden Flieger zu Idolen. Sie standen für die Herrschaft über aufregend moderne Technik. Und sie füllten eine empfindliche Leerstelle im Seelenhaushalt der im großen Blutvergießen versinkenden Nationen. Weil das heroische Kriegerbild des 19. Jahrhunderts im Morast der Schützengräben jedweden Realitätsbezug verloren hatte, projizierte man die Sehnsucht nach Helden auf die „tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“. Besonders die Jagdflieger stilisierte man zu „Rittern der Lüfte“. Mit der Wirklichkeit hatte das wenig zu tun. Auch der Krieg am Himmel war vor allem eines: gnadenlos. Zum „Ass“ machte einen Piloten nicht Ritterlichkeit, sondern das scharfe Auge des aus der Sonne heraus präzise die tödliche MG-Garbe setzenden Jägers.
Oskar Bechtle (1895-1990) war ein in Esslingen prominenter Angehöriger der Fliegertruppe. Sein Vater gab die „Eßlinger Zeitung“ heraus. Oskar Bechtle diente seit 1913 beim Militär. Kurz vor Kriegsbeginn zum Leutnant ernannt, führte er eine Kompanie des 5. Württembergischen Grenadier-Regiments Nr. 123 aus Ulm. Mit seiner Kompanie kämpfte er 1915 in den Argonnen, 1916 vor Ypern und anschließend in der Somme-Schlacht. Zum 10. Oktober 1916 gelang ihm die Aufnahme in die Fliegertruppe. Mit der zur Luftaufklärung eingesetzten Fliegerabteilung 33 diente er 1917 in der dritten Ypern-Schlacht, dann bei Cambrai. Allerdings flog er nicht als Pilot, sondern als Beobachter, der beim Einsatz hinter dem Piloten saß, Bomben löste, die Luftbildkamera und das rückwärtige Maschinengewehr bediente. Nach mehr als 100 Feindflügen wurde er im März 1918 zum Kommandeur der Schlachtstaffel 2 ernannt. Sie war (wie alle Schlachtstaffeln) neu aufgestellt worden, um die deutsche Frühjahrsoffensive mit Tiefflugangriffe auf feindliche Bodentruppen unterstützen zu können. Im April 1918 verwundet, erhielt er gegen Kriegsende erst das Kommando über die Fliegerschützenschule Großenhain in Sachsen, dann des Flughafens Dornstadt bei Ulm.
Der Fotoabzug von 19 x 25 cm Größe zeigt Oskar Bechtle sitzend vor seinem 13 Jahre älteren Bruder Richard, der seit 1912 Teilhaber des väterlichen Zeitungsverlages war und im Ersten Weltkrieg als Hauptmann im selben Regiment wie sein jüngerer Bruder diente. Die Aufnahme entstand 1916 an einem unbekannten Ort. Der vorliegende Abzug weist kaum Alterungsspuren auf und dürfte Jahrzehnte nach dem Krieg angefertigt worden sein.
Oskar Bechtle war weit entfernt vom Bekanntheitsgrad solcher „Fliegerasse“ wie Max Immelmann oder Manfred von Richthofen. Doch erhielt auch er hohe Auszeichnungen. Zu Beginn der dritten Ypern-Schlacht gelangen ihm trotz Bedrohung durch feindliche Jäger erste Luftaufnahmen der verheerenden britischen Minensprengungen bei St. Elooi. Da die Kommunikation am Boden zusammengebrochen war, vermittelten die Aufnahmen ein erstes Bild der Lage und erleichterten die Planung von Abwehrmaßnahmen. Bechtle wurde dafür im Dezember 1917 mit dem „Ritterkreuz des Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern“ ausgezeichnet, der Vorstufe des „Pour le Mérite“. Weitere Orden folgten. Er dürfte einer der am höchsten dekorierten Esslinger Kriegsteilnehmer gewesen sein und veröffentlichte nach dem Krieg zwei an prominenter Stelle platzierte Erinnerungsaufsätze: „Mit der Schlachtstaffel von St. Quentin nach Amiens“ in Georg Paul Neumanns die Niederlage leugnender Sammlung „In der Luft unbesiegt“ und 1938 „Württembergische Flieger-Erinnerungen aus Flandern“ in der dritten Auflage von Otto Mosers monumentalem Gedenkband „Die Württemberger im Weltkrieg“.
Von Oskar Bechtle sind zudem zahlreiche Kriegsbriefe erhalten. Sie dokumentieren eindrucksvoll „seinen“ Krieg – erst im Schützengraben, dann am Himmel. Oskar Bechtles Beschreibungen sind teils ungeschminkt, teils auch ironisch. Zeit- und standestypisch ist sein schneidig-salopper Zungenschlag. „Na in den Argonnen wird‘s auch wieder schön sein“, heißt es nach einem Heimaturlaub 1915. Den Wechsel zur Fliegertruppe nennt er flapsig eine „Luftveränderung“ und freut sich über den Abschuss feindlicher Flieger: „Engländer kann man des öfteren runter [fallen] sehen, das macht viel Freude“. Allerdings verbergen solche Formulierungen vielleicht mehr, als dass sie offenlegen. – Kriegsbriefe gerade jüngerer Offiziere sind oft genug eine Maske.
Mai 1918 - Anklage Selbstverstümmelung: Die Kriegsgerichtsakte August Muff
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Anklage Selbstverstümmelung: Die Kriegsgerichtsakte August Muff
1918
(Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, M 81 Bü 9/67)

Es war die Nacht vom 21. auf den 22. April 1918: Bei Villers-Bretonneux, 16 km östlich von Amiens, 400 Meter vom Feind als MG-Posten auf Feldwache liegend, schoss sich der Berkheimer August Muff mit der Pistole in den linken Unterarm. Am 4. September 1918 wurde er dafür vom Kriegsgericht der Stellvertretenden 54. Infanterie-Brigade in Ulm wegen Selbstverstümmelung verurteilt.
August Muff wurde am 11. August 1898 in Berkheim als Sohn eines Fabrikarbeiters geboren. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und erlernte den Beruf eines Eisendrehers. Am 4. Januar 1917 wurde er eingezogen und am 10. November 1917 an die Front in Frankreich zur 1. Maschinengewehrkompanie des Infanterie-Regiments Nr. 479 versetzt. Mit diesem Regiment wurde Muff im März 1918 von der Verdun-Front ins Somme-Gebiet verlegt und nahm an der verlustreichen Michael-Offensive teil. In den Arm schoss er sich kurz vor einem für den 24. April angesetzten deutschen Großangriff auf Villers-Bretonneux. Die Artillerie beider Seiten feuerte hier in der Nacht zum 22. April aus allen Rohren.
Muffs Verwundung erregte Argwohn: Den Ärmel seines Waffenrocks wollte er sich nicht aufschneiden lassen. Seine Uniform roch nach Pulver. Seine Pistole war blutverschmiert. In ihrer Kammer fand sich keine Patrone mehr. Muff verwickelte sich in Widersprüche. Während er gesund gepflegt wurde und ab Mitte Mai seinen Dienst im Ersatztruppenteil in Isny verrichtete, bereitete die Militärverwaltung den Prozess gegen ihn vor.
Im Unterschied zur Bundesrepublik kannte das Deutsche Reich eine spezielle Militärgerichtsbarkeit. Laut dem Militärstrafgesetzbuch von 1872 (§ 81, Absatz 1) wurde Selbstverstümmelung „mit Gefängniß von Einem Jahre bis zu fünf Jahren bestraft“. Im Verfahren gegen Muff hatte das aus Truppenoffizieren und Kriegsgerichtsräten, also Volljuristen, bestehende Ulmer Kriegsgericht „kein Bedenken, die Darstellung des Angeklagten als unglaubhaft zu verwerfen“. Dennoch fiel das Urteil mit einem Jahr Haft milde aus. Wo immer möglich, legten die Militärrichter das geltende Recht zugunsten Muffs aus. Für ihn sprach auch seine Jugend. Der Befehlshaber der Stellvertretenden 54. Infanterie-Brigade, Generalmajor Wilhelm Freiherr von Brand, bestätigte als Gerichtsherr den Urteilsspruch, setzte ihn jedoch anschließend „aus dienstlichen Gründen“ außer Vollzug. Muff wurde zur Truppe an die Front zurückgeschickt.
Vergehen der „Dienstentziehung“ wie Fahnenflucht, unerlaubte Entfernung und Selbstverstümmelung kamen im deutschen Heer während des Ersten Weltkrieges zunächst nicht häufiger vor als in der Vorkriegszeit. Für das württembergische Heer sind bis zum Waffenstillstand knapp 2.400 abgeschlossene Verfahren wegen Desertion und unerlaubter Entfernung nachzuweisen (bei etwa 500.000 mobilisierten Soldaten). Reichsweit rechnet man mit etwa 50.000 abgeschlossen Verfahren (bei einer Gesamtzahl von 13,5 Millionen mobilisierten Soldaten). Erst ab dem Frühjahr 1918, vor allem in den letzten Kriegswochen, wurde die „Drückebergerei“ zu einem militärisch relevanten Faktor.
Der Umgang mit Delikten der Dienstentziehung unterschied sich in den am Weltkrieg beteiligten Armeen deutlich. In Deutschland waren die Strafandrohungen zwar hoch, die Urteile jedoch eher milde. Die Zahl der vollstreckten Todesstrafen war im deutschen Heer wesentlich geringer als bei den anderen Kriegsparteien. Die relative Milde der deutschen Militärjustiz folgte einer militärischen Logik: Haftstrafen konnten Täter, die dem Frontdienst entkommen wollten, kaum abschrecken. Wie im Fall Muffs diente die Aussetzung der Strafe vor allem dazu, dem Heer die Kampf- bzw. Arbeitskraft des delinquenten Soldaten zu erhalten.
August Muffs Selbstverwundung kann nur bedingt mit den Auflösungserscheinungen im deutschen Heer, dem von manchen Historikern für das Jahr 1918 konstatierten „verdeckten Militärstreik“, in Beziehung gesetzt werden. Muff handelte aus Angst und situativ. Früher eingezogen hätte er sich – etwa als Soldat in der Verdun- oder Somme-Schlacht – wohl nicht anders verhalten. Muff profitierte von einer Amnestie für Delikte der Dienstentziehung, die im November 1918 in Kraft trat. 1922 heiratete er eine Frau aus dem Arbeitermilieu. Das Paar bekam zwei Kinder. August Muff starb am 24. September 1929 im Alter von erst 31 Jahren in Berkheim.
April 2018 - Die Fähre "Cimbria": Ein Erinnerungsbild von Paul Hildenbrand
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Die Fähre „Cimbria“: Ein Erinnerungsbild von Paul Hildenbrand
Ende der 1920er Jahre
Öl auf Leinwand, 49,3 x 69,3 cm
(Stadtmuseum Esslingen, STME 002978)

1889 wurde an der Stelle, an der heute die Adenauerbrücke den Neckar überquert, eine Personenfähre eingerichtet. Nun war der Weg von Berkheim durch das Friedenstäle an Hammerschmiede und Schießhaus vorbei hinüber auf die linke Neckarseite nach Oberesslingen sehr viel einfacher und schneller zu bewältigen. Betrieben wurde die Fähre vom Schmiedemeister Christian Zink und ab 1908 vom Mechaniker Robert Baumgärtner.
Getauft wurde der von der Esslinger Maschinen- und Metallwarenfabrik Hermann Ulrich gebauten Kahn bedeutungsvoll „Cimbria“. Der Name erinnerte an den HAPAG-Dampfer „Cimbria“, der im Januar 1883 in der Nordsee vor Borkum gesunken war. Damals starben 437 Personen – es war eine der weltweit schlimmsten Schiffskatastrophen des 19. Jahrhunderts.
Die 9,85 Meter lange Fähre war an einem quer über den Neckar gespannten Drahtseil mit zwei Ketten beweglich befestigt. Bei genügend Wasserstand wurde sie schräg zur Fließrichtung gelenkt und durch die Geschwindigkeit des Wassers über den Fluss geschoben. Ansonsten zog sie ein moderner Elektromotor an einer Zugkette über den Fluss. Der Motor stand in einem „Turbinenhäuschen“ auf der Berkheimer Seite.
Am 28. April 1918 hatte der VfR Esslingen auf den Sirnauer Wiesen um die Fußball-Bezirksmeisterschaft gegen die Spielvereinigung Heilbronn gespielt. Nach dem Abpfiff zog von Westen ein Gewitter auf. Die Zuschauer wollten deshalb schnell nach Hause. Gegen 17 Uhr drängten so viele auf die Cimbria, dass die Fähre völlig überladen war. Statt der erlaubten 32 waren 50 bis 60 Personen auf dem Kahn. Erfolglos versuchte Fährbetreiber Baumgärtner die Menschen zurückzuhalten.
Mit einem Ruck setzte sich die Cimbria in Bewegung. Die Eßlinger Zeitung berichtet davon folgendermaßen: „Die Mitte des an dieser Stelle ziemlich tiefen Flusses war jedoch noch nicht erreicht, als das Boot sich infolge der Überlastung auf die Seite neigte und etwas Wasser über Bord kam. Erschreckt drängten die Insassen nach der anderen Seite, was zur Folge hatte, dass diese unter Wasser gedrückt wurde und das ganze Boot schnell sank.“ Dies geschah allerdings nur 2 Meter vom Ufer entfernt und bei einer Wassertiefe von 2 bis 2 ½ Metern. Einige Insassen retteten sich schwimmend, andere wurden von Baumgärtner, Zuschauern und Mitgliedern der Fußballmannschaften gerettet, die schwimmen konnten.
Im Laufe des Abends wurden 14 Leichen geborgen, am nächsten Morgen nochmal 7. 21 Tote im Alter von 8 bis 60 Jahren waren zu beklagen, davon 16 unter 21 und 5 über 40 Jahren. Im Altersbereich von 21 bis 39 gab es kein einziges Opfer – diese Altersklasse war damals an der Front. Dass so viele Passagiere umgekommen sind, lag wohl auch daran, dass sie sich viele aneinander klammerten und „auf einem Haufen waren“, wie es in einem Bericht des Oberamtes Esslingen heißt.
Zum seit Menschengedenken schwersten Unglück in Esslingen gab es verschiedene Kommentare. Fährbetreiber Baumgärtner wurde vorgeworfen, dass er mit so vielen Menschen hatte übersetzen wollen. Andererseits wurden die Passagiere wegen ihrer Unvernunft kritisiert. Baumgärtner hatte ja vergeblich versucht, die Menge zurückzuhalten. Zum dritten fragte man, ob mangelnde Schwimmkenntnisse für die vielen Opfer verantwortlich seien.
Baumgärtner hatte keine zusätzlichen Aufsichtspersonen am Ufer gehabt, was bei erhöhtem Andrang Vorschrift war. Er wurde deswegen verhaftet, hat aber die Fähre nach technischen Veränderungen ab Mitte Mai 1918 noch weitere vier Jahre bis Oktober 1922 betrieben. Bereits 1920 hatte ein hölzerner Fußgängersteg etwas oberhalb ihre Aufgabe übernommen und den Fährbetrieb unrentabel gemacht.
Die 1918 technisch veränderte Fähre hat der aus Berkheim stammende Kunstmaler Paul Hildenbrand (1904-71) wohl nach einer fotografischen Vorlage Jahre später gemalt. Sie wird mit stark auskragenden Halterungen an einem Halteseil entlanggeführt und ist im Blick neckaraufwärts mit den Schurwaldhöhen im Hintergrund zu sehen. Links steht die Umlenkrolle für das Zugseil. Die Fähre fährt jetzt als Doppelendfähre nur noch mit dem externen Motor vor- und rückwärts hin und her. Das sommerlich helle, friedvolle Neckartal steht in krassem Gegensatz zur Unglücksgeschichte der „Cimbria“.
März 2018 - Entgrenzter Krieg: Trefferkarte von Esslingen zum Luftangriff am 10
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Entgrenzter Krieg: Trefferkarte von Esslingen zum Luftangriff am 10.3.1918
Tusche und Buntstift auf Pauspapier
33,3x32,5 cm
(Landesarchiv Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, M 77/1 Bü 622-02.)
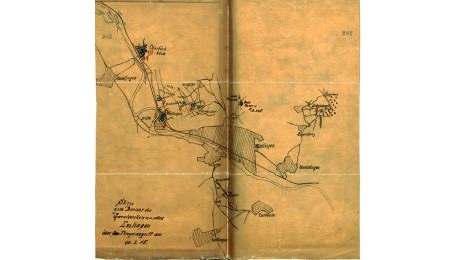
Am 10. März 1918 wurde in Esslingen und Stuttgart gegen 11.20 Uhr Luftalarm gegeben. Im Anflug waren 10 britische Bomber des Typs Airco DH 4. Sie waren drei Stunden zuvor in Tantonville bei Nancy gestartet. Die Maschinen warfen jeweils bis zu 200 kg Bomben über dem mittleren Neckarraum ab.
Am Tag nach dem Angriff meldeten die württembergischen Zeitungen, dass „einige Wohngebäude beschädigt“ und „5 Zivilpersonen“ verletzt worden seien, darunter je zwei Frauen und Kinder. „Militärischer Sachschaden“ sei nicht entstanden. Eigene Jagdflieger hätten ein Feind-Flugzeug zur Notlandung im Nordschwarzwald gezwungen. Die Besatzung sei gefangen genommen worden.
Die Zeitungsangaben beruhten auf einem offiziellen Bericht für die „Flak-Gruppe Stuttgart“. Wie nach Luftangriffen üblich, erstellten die Militärbehörden auch ein „Trefferbild“, um aus der Verteilung der Bombeneinschläge Rückschlüsse auf das Angriffsziel und die Taktik des Gegners ziehen zu können. Angefertigt wurden zwei Karten, die im Hauptstaatsarchiv Stuttgart erhalten sind. Eine Karte im Maßstab 1:25.000 zeigt die Einschläge im gesamten Raum Esslingen-Stuttgart. Eine kleinere, im Garnisonskommando Esslingen auf durchscheinendem Pauspapier gezeichnete Karte gleichen Maßstabs, hält präzise die Einschläge um Esslingen fest, wo die meisten Bomben niedergingen.
In der Esslinger Karte sind die Einschläge nummeriert – vermutlich um ihre Abfolge zu zeigen. Von Rottweil kommend flogen die Briten ihr Zielgebiet über Liebersbronn und Berkheim an, wo die ersten Bomben fielen. Neckarabwärts erkannten die Piloten westlich von Esslingen einen Industriekomplex, die Maschinenfabrik Esslingen. Sie verfehlten die Fabrik, trafen aber den Ort Mettingen, wo Verletzte zu beklagen waren. Die späteren Einschläge in Obertürkheim weisen den Weg nach Untertürkheim und dem eigentlichen Angriffsziel, den Daimler Motorenwerken. Auch sie wurden verfehlt. Dafür schlugen Bomben in Untertürkheim, bei Wangen und Cannstatt ein.
Esslingen wurde im Ersten Weltkrieg nur an diesem 10. März 1918 direkt „vom Feind“ getroffen – und das glimpflich. Den Schrecken der Bevölkerung sollte man aber nicht unterschätzen. Zugleich übten die Schäden eine düstere Faszination aus: Nach dem Angriff setzte in Mettingen „Bombentourismus“ ein. Versicherungsmakler warben in Zeitungsannoncen für Policen gegen Fliegerschäden.
Die Bedrohung aus der Luft war für die Menschen des Ersten Weltkrieges ein völlig neues Phänomen. Das Kriegsgeschehen kam an der Heimatfront an. Auch Zivilisten weit hinter der Front waren potenzielle Opfer. Mit seiner Industrie war der Raum Stuttgart ein erstrangiges Ziel, das bis zum Waffenstillstand mindestens 10 Mal von Fliegern attackiert wurde.
Eröffnet hatte den Bombenkrieg die deutsche Seite. Seit 1914 bombardierten Luftschiffe und ab 1917 Großflugzeuge Städte in Belgien, Frankreich und England. Die Entente griff ihrerseits den Westen des Reiches an. In Karlsruhe starben dadurch am 15. Juni 1915 30 und am 22. Juni 1916 120 Einwohner.
In der Presse wurden die Bombardements regelmäßig als Vergeltungsschläge dargestellt. So meldete der deutsche Tagesbericht vom 12. März 1918, dass man wegen des Fliegerangriffs auf „Stuttgart, Eßlingen und Untertürkheim“ Paris „ausgiebig“ bombardiert habe. Die für das Kriegsvölkerrecht grundlegende Unterscheidung von Soldaten und – zu schonenden – Zivilisten löste sich auf.
Zwänge und Unzulänglichkeiten des Luftkrieges beschleunigten diese Entwicklung. Laut dem offiziellen deutschen Bericht flogen die britischen Piloten am 10. März 1918 in 3.000 m Höhe. Sie versuchten, dem Sperrfeuer der Flak auszuweichen und sahen sich bald von in Böblingen aufsteigenden Jagdfliegern bedrängt. Die Bodensicht war wegen des Dunstes im Neckartal schlecht. Die Folgen solcher nicht ungewöhnlichen Bedingungen führen die beschriebenen „Trefferkarten“ vor Augen. Selbst Ziele von der Größe einer ausgedehnten Fabrik ließen sich nur schwer treffen. Das galt noch bis weit ins 20. Jahrhundert und hatte die fatale Konsequenz, dass künftige Luftstrategen Städte mitsamt ihrer Bevölkerung pauschal zum legitimen Angriffsziel erklärten.
Februar 2018 - Der fotografierte Krieg: Die Fotosammlung Kienlin
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Der fotografierte Krieg: Die Fotosammlung Kienlin
(Stadtarchiv Esslingen, Sammlung Kienlin)

In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg waren die Kameras handlicher und bezahlbarer geworden. Damit hatten erstmals gewöhnliche Soldaten die Möglichkeit zu fotografieren. Zwar bemühten sich die Militärbehörden um Zensur, um das Bild der Heimat vom Krieg kontrollieren zu können. Doch ließen sich Verbote, unautorisiert an der Front zu fotografieren, nicht durchsetzen.
Ohnehin waren die Übergänge zwischen privater und offizieller Kriegsfotografie fließend. Viele privat fotografierende Soldaten wurden bald offiziell autorisiert, weil sich der Wunsch der Heimat nach Bildern von der Front nicht anders bedienen ließ. Zwar schönte die Zensur das offizielle Bild des Grabenkrieges. Die Presse zeigte keine Gefallenen der eigenen Seite. Doch hatten auch die meisten auf eigene Faust fotografierenden Soldaten die Tabus und Abbildungs-Konventionen ihrer Zeit verinnerlicht – vom Patriotismus ganz zu schweigen.
Mit der „Sammlung Kienlin“ besitzt das Esslinger Stadtarchiv einen beispielhaften Bestand privater Kriegsfotografie. Ihren Kern machen 619 Negative und 369 Fotoabzüge aus, die der Fabrikantenspross und spätere Schwiegersohn des Esslinger Oberbürgermeisters Max von Mülberger Hans Kienlin (1895–1974) 1915 bis 1918 aufnahm und sammelte. Auf Kienlin gehen auch Listen der Aufnahmen mit Bilderläuterungen zurück.
Kienlin diente vom Sommer 1915 bis zum Kriegsende beim Feldartillerieregiment 116. Es wurde vor Arras, in Litauen und Weißrussland, vor Verdun und an der Somme, ab Januar 1917 dann in den Südvogesen nahe dem Hartmannsweilerkopf eingesetzt. Dort wurde Kienlin 1917 zum Leutnant befördert.
Kienlin benutzte Kameras mit den Negativformaten 8 X 11 und 6 X 9 cm. Wir kennen die Fabrikate nicht, doch waren es Apparate mit vergleichsweise lichtstarken Objektiven, die technisch gute Aufnahmen ermöglichten.
Kienlins Motivwahl war konventionell. Landschaftsbilder aus den Vogesen kontrastieren mit Fotografien vom Stellungsbau, von Geschützen oder Kampfflugzeugen. Kienlin schoss keine Gefechtsaufnahmen. Die Belichtungszeiten damaliger Kameras taugten nicht für bewegte Szenen. Den Tod in den eigenen Reihen hielt er nur indirekt fest: etwa mit Aufnahmen zerschmetterter Geschütze. Kienlins eigentlicher „Held“ war sein Regiment. Seine Sammlung dominieren Alltags-Bilder von Unterständen und Quartieren, dazu Porträts von Offizierskameraden.
Kienlins Fotografie wirkt dokumentarisch. Auch seine Bild-Erläuterungen sind knapp. Es ist die Seh- und Ausdrucksweise des militärisch-geschulten Fachmanns.
Zur „Sammlung Kienlin“ gehören noch weitere Gruppen von Fotografien. Eine enthält gut 100 Esslinger Aufnahmen, die Kienlins späterer Schwager Wolfgang Mülberger (1900–1983) in den Jahren 1914 bis 1918 gemacht oder gesammelt hat. Zu sehen sind Straßenszenen, Einzelporträts und Gruppenbilder von Schülern, außerdem Familienfotos. Aus den Jahren 1917 und 1918 stammen Bilder von Fahnenapellen des Jungdeutschland-Bundes. Womöglich bewegte sich der junge Wolfgang Mülberger im vormilitärischen Jugend-Milieu. Sicheres wissen wir aber nicht.
Deutlicher noch als Kienlins Bilder von der Front zeigen Mülbergers Esslinger Aufnahmen, wie problematisch Fotografien als Geschichts-Quellen sind. Ihre Anschaulichkeit verleiht ihnen eine Aura von Authentizität, die trügerisch ist. Bilder transportieren immer Subjektivität. Zur Perspektive des Fotografen hinter der Kamera kommt die Sehweise der Betrachterinnen und Betrachter. Beispielsweise konnten Bilder einer zerstörten belgischen oder französischen Stadt während und nach dem Ersten Weltkrieg je nach Landsmannschaft und politischer Orientierung unterschiedliche Empfindungen auslösen: Trauer angesichts der Gewalt des Krieges, Hass auf die Urheber der Verwüstung, Stolz auf die Macht der eigenen Waffen. Und der größere zeitliche Abstand macht es nicht leichter, die Absichten und Emotionen zu entschlüsseln, die mit historischen Aufnahmen ursprünglich verbunden waren. Das gilt besonders, wenn schriftliche Zeugnisse fehlen oder, wie im Falle Hans Kienlins, nur spärlich vorhanden sind.
Januar 2018 - Pazifismus und Soldatensprachführer: Der Verlag Wilhelm Langguth
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Pazifismus und Soldatensprachführer: Der Verlag Wilhelm Langguth
1914-1918
(Stadtarchiv Esslingen, Bibliothek)

Der gelernte Buchhändler Wilhelm Langguth (1849-1929) stammte aus Oberwind in Sachsen-Meiningen. 1875 kaufte er Gustav Hohlochs Buchhandlung in Esslingen und machte aus ihr einen unter seinem Namen in der Berkheimer Straße 20 firmierenden Verlag, den er um eine Druckerei mit Buchbinderei, eine Geschäftsbücherfabrik sowie eine Prägeanstalt für Etiketten und Siegelmarken ergänzte.
Langguths Verlagsprogramm wirkt wenig zusammenhängend. In Verlagsanzeigen werden Gewerbeordnungen zusammen mit Kochbüchern, einem Lehrbuch der schwedischen Gymnastik und dem Ratgeber „Mietswohnung oder Eigenhaus?“ beworben, den der Esslinger Architekt Heinrich Werner 1914 vorlegte.
Im Herbst des selben Jahres brachte Langguth „Soldaten-Sprachführer“ für Englisch, Französisch, Italienisch und Russisch im Westentaschenformat auf den Markt, mit Auflagen bis zu 54.000, ergänzt um Soldatenliederbücher und Blanko-Kriegstagebücher zum Eintrag persönlicher Fronterlebnisse. Solche Geschäftstüchtigkeit irritiert, hatte sich Langguth doch vor dem Krieg als wichtigster Verlag der bürgerlichen Friedensbewegung profiliert, die in der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG) organisiert war.
Die DFG war 1892 in Berlin gegründet worden, hatte ihr Zentrum aber in Baden und Württemberg. Dort wurde sie von der linksliberalen Deutschen Volkspartei unterstützt, die sich wie die DFG für Völkerverständigung, Abrüstung und ein Regime rechtsförmiger Schiedsverfahren internationaler Konflikte einsetzte. Dazu kam eine günstige personelle Konstellation. In Württemberg agierte der liberale Stuttgarter Stadtpfarrer Otto Umfrid (1857–1920) besonders energisch für die DFG. Seinetwegen wurde die Geschäftsleitung 1900 nach Stuttgart verlegt und Umfrid damit zum Geschäftsführer gemacht.
Wilhelm Langguth gehörte dem Esslinger Ortsverein der DFG an. Von 1912 bis 1922 war er dessen Vorsitzender. Möglicherweise hing sein Engagement mit eigenen Kriegserlebnissen zusammen. Langguth war Veteran des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/1871 und Vorstand im 1872 gegründeten „Deutschen Krieger Verein Esslingen“. Seit 1898 verlegte er fast exklusiv Umfrids pazifistische Bücher und Broschüren, dazu von 1899 bis 1908 des Friedenspfarrers volkstümlichen Kalender „Der Friedensbote“ sowie von 1900 bis 1915 das Verbandsorgan der DFG, die 1910 in „Völker-Friede“ umbenannten „Friedensblätter“. Auch die Protokolle der erstmals 1908 abgehaltenen Deutschen Friedenskongresse erschienen in seinem Verlag.
Für die DFG brachte der Ausbruch des Ersten Weltkrieges einen drastischen Einbruch der Mitgliederzahl. Sie sank bis zum Jahresende 1914 von 10.000 auf 6.000. Im November 1915 wurden die Stuttgarter Buchhandlung der DFG von der Polizei geschlossen, öffentliche Kundgebungen und das Verbandsorgan „Völker-Friede“ verboten. Als Ersatz brachte Langguth vom Januar 1916 bis Januar 1917 die Zeitschrift „Menschen- und Völkerleben“ heraus – mit Reiseberichten und Hinweisen auf Aktivitäten ausländischer Friedensfreunde. Bezugnahmen auf die DFG waren vermieden, doch belegen blanke Seiten massive Eingriffe der Zensur. Umfrid war an der Zeitschrift nicht beteiligt – ob aus politischer Vorsicht oder wegen eines rasch voranschreitenden Augenleidens, ist unbekannt.
Wegen ihres Herausgebers bemerkenswert ist noch eine 1915 und 1916 bei Langguth verlegte Flugschriftenreihe zur „Genossenschaftlichen Kultur“. Sie gab der spätere KPD-Funktionär und Ost-Berliner Historiker Karl Bittel neben seiner Tätigkeit als Sekretär des Konsumvereins Esslingen heraus, stand aber wohl nicht in Zusammenhang mit politischen Überzeugungen ihres Verlegers.
Zum 1. April 1919 zog sich Wilhelm Langguth aus dem Geschäftsleben zurück. Er starb am 22. März 1929. In einem ausführlichen Nachruf würdigte die „Esslinger Zeitung“ Langguths Mitgliedschaft im Esslinger Bürgerausschuss und seinen Einsatz als langjähriger Vorstand des Pliensau-Vorstadt-Vereins. Unerwähnt blieb sein DFG-Engagement. Immerhin hatte es den Verleger aber auch nicht um das ehrende Angedenken der Stadtgesellschaft gebracht.
Dezember 2017 - Evangelische Kirche im Krieg: "Weihnachtsfenster" der Martinskirche Oberesslingen
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Evangelische Kirche im Krieg: „Weihnachtsfenster“ der Martinskirche Oberesslingen
Käte Schaller-Härlin, Entwurfszeichnung
Tusche auf Glanzpapier, 21x37cm
1917
(Evang. Kirchengemeinde Oberesslingen)

Über der Empore im Westen der 1828 errichteten Martinskirche in Oberesslingen befindet sich das sogenannte „Weihnachtsfenster“. Es stammt aus dem Jahr 1918 und war ursprünglich über der Kanzel eingesetzt. Entworfen hat es die Stuttgarter Künstlerin Käte Schaller-Härlin (1877–1973). Von ihr existieren noch zwei alternative Bildvorschläge in Form von Buntpapiercollagen. Den Entwurf einer Grablege Christi bewahrt das Stadtarchiv Stuttgart. Das Konzept einer Kreuzigungsszene ist Eigentum der Kirchengemeinde Oberesslingen.
Käte Schaller-Härlin war eine emanzipierte Frau mit einem ungewöhnlichen Lebenslauf. Geboren wurde sie im indischen Mangalore als Tochter des Missionars Emmerich Härlin und seiner Frau Anna. 1881 mit der Familie nach Deutschland zurückgekehrt, wuchs sie in Massenbach, Gruibingen und zuletzt Uhlbach auf. Früh entschloss sie sich, Malerin zu werden, besuchte die Städtische Gewerbeschule in Stuttgart und einen Akt-Kurs, den der bekannte Kirchenmaler Rudolf Yelin der Ältere im Württembergischen Malerinnen-Verein gab. 1900 wechselte sie an die Damen-Akademie des Münchener Künstlerinnen-Vereins. (Frauen wurden an den staatlichen Kunstakademien erst einige Jahre später zugelassen). Es folgten Reisen zum Studium der Alten Meister nach Italien und der modernen Kunst nach Paris, wo sie vermutlich Gasthörerin an der Académie Matisse war. Finanziell unterstützten sie zwei Brüder ihrer Mutter. Ihre Reisekasse besserte sie durch den Verkauf von Porträts, Kopien Alter Meister und Entwürfe von Werbegrafiken auf. Zurück in Stuttgart studierte sie im Sommersemester 1909 an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste und hörte die Vorlesungen Adolf Hölzels. Zudem verkehrte sie in Kreisen der künstlerischen Avantgarde und etablierte sich als Porträt- und Kirchenmalerin. 1911 heiratete sie den sechs Jahre jüngeren Stuttgarter Kunsthistoriker Hans Otto Schaller, eine echte Liebesverbindung. 1913 kam eine Tochter zur Welt.
Käte Schaller-Härlin war Teil einer Bewegung zur Reform des evangelischen Kirchenbaus. Der Kirchenraum sollte mit Hilfe der Bildenden Kunst veredelt werden. In Projekten mit dem Tübinger Architekten Martin Elsaesser schuf sie sakrale Wandmalereien, gestaltete aber auch Kirchenfenster, so 1907 in Balingen-Engstlatt, 1910 in Baden-Baden Lichtental und 1916 in Oberndorf am Neckar. Schließlich erhielt sie den Auftrag, ein neues Fenster für die Martinskirche in Oberesslingen zu entwerfen.
Angestoßen hatte das Oberesslinger Projekt der 1910 verstorbene Oberamtsbaumeister Wilhelm Pfäfflin. Er hatte der Kirchengemeinde 800 Mark für ein gemaltes Kirchenfenster vermacht. Der Kirchengemeinderat wandte sich an Oberkonsistorialrat Johannes von Merz, der dem Christlichen Kunstverein in Stuttgart vorstand. Merz empfahl die 1865 gegründete Stuttgarter Glasmalerei Saile für die Ausführung des Gewerks. Der mit Merz befreundete Rudolf Yelin lieferte einen ersten, heute verlorenen Entwurf.
Weil Yelins Vorschlag nicht überzeugte, bat man Käte Schaller-Härlin um ein Konzept. Nach dem Kriegstod ihres Mannes am 3. April 1917 vor Ypern war sie als alleinerziehende Witwe für neue Aufträge dankbar. 1917 legte sie ihren Kreuzigungsentwurf vor, 1918 den Vorschlag einer Grablege Christi. Sie dürfte diese Motive gewählt haben, um einen Bezug zum Kruzifix über dem Altar herzustellen. Offenbar „funktionierte“ die Bildidee aber nicht. So entwarf Schaller-Härlin zuletzt das im Herbst 1918 von der Firma Saile eingebaute Weihnachtsfenster. Es zeigt die Geburt Jesu, die Anbetung des Kindes, den Kindermord von Bethlehem und die Flucht nach Ägypten. Die Gesamtkosten betrugen 1300 Mark. 300 Mark erhielt die Künstlerin.
Käte Schaller-Härlin wurde 95 Jahre alt. Sie blieb zeitlebens eine äußerst eigenwillige, markante Persönlichkeit der Stuttgarter Kunstszene. Viele Prominente ließen sich von ihr porträtieren – darunter 1924 Theodor Heuss, mit dem sie viele Jahre befreundet war. Die Künstlerin gestaltete auch weiterhin Fenster für Kirchenräume. Ihre letzten Kirchenfenster schuf sie 1956 mit fast 80 Jahren für die Kirche ihres Wohnortes Stuttgart-Rotenberg.
November 2017 - Esslinger Juden im Krieg: Foto von Emil Schorsch in Uniform
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Esslinger Juden im Krieg: Foto von Emil Schorsch in Uniform
1917
(Privatbesitz)

Der künftige Rabbiner Emil Schorsch (1899–1982) war einer von zehn Esslinger Juden mit württembergischer Staatsbürgerschaft, die im Ersten Weltkrieg kämpften. Zwei meldeten sich freiwillig, zwei fielen, acht wurden mit dem Eisernen Kreuz, fünf mit württembergischen oder bayerischen Kriegsverdienstmedaillen ausgezeichnet.
Schorsch stammte aus dem badischen Dorf Hüngheim, wo sein Vater einen Laden betrieb. Weil seine Mutter erkrankt war, wurde Schorsch 1907 in das Esslinger Israelitische Waisenhaus Wilhelmspflege aufgenommen.
In der Wilhelmspflege begegnete Schorsch Theodor Rothschild, dem charismatischen Leiter der Einrichtung. Rothschild war Reformpädagoge. Sein Erziehungsstil verband geistige und praktische Anregung, vermittelte Kenntnis der jüdischen Religion und Glaubenstreue, dazu ein Gefühl familiärer Geborgenheit. Für Schorsch wurde Rothschild Mentor und „Ersatzvater“, ein lebensprägendes Vorbild.
Nachdem Schorsch in der Wilhelmspflege die achtjährige Volksschule durchlaufen hatte, befolgte er Rothschilds Rat und bewarb sich 1913 mit Erfolg um einen der begehrten Plätze im protestantischen Esslinger Lehrerseminar. Schorsch war dort damals der einzige jüdische Zögling. Mit Theodor Rothschild als Lehrer studierte er zusätzlich zum regulären Lehrprogramm zwölf Stunden pro Woche Hebräisch, jüdische Geschichte und Bibelkunde. Außerdem lernte er die jüdischen Religionsgesetze und ihre Auslegungstraditionen. Sein Ziel war, Lehrer an einer jüdischen Schule zu werden.
Am 12. Januar 1917 feierte Schorsch seinen 18. Geburtstag. Im Juli wurde er zum Ersatzbataillon des Württembergischen Infanterie-Regiments Nr. 180 in Tübingen eingezogen. Im September 1917 versetzte man ihn zur Artillerie. Zum Einsatz an der Westfront kam Schorsch mit dem Württembergischen Feldartillerie-Regiment Nr. 29, dem er vom 19. August 1918 bis zum 22. Dezember 1918 angehörte. Schorsch diente als Fernmelder. Seine Einheit war exponiert, zog Telefondrähte von den Infanterie-Linien zu den Feuerstellungen der Feldgeschütze. Er erlebte schwere Abwehrkämpfe gegen eine zermalmende Übermacht, Zurückweichen, zuletzt einen verlustreichen Luftangriff, dem Schorschs Einheit deckungslos auf freiem Feld ausgesetzt war. Beim Waffenstillstand befand sich sein Regiment im Vorfeld der Antwerpen-Maas-Stellung. Von dort wurde es zuerst nach Marburg, dann per Bahn in die Heimatgarnison Ludwigsburg zurückgeführt, wo die einzelnen Abteilungen vom 21. bis zum 23. Dezember 1918 eintrafen.
Nach der Abmusterung schloss Schorsch 1919 seine Lehrerausbildung in Esslingen ab und unterrichtete elf Monate an jüdischen Schulen. Umgetrieben von seinen Kriegserlebnissen beschloss er, Rabbiner zu werden und bewarb sich 1920 an dem berühmten Jüdisch-Theologischen Seminar in Breslau. Zur Aufnahme musste Schorsch Abiturskenntnisse in Latein und Griechisch nachweisen, was ihn zwei Jahre intensives Selbststudium kostete. Dazu kam der spätestens zur Ordination als Rabbiner verlangte Doktortitel einer deutschen Universität. Schorsch erwarb ihn 1925 in Tübingen aufgrund seiner religionsphilosophischen Doktorarbeit „Die Lehrbarkeit der Religion“.
1928 wurde Schorsch in Breslau ordiniert. Bereits ein Jahr zuvor, zum 16. Januar 1927, hatte ihn die jüdische Gemeinde Hannover auf ihre zweite Rabbinerstelle berufen. In Hannover engagierte sich Schorsch tatkräftig und ideenreich für die Jugendarbeit der Gemeinde, die jüdische Erwachsenenbildung und die bislang von der Gemeinde ausgegrenzten jüdischen Zuwanderer aus Osteuropa.
Württemberg und Esslingen blieb Schorsch durch viele Besuche verbunden. Am 28. Dezember 1926 hatte er in Esslingen Fanny Rothschild geheiratet, die ältere Tochter seines verehrten Lehrers Theodor Rothschild. Nach der Reichspogromnacht emigrierten Emil und Fanny Schorsch mit ihren Kindern Hanna und Ismar über England in die USA. Dort wirkte Emil Schorsch bis 1964 als Rabbiner der Gemeinde Mercy and Truth in Pottstown in Pennylvania und als ziviler Seelsorger im Militärkrankenhaus Valley Vorge.
Sein Schwiegervater Theodor Rothschild hatte sich 1938 geweigert, aus Deutschland zu fliehen. Er wurde 1944 im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet. Seine Frau Ina überlebte die Lagerhaft und emigrierte über die Schweiz in die USA, wo sie 1991 starb.
Oktober 1917: Reformationsjubiläum 1917: Aufruf zur "Reformationsdank-Spende"
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Reformationsjubiläum 1917: Aufruf zur „Reformationsdank-Spende“.
Gedruckte Anzeige im „Eßlinger Tagblatt“
10. November 1917
(Stadtarchiv Esslingen)

Die „Jubel-Feier“ zum 400jährigen Jahrestag der Reformation war ein großes Medienereignis: Bücher, Broschüren, Zeitungsartikel, Magazine, Postkarten, Flugblätter und Gedenkmünzen präsentierten Luther als „deutschen Helden“ und Vorkämpfer der Nation in einer Welt von Feinden. Diese Sichtweise behauptete das Feld aber nicht unangefochten. Prominente Theologen warnten vor einer Überbetonung des Nationalen: der universelle religiöse Gehalt von Luthers Botschaft dürfe nicht vergessen werden.
Die kirchlichen Feiern selbst fielen 1917 verhalten aus. Kriegsbedingt hatte der Deutsche Evangelische Kirchenausschuss, der Vorgänger der EKD, 1916 erwogen, die Jubiläums-Feierlichkeiten auf 1918 oder 1921 zu verschieben. Letztlich fiel die Entscheidung aber für ein bewusst zurückhaltend angelegtes Jubiläumsprogramm ohne zentrale nationale Feier. Federführend waren die einzelnen Landeskirchen.
In Esslingen orientierte sich das Programm exakt an den Vorgaben der württembergischen Kirchenleitung, des Konsistoriums in Stuttgart. Am Reformationstag selbst, dem 31. Oktober, fand morgens eine Reformationsfeier für die Esslinger Schülerinnen und Schüler statt. (Der Tag fiel auf einen Mittwoch und war zum Feiertag erklärt worden). Abends wurden Gottesdienste gehalten. Der folgende Sonntag, traditionell der eigentliche kirchliche Festtag des Reformationsgedenkens, wurde mit Gottesdiensten begangen. Der liturgisch aufwendig gestaltete Hauptgottesdienst mit Abendmahlsfeier begann um 9.30 Uhr in der Stadtkirche. In den nächsten Tagen und Wochen folgten Reformations-Feiern des CVJM, der Jung-Mädchen-Vereine und drei Vorträge. Besondere Konzerte, Straßenumzüge oder Illuminationen fanden nicht statt – anders als bei früheren Reformations-Jubiläen, den Feiern zu Luthers 400. Geburtstag 1883 oder dem Fest zum 400. Jahrestag der Esslinger Reformation 1932.
Ob solcher Kargheit dürfte den Leserinnen und Lesern der Esslinger Zeitungen eine Serie großformatiger Anzeigen ins Auge gesprungen sein. Eine davon, die Annonce aus dem Eßlinger Tagblatt vom 10. November 1917, ist unser Objekt des Monats. Mit den Anzeigen warb der Evangelische Pressverband für Deutschland im Oktober, November und Dezember 1917 für eine „Reformationsdank-Spende“ zugunsten einer Modernisierung der evangelischen Pressearbeit. Die „evangelischen Volksgenossen“ sollten mit ihren Spenden dazu beitragen, dass „die evangelische Welt- und Lebensanschauung viel mehr als bisher in das Volksleben hineingetragen“ sowie die „großen Volksnöte und Volksgefahren“ künftig wirkungsvoller bekämpft werden könnten. Konkret war diese Bestimmungsangabe wahrlich nicht! Die Spenden-Kampagne stützte sich auf lokale Komitees und erbrachte im Dekanat Esslingen 15.000 Mark, was etwa den Jahresgehältern von drei Stadtpfarrern entsprach. Am Ende waren die Geld-Gaben der „Volksgenossen“ freilich verloren. Sie wurden in Kriegsanleihen angelegt, die mit dem Zusammenbruch des Kaiserreiches und der folgenden Hyperinflation wertlos waren.
Wir wissen nicht, was zum Reformationsfest 1917 von den Esslinger Kanzeln verkündet wurde. Keiner der örtlichen Pfarrer hat seine Predigt in Druck gegeben. Die Lokalpresse meldete gut besuchte Kirchen, schwieg sich aber über die Gottesdienste selbst aus. Von der örtlichen Feier zu Hindenburgs 70. Geburtstag am 2. Oktober 1917 hatte man engagierter berichtet. Immerhin besitzen wir zwei Luther-Artikel, die in Esslingen zum Reformationsjubiläum erschienen.
Am 30. Oktober 1917 veröffentlichte das Eßlinger Tagblatt den Beitrag „Zum 31. Oktober!“ des Ludwigsburger Generalsuperintendenten Wilhelm August von Stahlecker. (Esslingen gehörte zu Stahleckers Amtssprengel). Der Prälat ging zunächst auf den Historiker- und Theologen-Streit über die Frage ein, ob Luther überhaupt als Mann der Neuzeit anzusehen sei oder eher ins Mittelalter gehöre. Dann würdigte er Luther stramm als „kerndeutschen Mann“, „Sänger“ und „Held“. Stahlecker brachte nationalreligiöse Töne zum Klingen. Immerhin verzichtete er auf Ausfälle gegen innere oder äußere Feinde. Aktuell sei Luther vor allem als nationale Integrationsfigur wichtig.
Der zweite Artikel, „Luther der Mann des Glaubens“, eröffnete die November-Ausgabe des Evangelischen Gemeindeblatts Esslingen. Verfasser war der Tübinger Professor für Praktische Theologie Paul von Wurster, ein pietistisch geprägter, sozial engagierter Konservativer und ehemaliger Pfarrer. Wurster schrieb im Predigtstil und stellte ganz auf die religiöse Aktualität von Luthers Frage ab: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Alles Streben nach Recht und Macht – auch als Volk – habe vor dieser Frage zurückzutreten.
Wursters und Stahleckers Artikel führen lokal vor Augen, dass sich das Reformationsgedenken von 1917 inhaltlich nicht auf einen Nenner herunterbrechen lässt. Wie weit die protestantische Kirche ihre Schäfchen noch erreichte, wissen wir nicht. Eine ruhige, religiöse Ansprache dürfte der erschöpften Bevölkerung aber entgegengekommen sein. Auf allzu martialische Töne zu verzichten, hatte außerdem den Vorteil, Sozialdemokraten und Katholiken nicht zu provozieren. Das hatte in der innenpolitisch angespannten Lage vom Sommer und Herbst 1917 Gewicht.
September 2017 - Notgeld aus Esslingen: 50-Pfg-Schein
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Notgeld aus Esslingen: 50-Pfennig-Schein
1917
5,5x8,8 cm
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 005477)

Im Verlaufe des Weltkrieges wurde auch in Esslingen das Kleingeld knapp. Die Menschen bemerkten den Wertverfall und horteten Münzen wegen ihres Metallwertes. Vor allem die silbernen ½-Mark-Münzen waren beliebt. In über 20 Sitzungen beschäftigte sich der Esslinger Gemeinderat während des Krieges mit dem Thema „Notgeld“. Im April 1917 beschloss er erstmals die Ausgabe von „Kriegspapiergeld“ in Form eines 50-Pfennig-Scheins, der ab dem 10. September 1917 an die Bevölkerung ausgegeben wurde.
Entworfen hat den Schein der renommierte Kunsthandwerker und Professor für Metallkunst an der Stuttgarter Kunstgewerbeschule Paul Haustein (1880-1944). Hergestellt hat die 500 000 Stück des im Mehrfarben-Lithographie-Verfahrens produzierten dreifarbigen Scheins der Esslinger J. F. Schreiber-Verlag zu einem Preis von 3900 Mark. Auf der Vorderseite sind eine Esslinger Stadtansicht, die Wertangabe, die Gültigkeitsdauer bis zum 1. September 1919, die Unterschrift von Oberbürgermeister Max von Mülberger und eine sechsstellige fortlaufende Nummer aufgedruckt. Auf der Rückseite sind Weinreben als Jugendstilornamente, das Stadtwappen - der Reichsadler mit Brustschild „CE“ (Civitas Esslingensis) -, Schwert und Hammer sowie die Jahreszahl 1917 zu sehen. Das Wasserzeichen in Form eines sternförmigen Musters sollte Fälschungen erschweren.
Gegen Ende des Krieges spitzte sich der Geldmangel weiter zu, da die Reichsbank wegen Personalmangels keine Scheine mehr nachdrucken konnte. Die Gemeinden sollten sich deshalb um die Ausgabe von 5-, 10- und 20-Mark-Scheinen kümmern. In den Jahren bis zur Hyperinflation 1923 versuchten Reichsbank, örtliche Banken und die Gemeinden reichsweit und auch in Esslingen durch die massenhafte Ausgabe, den Einzug und die Neuausgabe von Hunderttausenden von Geldscheinen der Lage Herr zu werden. So wurden im Oktober und am 1. November 1918 in Esslingen zunächst 20 000 Mark und weitere 75 000 Mark „Notgeld“ in 10-Mark-Scheinen ausgegeben. Während diese Scheine bereits im März 1919 wieder eingezogen wurden, verlängerte man nicht nur die Gültigkeit der 50-Pfennig-Scheine zunächst bis zum 1. Januar 1920, sondern der Gemeinderat beschloss sogar, weitere 200 000 Stück dieser Scheine drucken zu lassen, die, wie die alten 50-Pfennig-Scheine, die noch im Umlauf waren, dann bis 1. Januar 1921 gelten sollten.
Parallel dazu versuchten 16 Esslinger Industrieunternehmen, darunter Friedrich Dick, Fritz Müller, Merkel & Kienlin, F. W. Quist und die Maschinenfabrik Esslingen, eigenständig das Problem der Geldknappheit zu lösen. Vor allem an Zahltagen waren oftmals zu wenige Geldscheine verfügbar, so dass die Löhne und Gehälter nicht ausgezahlt werden konnten. Aus diesem Grund gaben die Firmen so genannte „Firmenscheine“ bzw. „Firmengutscheine“ als Ersatz aus, die dann bei der Bank eingelöst oder mit denen direkt in den Geschäften bezahlt werden konnten. Aus Esslingen sind 60 solcher Scheine bekannt. Diese von der Reichsbank nicht geduldete Praxis sollte von den Gemeinden verhindert und die „Gutscheine“ eingezogen werden. Dies gelang jedoch kaum.
Am 23. Oktober 1923, zum Zeitpunkt der Hyperinflation, ermächtigte der Gemeinderat die Stadt, weitere Notgeldscheine im Gesamtwert von 1000 Billionen Mark auszugeben. Wenige Tage danach wurde die Summe auf 3000 Billionen erhöht. Diese wurden in 500 000 Mark-, 10 Millionen Mark- und
schließlich am 7. November 1923 in 500 Millionen- und 1 Billion Mark-Scheinen ausgegeben. Viele der Scheine kamen allerdings nie in Umlauf, da der Werteverfall rasant war. Zudem waren sie bereits damals zu einem beliebten Sammlerobjekt der Zeitgenossen geworden.
August 2017 - Die Verwaltung der Stadt im Krieg: Gemeinderatsprotokoll
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Die Verwaltung der Stadt im Krieg: Gemeinderatsprotokoll
1917
2 Bände, Folio (ca. 34,5 x 21,5 cm), dunkelblauer Halbledereinband
(Stadtarchiv Esslingen, Gemeinderatsprotokoll 1917, 2 Teilbände)

Die seit den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts fast lückenlos erhaltene Serie der städtischen Rats- bzw. Gemeinderatsprotokolle gehört zu den bedeutendsten Beständen des Stadtarchivs Esslingen: Die in den einzelnen Bänden rechtsverbindlich festgehaltenen Entscheidungen des zentralen kommunalen Gremiums spiegeln gerade in Krisenzeiten wie kaum eine andere Quelle die wesentlichen Materien wider, die von den politisch und administrativ Verantwortlichen zu lösen waren - und verweisen somit zumindest indirekt auf den Zustand der Stadtgesellschaft.
Der Gemeinderat blieb auch im Ersten Weltkrieg die zentrale kommunale Entscheidungsinstanz der Stadt Esslingen am Neckar. Das aus zwei Teilbänden bestehende, zumeist handschriftliche Protokoll der Sitzungen des auch im Jahr 1917 alle zwei Wochen tagenden Gemeinderats umfasst 1434 Seiten. Insgesamt wurden 687 Tagesordnungspunkte abgehandelt und in der Regel handschriftlich protokolliert.
So bedeutsam die Entscheidungen des Gemeinderates blieben, die Epoche des Ersten Weltkriegs war auch in Esslingen durch eine extreme Verdichtung der politischen Entscheidungen und des Verwaltungshandelns gekennzeichnet, wobei es offen bleiben muss, wie groß die Handlungsspielräume auf der lokalen Ebene wirklich waren. Seit der Mobilmachung am 2. August 1914 sah sich die Stadtspitze ständig zu Anpassungen an wechselnde Realitäten unter sich immer mehr erschwerenden Bedingungen gezwungen. Dies führte unmittelbar nach Kriegsbeginn zunächst zur Einsetzung einer 14köpfigen Kriegskommission, die sich aus Angehörigen des Gemeinderats, des Bürgerausschusses und der höheren Beamtenschaft rekrutierte und die in vier Unterausschüssen die dringendsten Fragen, vor allem die Unterstützung der Familien der ausrückenden Soldaten, zu regeln versuchte.
Nachdem die ersten Wochen nach der Mobilmachung vergleichsweise gut gesteuert werden konnten, brachte der weitere Verlauf des Krieges eine permanente Verschlechterung der Versorgungslage, die zur Zwangsbewirtschaftung einer Vielzahl von Gütern, Brennstoffen und vor allem Lebensmitteln führte. Die materielle Not und Bedürftigkeit von weiten Teilen der Bevölkerung, nicht nur im „Kohlrübenwinter“ 1916/17, nahm zu. Auch die überbordende und letztlich gescheiterte zentralisierte Kriegswirtschaft der Reichsregierung, das Wirrwarr der Kompetenzen auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen, und die Ausdünnung der Verwaltung aufgrund von Einberufungen zwangen dazu, die kommunalen Entscheidungs- und Verwaltungsstrukturen immer wieder nachzubessern. So bekamen bereits bestehende Ämter immer wieder neue und immer mehr Aufgaben, andere städtische Einrichtungen (vom „Lebensmittelamt“ bis zu den sog. „Kriegsküchen“) wurden neu geschaffen. Außerdem wurde ein beinahe unübersehbares Geflecht aus Ausschüssen und Kommissionen aufgebaut, die mit Mitgliedern der „Bürgerlichen Kollegien“, Angehörigen der Verwaltung und Vertretern und Vertreterinnen der Stadtgesellschaft, die ihrerseits vielfältige karitative und soziale Aktivitäten entfaltete, besetzt waren. Ein im Dezember 1916 gebildeter „Kriegsausschuß für Konsumenteninteressen“ macht zumindest deutlich, dass man sich bemühte, die Bevölkerung so weit wie möglich einzubinden und die knappen Ressourcen so gerecht wie möglich zur Verteilung kommen zu lassen.
Es hat den Anschein, dass es in der Endphase des Krieges in Esslingen zumindest in Ansätzen gelungen ist, die völlige Desintegration und Zersplitterung der vom Krieg erschöpften Stadtgesellschaft, wie sie Roger Chickering eindrucksvoll für Freiburg hat nachweisen können, zu verhindern. Dies war, neben eher günstigen Rahmenbedingungen, sicherlich auch dem übergroßen Einsatz der allermeisten zu verdanken, die parteien- und weltanschauungsübergreifend in den städtischen Gremien und der Verwaltung jahrelang bis zur Erschöpfung gearbeitet haben.
Juli 2017 - Die Wunden des Krieges: Lazarette und Verwundete in Esslingen
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Die Wunden des Krieges: Lazarette und Verwundete in Esslingen
Zwei Postkarten
1914,1917
9x13,1 cm
(Stadtarchiv Esslingen, PK Kirsch 24, PK 1024z)

Bereits wenige Tage nach Kriegsbeginn waren Tausende von Toten und Verwundeten zu beklagen. Die Verwundeten wurden nach einer Erstversorgung hinter der Front in Lazarette in die Heimat verbracht. Auch in Esslingen gab es während des Ersten Weltkrieges vier Gebäude, die zu Lazaretten umfunktioniert wurden. Von einigen von ihnen besitzt das Stadtarchiv Esslingen Fotografien und Postkarten wie diese beiden des 1913 eröffneten israelitischen Waisenhauses, das zwischen Mitte September 1914 und Februar 1919 als „Lazarett IV“ genutzt wurde.
Seit Ende August 1914 waren drei weitere Esslinger Gebäude zunächst als Hilfslazarette, dann als Lazarette eingerichtet worden: das mit einer römischen „I“ bezeichnete im Esslinger Krankenhaus, das mit einer „II“ im Mädchenheim der Firma Merkel (damals: Oberesslinger Str. 2, heute: Plochinger Straße 2), und das mit einer „III“ in der staatlichen Seminarturnhalle in der Beblingerstraße 10. Das letztere wurde sogleich mit 45 Verwundeten belegt.
Die erste Postkarte zeigt 44 verwundete und kranke Soldaten sowie Pfleger, Rot-Kreuz-Schwestern und Theodor Rothschild, der Hausvater des israelitischen Waisenhauses und Lazarettleiter in Anzug und Krawatte vor dem Eingang des israelitischen Waisenhauses. Insgesamt wurden 2035 Verwundete und Kranke während des Krieges hier gepflegt. Die meisten der abgebildeten Verwundeten haben leichte Verletzungen, einige tragen zwar Verbände, aber Schwerverletzte sind nicht darunter. Wobei aus Artikeln in der Eßlinger Zeitung bekannt ist, dass auch Schwerverwundete in den Esslinger Lazaretten versorgt wurden.
Als Postkarte gestaltet konnten die auf dem Foto abgebildeten, verwundeten Soldaten diese nutzen, um Grüße nach Hause zu schicken und mitzuteilen, dass es ihnen gut gehe. Dies tat auch ein nicht näher bekannter Gefreiter Tambour Rapp, der die Karte am 12. Oktober 1914 von Esslingen nach Sillenbuch verschickte. Auf der zweiten Postkarte hat ein Soldat sein Zimmer im Obergeschoss des Waisenhauses mit einem Kreuz markiert. Am rechten Erker notierte der Schreiber: „hier ist mein Spatzennest“. Wäre da nicht auf der Karte gedruckt zu lesen „Waisenhaus, zur Zeit Lazarett“, könnte man vermuten, es handelte sich um ein Sanatorium oder großes Hotel.
Wie viele Verwundete insgesamt in den Esslinger Lazaretten während des Krieges behandelt wurden, ist nicht genau bekannt, aber es gibt Hinweise, dass es Tausende gewesen sein müssen. Im Vordergrund aller pflegerischen und ärztlichen Bemühungen stand das Ziel, die Verletzten schnellstmöglich wieder einsatzfähig zu machen und an die Front zu schicken. Die ärztliche Betreuung in den Esslinger Lazaretten wurde von hiesigen Ärzten übernommen. Vom Lazarett I ist notiert, dass Obermedizinalrat Ernst Späth, der sich bereits im Ruhestand befand, die Leitung übernommen hatte. Das Lazarett IV, das israelitische Waisenhaus, führten 1915 Dr. Paul Bunse als Chefarzt und Dr. Paul Krauß. Beide waren Neurologen und nicht Chirurgen. Wie sie waren wohl die meisten Esslinger Ärzte nicht auf Verletzungen durch Granatsplitter, Versorgung und Nachbetreuung von Männern mit amputierten Gliedmaßen geschult.
Der Lazarettalltag der Verwundeten war von Langeweile geprägt. In den ersten Kriegsmonaten müssen manche der Leichtverletzten die Wirtshäuser der Stadt so häufig besucht haben, dass noch im Oktober 1914 ein generelles Alkohol- und Wirtshausverbot für sie erlassen wurden. Um ihnen die Zeit zu verkürzen und ihre Handfertigkeiten zu üben, ließ man die Lazarettinsassen Korbflecht-, Schnitz- und Filetarbeiten, Netze und Hängematten, Strickereien und Knüpfarbeiten anfertigen. Solche „Verwundetenarbeiten“ wurden in örtlichen Geschäften ausgestellt und zu Gunsten der Verwundeten verkauft.
Abwechslung in den monotonen Lazarettalltag brachten auch Vereine wie der Sängerbund, Liederlust Mettingen oder der Posaunenchor des Jünglingsvereins und Lehrer mit ihren Schülern und Schülerinnen durch die Gestaltung bunter Abende. Zu den prominentesten Besuchern gehörte Königin Charlotte von Württemberg. Auch regelmäßige Ausflüge auf die Teck, den Reußenstein oder nach Bad Urach unterbrachen für kurze Zeit die Monotonie. Sie wurden im Laufe des Krieges jedoch seltener.
Die Lazarette existierten noch über das Kriegsende hinaus. Am 3. Mai 1919 schrieb Obersekretär Sprandel vom Militärverein Esslingen, Verwundete hätten ihn besucht und sich beklagt, dass sie vergessen würden, denn es fänden keine Besuche und keine Ausflüge mehr statt. Wann die letzten auswärtigen Verwundeten Esslingen verlassen haben, ist ebenso wenig bekannt wie die Zahl der in den Esslinger Lazaretten Verstorbenen. Rund 20 von ihnen wurden im Ehrenmal auf dem Ebershaldenfriedhof bestattet.
Juni 2017 - Papierkrieg: Maschinenschriftliche Feldpostkarte aus Esslingen
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Papierkrieg:
Maschinenschriftliche Feldpostkarte aus Esslingen
19179 x 14,1cm(Stadtarchiv Esslingen, Pk 2911)
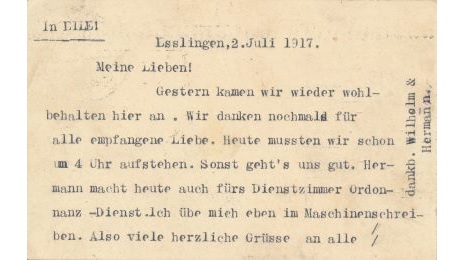
Der Erste Weltkrieg wäre ohne die immer wichtiger werdende Bürokratie undenkbar gewesen. Die „Waffe“ der Verwaltung war die Schreibmaschine. Seit den 1890er Jahren hatte die Schreibmaschine zunächst in den USA, dann weltweit immer mehr Verwendung in Verwaltung und Wirtschaft gefunden. Ihr Einsatz hatte vor dem Ersten Weltkrieg zu großen Effizienzsteigerungen geführt. Die männlichen Schreiber in den Betrieben wurden allmählich durch die Schreibmaschinenschreiberinnen verdrängt. Auch das deutsche Militär übernahm das neue Schreibmittel im Lauf der Zeit. Zum Lärm des Ersten Weltkriegs gehörte das Geklapper der Schreimaschinen genauso wie das Geknatter der Maschinengewehre. Beim Militär wuchs sich ihr Einsatz zum sprichwörtlichen „Papierkrieg“ aus. Massenhaftes Sterben und massenhaftes Verwalten von Material und Vorhalten von „Kanonenfutter“ bedingten sich wechselseitig. Das Individuum, das sich in den Materialschlachten verlor, hinterließ höchstens noch Spuren in den Aktenbergen des „Papierkrieges“.
Die Kriegsakten, die die deutschen Einheiten zu führen hatten, schwollen im Verlauf des Krieges immer mehr an. Unter einem Betreff im Kriegsjahr 1917 war mindestens die zehnfache Menge dessen – wenn nicht noch viel mehr – an Papier abgelegt wie 1915. Und diese Akten waren bereits zum größten Teil mit der Maschine geschrieben.
Man schätzt, dass während des Ersten Weltkrieges 28 Milliarden Sendungen von Feldpost verschickt wurden. Die Briefe und Karten wurden damals noch von Hand geschrieben. Aus Esslingen liegt nun eine seltene private, unscheinbare Feldpostkarte vor, die mit der Schreibmaschine beschrieben wurde. Der Absender schreibt als Angehöriger des in Esslingen garnisonierten Ersatzbataillons 246 an seine Mutter. Er verweist darauf, dass er die Karte auch als Übung im Maschineschreiben verfasst habe. Die Karte ist so nebenbei Dokument militärischer Ausbildung. Über den Absender der Karte ist bis auf den Eintrag in der Stammrolle seines Regiments nichts Weiteres bekannt. Der Musketier Wilhelm Adolf Braun (geb. 1898) stammte aus Besigheim am Neckar und war „Notariatskandidat“. Am 22. Januar 1917 wurde er einberufen. Später scheint er zu den Scheinwerfern gekommen zu sein und hat den Ersten Weltkrieg offenbar überlebt. Sein Name taucht weder in den Verlustverzeichnissen seines Regiments auf noch in der aktuellen Datenbank des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
Bei der Postkarte handelt es sich um eine vorgedruckte „Feldpostkarte“. Hier mussten nur noch die Absenderangaben zu den verschiedenen Einheiten und Waffengattungen eingetragen werden. Die Organisation von Heer in Armeekorps, Division und Regiment wird hier ebenso deutlich wie die Gliederung der Marine in Schiff und Geschwader. Der Stempel weist als Ort der Postaufgabe Esslingen aus. Die Karte ist auf den 2. Juli 1917 datiert.
Dokumentiert wird der erste Tag im Dienst nach dem Urlaub. Dies ist meist ein unangenehmes Datum. Das Wecken in aller Herrgottsfrühe, wie hier erwähnt um vier Uhr morgens, ist ein beliebtes militärisches Erziehungsmittel. Ordonanzdienst meint die Unterstützung von Vorgesetzten, indem man etwa schriftliche oder mündliche Befehle verteilt oder bekannt macht.
Mit dem Absender „Pliensauschule“ wird deutlich, dass das Militär die Schulen als Ersatzkasernen in Beschlag genommen hat. Hier waren vor der Fertigstellung der Kaserne seit März 1916 etwa 500 Mann des Ersatzbataillons des 246er-Regimentes untergebracht. Das im September 1914 aufgestellte Reserve-Infanterie-Regiment 246 war im Herbst bei Becelaere in Flandern aufgerieben worden; sein Ersatzbataillon wurde am 22. April 1915 in Esslingen aufgestellt. Im Laufe des Krieges wuchs die Einheit wegen des ständig größer werdenden Bedarfs an Soldaten immer weiter an.
Der im Ersten Weltkrieg vermehrte Einsatz von Schreibmaschinen setzte sich in den 1920er Jahren fort – bis sie am Ende des Jahrhunderts durch Computer ersetzt wurden. Ihre Nutzung in heutiger Zeit, etwa beim russischen Geheimdienst, wo besonders geheime Schriftsätze nur auf Schreibmaschine geschrieben werden dürfen, beruht auf ihrer Fähigkeit, ohne jede elektronische Vernetzung individuelle Texte zu ermöglichen. Ein Schreibmaschinenblatt erhält damit heute die Qualität von handschriftlichen Zeugnissen der Vergangenheit.
Mai 2017 - Schützengrabenkunst: Wanderstock von Gotthilf Sohn
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Schützengrabenkunst: Wanderstock von Gotthilf Sohn
Holz, Metall
1916
Länge 130cm, Breite 18cm
(Privatbesitz)

Die genauen Umstände, unter denen Gotthilf Sohn (geb. 1874) aus Sulzgries den Wanderstock aus der Zeit des Ersten Weltkriegs angefertigt hat, sind zwar nicht bekannt, doch der Stock selbst liefert einige Hinweise: Mit einem Messer sind in den Griff die Initialen des Herstellers „GS“, das Wort „Vogesen“, die Jahreszahlen „1914“ und „1916“ sowie eine Pickelhaube und in den Stock ein Eisernes Kreuz mit einem „W“ (für Wilhelm II) sowie Enzian-ähnliche Blumen eingeritzt. Die Astlöcher hat Sohn mit Nägeln verschlossen, das Ende des Stocks mit einer Metallspitze versehen. Ob der ehemalige Besitzer den Wanderstock tatsächlich während des Krieges als Unterstützung bei Märschen auf dem oftmals schlammigen Untergrund genutzt oder diesen lediglich als Erinnerungsstück an diese Zeit angefertigt hat, ist nicht bekannt. In der Familie wurde der Stock als Erinnerungsstück aufbewahrt.
Wie Gotthilf Sohn haben viele Soldaten das Warten zwischen den Gefechtspausen genutzt, um dekorative und nützliche Gegenstände aus Kriegsschrott oder Naturmaterialien wie Holz, Knochen oder Kreide, die sie fanden, herzustellen. Sie fertigten mit den einfachsten Mitteln Vasen und Wärmflaschen aus Granathülsen, Brieföffner aus Granatsplittern, Armreifen aus Granatführungsringen, Manschettenknöpfe, Bleistiftverlängerer und Ringe aus Patronen, Schmuckkästchen aus Holz oder Musikinstrumente aus Wein- und Munitionskisten. Von der Wissenschaft werden solche von Soldaten, Kriegsgefangenen oder Lazarettinsassen hergestellten Dinge aus Kriegszeiten als „Schützengraben-“ oder „Soldatenkunst“ („Trenchart“) bezeichnet. Wobei „Kunst“ eher „Kreativität“ bedeutet und „Schützengraben“ für die Herstellung in Unterständen in Frontnähe, in der Etappe, in Lazaretten und Kriegsgefangenenlagern steht.
Die Vielfalt an Material und Form ist enorm. Objekte aus Holz stellen die älteste und vielfältigste Form von Trenchart überhaupt dar. Das Material (Äste, Rinde, Holzstücke) war einfach zu bekommen, und für die Verarbeitung brauchte man nur ein Messer, was jeder Soldat sowieso bei sich trug. Die Variationsbreite an Holzobjekten reicht von einfachen, ungelenken Schnitzereien von Stöcken und Ritzereien in Rindenstücke bis hin zu kunsthandwerklich gefertigten Objekten wie Schmuckdosen oder Bilderrahmen mit aufwändiger Kerbschnitttechnik.
Ein typisch französisches Trenchart-Objekt waren selbst gebaute Musikinstrumente wie Geigen, Cellos, Banjos und Gitarren aus hölzernen Wein- und Munitionskisten, auf denen die Soldaten Musik machten. Darüber hinaus sind nur wenig Musikinstrumente bekannt, beispielweise ein Glockenspiel aus Glasflaschen oder Mandolinen aus Feldflaschen, die von deutschen und russischen Soldaten in Kriegsgefangenenlagern hergestellt wurden. Soldaten und Gefangene nutzten auch die Gelegenheit, durch den Verkauf der selbst gemachten Dinge etwas Geld zu verdienen.
Auch wenn die Soldaten vielfach populäre Kunststile wie den Jugendstil imitierten und mit nationalistischen und militärischen Motive wie dem Eisernen Kreuz ihre Arbeiten verzierten, hat die Trenchart nichts mit dem offiziellen, in Serie und zu propagandistischen Zwecken produzierten „Hurra-Kitsch“ zu tun. Trenchart-Objekte wurden individuell, zu privaten Zwecken, oftmals als Erinnerungsstück an den Krieg oder als Geschenk für die Angehörigen hergestellt. Sie waren – wie die Feldpost – ein Band zwischen Front und Heimat. In diesen Gegenständen spiegelte sich die Hoffnung der Soldaten, den Krieg zu überleben, und für die Angehörigen waren sie ein Lebenszeichen von der Front. War der Hersteller allerdings gefallen, so wurde aus einem Objekt der Hoffnung ein Objekt der Trauer und des Gedenkens.
Gerade die ästhetisch aufwendigen Objekte wie auf Hochglanz polierte Vasen aus Granathülsen, die mit floralen Mustern und patriotischen Symbolen punziert wurden, standen im Widerspruch zu den Schrecken des Krieges. Auch wenn sie aus authentischem Kriegsmaterial bestehen, verweist nichts auf die zerstörerische Kraft des Krieges. Sie lenken vielmehr davon ab. Das Schöne verdeckt den Kriegsschrecken. Die Soldaten versuchten, mit diesen schönen Dingen der Zerstörungskraft des Krieges etwas entgegenzusetzen. Zugleich wurde Schreckliches verdrängt und durch heroische Erinnerungen ersetzt. Nach dem Krieg erhielten die Schützengrabenkunst-Objekte schließlich Beweisfunktion. Sie belegten für den Besitzer: „Ich habe am Krieg teilgenommen und habe ihn überlebt“.
April 2017 - Metallsammlung: Abendmahlskelch aus Zinn
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Metallsammlung: Abendsmahlskelch aus Zinn
Johann Friedrich Wagner, Esslingen 1749-1781
Englisches Blockzinn
H. 27, D. 12,4 cm
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 001246)

Der Erste Weltkrieg wurde mit einem bis dahin beispiellosen Einsatz an Material bestritten. Der entscheidende Faktor für Sieg oder Niederlage war der Nachschub von Waffen und Munition. Der Zugang zu den Weltmärkten und Weltmeeren wurde den Mittelmächten durch Fronten und die maritime Überlegenheit der Alliierten blockiert. Damit war der kriegswichtige Import des Sprengstoffrohmaterials Salpeter, von Baumwolle und verschiedenen Buntmetallen fast unmöglich.
Diese waren besonders knapp und wurden durchgängig gesammelt. Kupfer, Nickel, Zinn, Aluminium, Antimon und Hartblei waren auch in Legierungen ab 1915 meldepflichtig und galten als beschlagnahmt. Das waren Materialvorräte der Industrie, bronzene Denkmäler, Glocken, aber auch Kupferdächer. Die Städtische Metallsammelstelle in Esslingen war am Markt 25/26 im Gebäude der Alten Lateinschule, der heutigen Stadtkämmerei in der Abt-Fulrad-Straße 3.
Der Oberlehrer der Evangelischen Knabenschule Christoph Klöpfer berichtet von den Buntmetallsammlungen der Esslinger Schüler, die von Messing-Türklinken und Klavierleuchtern bis zu kupfernen Herdschiffen und Gugelhupfformen alles ablieferten. Und Hauptlehrer Christian Seeger von der Evangelischen Mädchenschule ergänzt, dass die Esslinger Schüler im Jahr 1915 fast 55 Tonnen Metall und 1916 45 Tonnen Metall gesammelt haben. Allein von der Schelztor-Oberrealschule wurde im Krieg für 40.000 Mark Gold abgeliefert, es wurden 126 kg „Sparmetalle“ gesammelt, 6.700 kg Papier, 792 Bücher, 334 Hüte, 87 kg Obstkerne, 11 kg Sonnenblumenkerne, 343 kg Bucheckern, 574 kg Frauenhaare und Brennnesseln, 50 kg Quecken und 8.600 kg Laub als Einstreu fürs Vieh.
Oft sollten auch künstlerisch oder historisch wertvolle Metallgegenstände eingeschmolzen werden. Diese konnten zum Teil gerettet werden. So wurden auch einige Zinngegenstände nach der Zinnbeschlagnahmung vom 11. Januar 1917 vom Altertumsverein eingetauscht. Dazu gehört vor allem ein Abendmahlskelch, den der aus Halberstadt gebürtige Esslinger Meister Johann Friedrich Wagner zwischen 1749 und 1781 aus reinem englischen Blockzinn ohne die übliche Zumischung von Blei verfertigt hat. Für das Kultgefäß kam offenbar nur beste und teure Rohware zum Einsatz. An seinem beachtlichen Fassungsvermögen von einem Dreiviertelliter Wein ist dieser barocke Kelch als protestantischer Abendmahlskelch zu erkennen. Bei den Katholiken sind die Kelche deutlich kleiner, weil ja nur der Geistliche einen Schluck aus ihnen trinkt.
Ab dem 1.März 1917 gelten reichsweit alle Glocken mit mehr als 20 kg Gewicht als beschlagnahmt und werden in 3 Kategorien eingeteilt. Kategorie A ist sofort einzuschmelzen, Kategorie B (besonderer künstlerischer oder historischer Wert) wird vorerst zurückgestellt, Kategorie C (vor 1770 gegossen) ist vom Einschmelzen befreit. Jede Kirche darf nur eine einzige „Läuteglocke“ zurückhalten, in der Regel die kleinste. Insgesamt sind in Esslingen mindestens 12 Kirchenglocken abgeliefert worden: je zwei aus der Frauenkirche, aus St. Bernhardt und aus Oberesslingen, je eine aus der Ostkirche (heute: Johanneskirche), der Friedenskirche, aus Mettingen und Sulzgries sowie eine neue Glocke, die noch gar nicht aufgehängt war. Als letzte wurde am 21. August 1918 die mächtige, 900 kg schwere Vaterunser-Glocke der Stadtkirche abgenommen. Sie konnte vor Kriegsende nicht mehr eingeschmolzen werden, wurde nach dem Krieg zurückerworben und neu aufgehängt. Reichsweit wurden etwa 65.000 Glocken eingeschmolzen; das bedeutet im Schnitt pro 1.000 Einwohner eine Glocke.
Man sammelte nicht nur Metalle. Leder wurde im Heer für Pferdegeschirr und Stiefel benötigt, die Marine brauchte Dichtungen und Dichtungsringe: Langes Frauenhaar ersetzte hier den Hanf. Textilien wurden immer knapper, da Wolle und Baumwolle fast nicht zu beschaffen waren. Bei Merkel & Kienlin und der Württembergischen Baumwollspinnerei und Weberei verarbeitete man deswegen Papierfasern. Die Materialnot steigerte sich immer weiter, und in den letzten Kriegsmonaten sammelte man praktisch alles.
Indem sie sich selbst ausplünderte, wollte die Heimatfront die Angehörigen im Kriegseinsatz, aber auch die Kriegsführung insgesamt unterstützen. Die Menschen glaubten, ihren Teil an einem großen Verteidigungskampf zu leisten. Das ließ sie eine vierjährige Dauernotlage ertragen, die unter anderen Umständen leicht zu Widerstand und Rebellion hätte führen können. Insgesamt konnte aber auch der gewaltige Kraftakt der Materialsammlungen den ungeheuren Materialbedarf der Kriegsführung nicht befriedigen.
März 2017 - Musik in den Zeiten des Krieges: Kavallerie-Trompete in Es
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Musik in Zeiten des Krieges:
Kavallerietrompete (deusche Ordonnanz) in Es
Metallblasinstrumentenmacher Franz Schediwy, Ludwigsburg1915L 47,5cm; T 13cm; D 13cm(Privatbesitz)

Die immer noch gut spielbare Kavallerietrompete wurde während des Ersten Weltkrieges vom Esslinger Karl Geisel (1896-1978) gespielt. Hergestellt hat sie die Werkstatt des bekannten Metallblasinstrumentenmachers Franz Schediwy (1851-1933) in Ludwigsburg für das 4. Württembergische Feldartillerieregiment Nr. 65. Die Kordel wurde vermutlich später ergänzt.
Schediwy stammte aus Böhmen und kam in den 1870er Jahren nach Württemberg. Die Firma war königlicher Hoflieferant und belieferte zahlreiche Militärkapellen der württembergischen Armee. Seine berühmten Trompeten, Cornets und Kreuzpistons waren auch außerhalb Deutschlands sehr begehrt.
Mit Hilfe von 43 Signalen übermittelten Kavallerie-Trompeter Befehle an die Truppe. Während des Krieges wurde diese Funktion nach und nach durch Signalpfeifen ersetzt. Musik wurde beim Militär aber nicht nur zur Kommunikation verwendet. Sie diente auch der Repräsentation oder erleichterte die Mühen auf dem Marsch und sorgte für den richtigen Tritt. Im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg existierte im Ersten Weltkrieg noch keine musikalische Truppenbetreuung.
Über das Musikleben an der Front ist nur wenig bekannt, da dieses Thema in Briefen und Berichten allenfalls am Rande erwähnt wird. Vermutlich kamen die Soldaten vor allem im religiösen Bereich, z. B. bei Gottesdiensten, mit Musik in Berührung oder sangen Lieder zum Zeitvertreib. Musik hatte für sie wohl vor allem eine psychische Bedeutung: Sie wirkte angst- und spannungslösend, machte Mut, unterstützte das Gemeinschaftsgefühl und erinnerte sie an die glückliche Zeit vor dem Krieg.
In der Heimat hatte Musik ebenfalls große Bedeutung. Doch wirkte sich der Krieg stark auf das Konzertleben aus. Viele Aufführungen hatten auch propagandistische Ziele. Sie wurden nun häufig als „„Vaterländische Abende“ und als Wohltätigkeitsveranstaltungen durchgeführt. Von Seiten der Musikwissenschaft gab es Empfehlungen, welche Stücke für die Konzertprogramme geeignet waren. Kompositionen aus den Ländern der Kriegsgegner waren verpönt. Auch an der Heimatfront diente Musik dem Gemeinschaftsgefühl, außerdem sollte sie den Siegeswillen und die Durchhaltekraft stärken. Sie lenkte die Menschen vom harten Kriegsalltag ab und ließ die erlittenen Opfer erträglicher erscheinen. Gleichzeitig thematisierten viele Musikstücke den möglichen Tod der Soldaten, halfen über Verluste hinweg oder dienten dem Gefallenengedenken.
Wie sich das Musikleben in Esslingen im Krieg veränderte, ist nicht erforscht und nur schwer zu ermessen. In den Protokollbüchern der Esslinger Gesangsvereine im Stadtarchiv finden sich aber doch wertvolle Hinweise. Einige Vereine stellten bei Kriegsbeginn ihre Proben ein und nahmen sie erst im Spätherbst 1914 wieder auf. Viele Sänger wurden eingezogen, so dass die Chöre deutlich kleiner waren. Hemmend wirkte sich auf das Vereinsleben aus, dass das Militär Übungs- oder Konzerträume belegte und der Probenbesuch nachließ, da die in der Heimat verbliebenen Mitglieder häufig in Nachtschichten
arbeiteten. Daher erwog der Arbeitergesangverein „„Neckarlust“ sogar seine Auflösung.
Ein durch den Krieg neu zu ihren Aufgaben gekommenes Tätigkeitsfeld sahen die Vereine im Versand von „„Liebesgaben“ an ihre eingezogenen Mitglieder. Damit versuchten sie, den Kontakt zu ihnen zu halten. Auch deren Familien unterstützten sie. Regelmäßig traten sie jetzt in den Lazaretten der Stadt auf. In der zweiten Kriegshälfte fanden dann aber wieder vermehrt gesellige Veranstaltungen wie Ausflüge statt.
Während des Krieges gab es in Esslingen ein reges Konzertleben mit regelmäßigen Aufführungen der Vereine oder von Militärkapellen. Meist war damit ein wohltätiger Zweck beispielsweise zugunsten der „„Kriegshilfe“ oder der Verwundeten verbunden, die freien Eintritt erhielten. Aufgeführt wurde bei den „„Vaterländische Abenden“ in Esslingen vor allem Musik der klassischen Komponisten, aber auch von heute völlig vergessenen Künstlern. Sehr kriegerisch war die Programmauswahl aber nicht, wenn sich auch häufig der Krieg darin widerspiegelte. Im Vordergrund stand ganz eindeutig unterhaltende oder erhebende Literatur. Vor allem der „„Oratorienverein“ führte weiterhin die großen klassischen Chorwerke wie J. S. Bachs „„Johannespassion“ oder das Weihnachtsoratorium“ auf. Er brachte im Juni 1915 im Rahmen eines Gefallenengedenkens das „„Deutsche Requiem“ von J. Brahms zu Gehör. Dieses begleitete auch den Übergang zum Frieden. Kurz nach Abschluss des Waffenstillstandes wurde es am Totensonntag 1918 noch einmal aufgeführt.
Februar 2017 - Kriegsgefangenschaft: Briefe und Volkszählungsbogen
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Kriegsgefangenschaft: Briefe und Volkszählungsbogen
Papier, beschrieben
1917
(Stadtarchiv Esslingen, Bestand Flottenbund deutscher Frauen/Ortsgruppe Esslingen und Stadtschultheißenamt VII 1 Bü 22)

Der Brief eines deutschen Matrosen aus dem Kriegsgefangenenlager Handforth in England an die Esslinger Ortsgruppe des Flottenbunds deutscher Frauen und ein Volkszählungsbogen aus dem Stadtteil Mettingen von 1917, auf dem in der Spalte „Kriegsgefangene/Militärgefangene“ hinter „Maschinenfabrik“ die Zahl 140 eingetragen ist: Das sind zwei Hinweise auf Kriegsgefangene im Esslinger Stadtarchiv.
Während des Ersten Weltkrieges gerieten acht Millionen Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Sie ausreichend zu versorgen und angemessen unterzubringen, war für alle Kriegsparteien eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Es entstanden viele teilweise improvisierte, teilweise durchstrukturierte Lagerkomplexe, in denen die Gefangenen nach Nationalitäten, militärischem Rang oder Einsatzbereich (z.B. Arbeitslager) untergebracht waren.
Wie viele Männer aus Esslingen in Gefangenschaft gerieten, ist nicht bekannt. 11 in Gefangenenlagern gestorbene Soldaten führt das „Totenbuch“ von 1935 auf. Eine Liste aus Hegensberg vom Januar 1919 nennt acht noch in Lager lebende Soldaten. Über Briefe hielten die Esslinger Kontakt zu den gefangenen Männern, nicht nur zu eigenen Angehörigen. Auch fremde deutsche Kriegsgefangene wurden von zwei Esslinger Frauen-Organisationen mit Briefen und Paketen versorgt. Von der „Feldpoststelle“ des Nationalen Frauenvereins unter Rosa Schimpf in der Friedrichstraße 4 ging die Post seit 1917 fast ausschließlich an Kriegsgefangene. Deutschen Matrosen in britischen Lagern schickte die Esslinger Ortsgruppe des Flottenbundes deutscher Frauen Lebensmittel, Bücher und Geldspenden. Einer davon war Hermann Harke, Unterheizer auf dem U-Boot „U18“, der im Lager Handforth (bei Manchester) interniert war und am 3. Januar 1917 einen Dankesbrief nach Esslingen schrieb: „Eine große Freude bereitete mir Ihr soeben erhaltenes liebes Paket, nebst Karte. (…) Es war mit allem versehen, was sich das Herz eines Gefangenen wünscht.“ Die floskelhafte Formulierung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich viele Gefangene in schlechter seelischer Verfassung befanden. Die Monotonie des Lageralltags, die Ungewissheit, wann sie zurückkehren konnten und die oft starken körperlichen Strapazen durch schlechte Ernährung und Zwangsarbeit führten bei vielen zur so genannten „Stacheldrahtkrankheit“.
Wie ausländische Kriegsgefangene in Esslingen eingesetzt waren, ist ebenfalls kaum bekannt. So berichtete die Esslinger Zeitung 1915 über den Arbeitseinsatz von russischen Kriegsgefangenen beim Bau der Hohenkreuz-Kaserne oder von französischen Soldaten bei Arbeiten zur Landeswasserversorgung bei Rüdern. Erst die Bogen der Volkszählungen von 1916 und 1917 schaffen Klarheit über die Anzahl und über einige Unterbringungsorte von Kriegsgefangenen. 1916 sind 121 Militärgefangene aufgeführt, davon 118 in Mettingen bei der Maschinenfabrik Esslingen (ME), eine Person in Wäldenbronn und zwei in der Königlichen Hofdomäne Weil. 1917 stieg die Zahl auf 174 Kriegsgefangene, 26 waren auf einige Privatadressen in Esslingen verteilt, acht in der Hofdomäne Weil und weitere 140 Gefangene waren in der Rüstungsproduktion der Maschinenfabrik eingesetzt. Sie gehörten einem Arbeitskommando in Stuttgart an, wohnten aber auf dem Gelände der ME. Die Gefangenen waren begehrt, denn die deutsche Wirtschaft brauchte dringend Arbeitskräfte.
Über Versorgungs-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der Gefangenen in Esslingen wissen wir nichts. Aber sie ähnelten wohl in vielem anderen deutschen und württembergischen Lagern. So führte eine Hierarchie innerhalb der Kriegsgefangenen nach Nationalität zu ganz unterschiedlichen Lagerbedingungen. Engländer und Franzosen waren privilegiert, u.a. weil sie durch Hilfsorganisationen versorgt wurden, und ihre Regierungen großen Druck auf das Deutsche Reich ausübten. Italienische und russische Gefangene befanden sich ganz unten in der Hierarchie, zum einen weil den russischen Gefangenen eine kulturelle „Minderwertigkeit“ zugeschrieben wurde, aber auch weil sie keinerlei Unterstützung durch ihre Heimatländer hatten. Sie waren deshalb oftmals der Willkür und Misshandlung des Wachpersonals ausgesetzt. An die ausländischen Kriegsgefangenen erinnert heute in Esslingen nichts mehr.
Januar 2017 - Psychisch versehrte Soldaten: Krankenakte von Hermann H
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Psychisch versehrte Soldaten: Patientenakte von Hermann H.Papier, Karton33,3x22cm1916/17(Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Ludwigburg, F 235 II, Bü 6084)
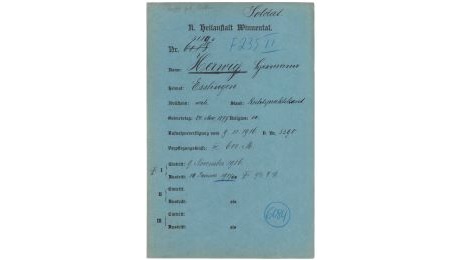
Die Spur zur dünnen Patientenakte von Hermann Herwig (1877-1917) aus der Königlichen Heilanstalt Winnental, aufbewahrt im Staatsarchiv Ludwigsburg, führt über zwei Orte in Esslingen: Sein Name findet sich sowohl auf der Bronzetafel an einer Seitenwand des Marktbrunnens, dem zentralen Kriegerdenkmal Esslingens, als auch auf der Tafel zum Gedenken an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Schüler im heutigen Georgii-Gymnasium. Hermann Herwig zog als Dreijähriger mit seiner Mutter Mathilde Herwig (geb. Böcklen aus Esslingen) nach dem Tod des Vaters aus Heilbronn nach Esslingen. Hier wohnte er in der Fabrikstraße 11 und besuchte das Esslinger Lyceum in der heutigen Abt-Fulrad-Straße. Nach seinem Abitur am Gymnasium in Bad Cannstatt 1895 machte er eine Ausbildung und arbeitete als Kaufmann und Rechtspraktikant. Infolge der Mobilmachung 1914 wurde er Soldat, und zwar beim Bayerischen Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 1, zunächst im Ersatzbataillon und dann als Vizefeldwebel Anfang Februar 1915 beim Feldregiment an der Westfront, wo er an Stellungskämpfen in der Champagne teilnahm. Ein Jahr später heiratete er in Augsburg.Auf dem Deckel der Krankenakte irritiert der Eintrag unter der Rubrik „Austritt“: „10. Januar 1917“, dahinter ein Kreuz, als Zeichen dafür, dass er in der Anstalt verstorben war. Herwig starb folglich während seines Soldatendienstes im „Hungerwinter“ 1916/17. Zwei Monate zuvor, am 9. November 1916 hatte ihn das Vereinslazarett I (Städtisches Krankenhaus an der Ebershalde) in Esslingen während eines Heimaturlaubs dorthin wegen einer psychischen Erkrankung überwiesen. Die Diagnose lautete „Dementia paralytica“, eine „spätsyphilitische chronische Entzündung des Nervengewebes mit dessen fortschreitender Zerstörung (Demenz)“. Bereits zwei Monate später starb Herwig an den Folgen eines schweren Lungenleidens („Pneumothorax“). Die Ärzte sahen keinen Zusammenhang zwischen seiner Erkrankung und den Umständen einer Verwundung, die er im Februar 1915 bei Stellungskämpfen in der Champagne erlitten hatte, wo er wohl auch verschüttet worden war. Vielmehr attestierte ihm ein Gutachter „eine besondere Veranlagung zu geistiger Störung.“ Eine Sichtweise, die während des Krieges viele zivile und Militärpsychiater bei der Beurteilung der rund 313 000 psychisch erkrankten Soldaten beim Feldheer teilten: Die Ursachen der massenhaften psychischen Erkrankungen von Soldaten wurden nicht in den unerträglichen Strapazen des Fronterlebens gesehen. Die so genannten „Kriegszitterer“ wurden als Simulanten, Deserteure und „Querulierer“ abqualifiziert. Da die Symptome als „Flucht in die Krankheit“ beurteilt wurden, reagierten die Psychiater oft mit entsprechend harten „Therapien“, die von militärischem Drill über wochenlange Isolierung des Patienten bis hin zu extrem schmerzhaften Behandlungen mit elektrischen Stromstößen reichten. Ob in Winnental solche Methoden angewandt wurden, ist nicht bekannt. Zu den Umständen von Herwigs Tod schrieb der Gutachter: „Der Tod ist durch die Geisteskrankheit nur mittelbar verursacht worden, wäre durch sie aber binnen weniger Jahre mit Sicherheit bewirkt worden.“ Dabei ignorierte er völlig, dass der körperliche Verfall, den Herwig in der Klinik erlitten hatte, mit den untragbaren Versorgungszuständen in der Einrichtung zu tun hatte. Ärzte und Pfleger waren eingezogen worden, so dass sich teilweise nur 30-50 % des Vorkriegspersonals, darunter auch ungelernte Kräfte, und nur 2-3 Ärzte um die rund 650 Patienten kümmerten. Es fehlte an Lebensmitteln, Medikamenten, Verbandsmaterialien und Kleidung. Wegen des Kohlenmangels konnte kaum geheizt werden, und die Patienten wurden nicht mehr regelmäßig warm gewaschen. Herwig hatte innerhalb von zwei Monaten von 58 kg auf 45 kg (bei einer Größe von 1,65 m) abgenommen. Hinzu kam, dass seine körperliche Erkrankung, eine starke Erkältung, nicht behandelt wurde, so dass diese schließlich zum Tode führte. Damit war Herwig einer von geschätzten 70 000 bis 140 000 Patienten, die während des Ersten Weltkriegs in deutschen Psychiatrien aufgrund mangelhafter Versorgung und Verwahrlosung verstarben. Da der Krieg nicht als Verursacher der psychischen Erkrankungen eingestuft wurde, erhielt seine Ehefrau auch keine Kriegerwitwenrente.
Dezember 2016 - Glaube im Krieg: Bibel des Soldaten Heinrich Prinz
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Glaube im Krieg: Bibel des Soldaten Heinrich Prinz
1916
(Privatbesitz)

Die kleine schwarze Taschenbibel – sie misst gerade einmal 14x9,5x2,5 cm – zeigt deutliche Gebrauchsspuren. Ihr Besitzer, der Soldat Heinrich Prinz (1897-1987), hat sie während des Krieges und seiner Kriegsgefangenschaft stets bei sich getragen. Zu ihrem Schutz hat er für sie aus einer alten Militärdecke mit groben Stichen eine Hülle genäht.
Schlägt man die bei der Württembergischen Bibelanstalt in Stuttgart gedruckte 1196seitige Bibel auf, so findet man auf dem Vorsatzblatt eine Widmung: „Meinem lieben Neffen Heinrich Prinz zu seinem Geburtstage. 24.Dez. 1916 Lina Brensing“. Prinz hat handschriftlich „in Laon Frkrch.“ hinzugefügt und unter der Widmung, wahrscheinlich nach dem Krieg, unter der Überschrift „Du hast mich begleitet“ einige Lebensstationen während des Krieges und danach eingetragen. Vom Kriegseinsatz des jungen Soldaten, gebürtig und aufgewachsen in Dieringhausen bei Gummersbach, sind durch diesen Eintrag und durch Familienerzählungen einige wenige Stationen bekannt.
Nach seiner Lehre in einer Dampfkesselfabrik in Gummersbach meldete sich Heinrich Prinz freiwillig. Nachdem er dreimal aus gesundheitlichen Gründen zurückgewiesen worden war, wurde er Anfang 1916 dann doch zum Kriegsdienst einberufen. Er überlebte die Schlacht um Verdun und kämpfte ab Ende 1916 in der Nähe von Laon (nördlich von Reims), wo er am 16. April 1917 während der Kämpfe um die Craonner Höhen in französische Gefangenschaft geriet. Schwer verletzt gelangte er über Zwischenstationen im August in ein Kriegsgefangenenlager in dem kleinen Ort Poterie aux Perches im Süden der Normandie. Ab Anfang 1919 war er in verschiedenen Lagern und Strafkompagnien bei Verdun, die er als“Hungerschlucht und Jammertal“ beschreibt. Erst Anfang März 1920, fast 16 Monate nach Kriegsende, kehrte er nach Dieringhausen zurück.
Er studierte ab 1920 Schiffsmaschinenbau in Hamburg, nach 1924 in Karlsruhe, wo er auch das Abitur nachholte. Danach konstruierte er Motor- und Segelflugzeuge und wurde 1935 als Professor für Flugzeugbau an die Maschinenbauschule in Esslingen berufen, wo er bis zu seiner Pensionierung 1960 lehrte.
Wie Heinrich Prinz hatten viele Soldaten kleine Taschenbibeln im Marschgepäck, als sie in den Krieg zogen. Sie wurden wegen ihrer Größe auch „Senfkornbibeln“ genannt, nach der Stelle im Markus-Evangelium 4,31: „Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Samen, die auf der Erde sind“. Bei katholischen Soldaten hingegen sind meist Gebetbücher belegt. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges stellten die beiden Kirchen zunächst eine steigende Frömmigkeit unter den Kriegsteilnehmern fest. Doch je länger der Krieg dauerte, desto mehr wandten die Soldaten sich von den kirchlichen Angeboten ab. Denn statt Trost und Erbauung zu finden, sahen sie sich mit kirchlichen Durchhalteparolen konfrontiert. Dies erschütterte ihren Glauben keineswegs. Aber sie suchten nun Schutz bei ihrem „persönlichen Gott“. Gerade die immer wiederkehrende Erfahrung, eine Schlacht überlebt zu haben, stärkte sie im Glauben an die göttliche Schicksalsmacht. Glauben und Beten halfen ihnen durchzuhalten. Sie bildeten aber auch ein wichtiges Verbindungsband zwischen ihnen und den Angehörigen in der Heimat. So forderten viele Kriegsteilnehmer ihre Angehörigen in Briefen auf, für sie zu beten. Im Gegenzug versicherten die Daheimgebliebenen ihren Soldaten an der Front, dass ihr intensives Gebet sie beschützen würde. Im gemeinsamen Gebet konnte die räumliche Distanz zumindest vorübergehend aufgehoben werden. Mit ihrem Geschenk für Heinrich Prinz schuf seine Tante, die auch „Soldatentante“ genannt wurde, ein starkes Bindeglied zwischen ihm und der Familie in der Heimat.
Welche Bedeutung die Taschenbibel für Heinrich Prinz hatte, darauf verweist sein Eintrag „Du hast mich begleitet“, der deutlich macht, wie wichtig für ihn die Bibel als tägliche Begleiterin in Not, Angst und Gefahr war. In der Familie wird zudem berichtet, dass er glaubte, „ein gütiges Geschick“ habe ihn vor dem Tod bewahrt. Seine „Kraftquellen“ während Krieg und Gefangenschaft seien „der eiserne Wille zum Durchhalten und seine Dünndruckbibel“ gewesen.
November 2016 - Trügerische Idylle im Krieg: Gemälde von Albert Heim
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Trügerische Idylle im Krieg: Gemälde von Albert HeimTinte, Aquarell und Gouache1916(Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, M 660/260 Nr. 4)

Am 19. Januar 2013 widmete die britische Tageszeitung The Times dem gebürtigen Esslinger Künstler Albert Heim (1890-1960) eine fast ganzseitige Reportage. In dem Beitrag ging es um 62 Aquarelle und Gouachen, die Heim zwischen 1915 und 1917 als deutscher Soldat in Nordfrankreich und Flandern gemalt hatte. Die Bilder werfen einen ganz und gar ungewohnten Blick auf das Kriegsgeschehen. Sie brechen mit den stereotypen Mustern militärischer Selbstinszenierung und überraschen mit einer unbeschwert-persönlichen, ja geradezu schelmischen Note.
Albert Heim, der am 27. April 1890 als Sohn eines Esslinger Buchbinders geboren worden war, absolvierte seit 1904 die Ausbildung zum Lithographen. Die ersten Berufsjahre verbrachte er in seiner Heimatstadt, ehe er von 1910 bis 1914 als Retuscheur in einer Buchdruckerei in Stuttgart arbeitete. Gleich zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurde er Soldat bei der 51. Reserve-Infanterie-Brigade, die unter dem Kommando des Generalleutnants Theodor von Wundt (1858-1929) zunächst im Elsass, dann weiter nordwestlich in der Picardie zum Einsatz kam. Bereits Anfang 1915 übernahm er die Aufgabe eines Militärzeichners.
Nach Kriegsende besuchte er die Stuttgarter Kunstgewerbeschule und machte sich als selbständiger Graphiker einen Namen. In der Öffentlichkeit erzielte er mit seinen ausdrucksstarken und zugleich liebenswürdigen Karikaturen und werbegraphischen Arbeiten große Aufmerksamkeit. Davon zeugen viele preisgekrönte Plakat- und Markenentwürfe, darunter auch Reklame für die Esslinger Traditionsmarke „Kessler Sekt“. 1927 übersiedelte er mit seiner Familie nach Berlin, wo er sich der Gestaltung von Plakaten, Verpackungen, Briefköpfen und Etiketten widmete sowie eine Vielzahl von Illustrationen für Bücher und Zeitschriften fertigte. Er starb 1960 in Berlin.
Den Anstoß zu der bemerkenswerten Bilderfolge aus der Zeit des Ersten Weltkrieges hatte Heims Kommandeur, der württembergische Generalleutnant Theodor von Wundt, gegeben. Der ranghohe Offizier befehligte die aus rund 6.500 Mann bestehende 51. Reserve-Infanterie-Brigade, die seit Herbst 1914 zu Stellungskämpfen im Artois und der Picardie eingesetzt war. Wundt war ein erfahrener, tatkräftiger Soldat, der „durch seine heitere, urwüchsige und kraftvolle Art (…) in der Truppe überaus beliebt“ war, so Wundts Nachruf und Todesanzeige, 1929. Ungeachtet der unbestreitbaren Verdienste, die er während des Krieges erworben hatte, „erregte seine offenherzige Sprache“ unter der preußischen Generalität „Aufsehen“. Auf Weisung Kaiser Wilhelms II. musste das schwäbische Original im August 1917 seinen Dienst quittieren. Man warf Wundt vor, er habe „es im Verkehr mit der Truppe an der nötigen Rücksicht auf die Form fehlen lassen“.
Doch ohne seine fast freundschaftliche Protektion wären Albert Heims farbenfrohe Aquarelle und Gouachen wohl nie entstanden. Mit feinem Sinn für Ironie und Groteske vermitteln sie einen Eindruck vom täglichen Leben in Wundts Quartieren in Courcelette und Miraumont. Sie zeichnen eine fast ländliche Idylle, dokumentieren humorvoll das kameradschaftliche Miteinander und karikieren den General ebenso wie seinen Stab: beim Kartenspiel, bei „Höhlenfesten“, beim Sonnenbad, beim Kontakt mit Literaten, ja sogar beim „Friedenstraum“. Es ist die trügerische Ruhe vor dem Sturm, der im Juli 1916 mit der Somme-Schlacht furchtbare Ausmaße annahm und schließlich fast eine Million Tote und Verwundete forderte.
Im Nachlass von Wundts Sohn Rolf befanden sich auch Albert Heims unkonventionelle Kriegsbilder. In Großbritannien erregten sie 2013 bei einer Auktion ein lebhaftes Interesse. Das Hauptstaatsarchiv Stuttgart konnte einige exemplarische Stücke erwerben, darunter auch das Objekt des Monats November 2016. Es zeigt Generalleutnant von Wundt, der Pfeife rauchend und entspannt auf einer blühenden Frühlingswiese liegt. Im Hintergrund sieht man das idyllische Dorf Miraumont in der Picardie, das schon bald in der Somme-Schlacht in eine Trümmerwüste verwandelt sein wird.
sei.
Oktober 2016 - Ersatzstoffe: Zwei Briefchen mit Streumehlproben
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Ersatzstoffe: Zwei Briefchen Streuhmehlproben
Papier, Mehl, Zellulose1915-1918(Stadtarchiv Esslingen, Bestand nationaler Frauendienst)

Die beiden kleinen, unscheinbaren Papierbriefchen, von Hand beschriftet mit den Worten „Früchtestreumehl“ und „Holzstreumehl“, wurden im Stadtarchiv Esslingen in den Akten des Nationalen Frauendienstes aus dem Ersten Weltkrieg gefunden. Sie enthalten 1,28 und 1,54 Gramm einer pulvrigen, braunen, leicht faserigen Substanz. Untersuchungen unter dem Rastermikroskop durch Prof. Dr. Winfried Linxweiler von der Hochschule Esslingen ergaben, dass es sich tatsächlich um Streumehle handelt.
Streumehle sind, so Mercks Warenlexikon aus dem Jahr 1920, „Backhilfsmittel, die neuerdings an Stelle des Brotmehles zum Bestreuen der Brotlaibe und der Backschüsseln benutzt werden, um das Ankleben des Teiges auf der Unterlage zu verhindern. Sie bestehen in der Regel aus technisch reinem Holz-, Stroh-, Spelz-, Schilf- oder Steinnußmehl, während ein Zusatz von Gips, Kreide oder anderen Mineralstoffen unzulässig ist. Die St. dürfen nur an der Oberfläche des Gebäcks haften, das Einkneten in den Teig hat als Verfälschung zu gelten.“ Streumehl war zwar keine Erfindung des Ersten Weltkriegs, hatte jedoch als Ersatz für Brotgetreide während des Krieges Konjunktur. Auch wenn nur eine geringe Menge, etwa 10 Gramm, Streumehl für ein Kilo Brot genutzt wurde, konnte man doch diese Menge Brotgetreidemehl sparen und statt 100 Brote 101 Laibe backen. Dies war nicht unerheblich angesichts der sich stetig verschlechternden Ernährungslage während des Krieges.
Besonders betroffen von der Suche nach Ersatz bzw. den Versuchen, Lebensmittel zu strecken, war der Bereich der Mehl- und Brotherstellung. Denn bereits im ersten Kriegsjahr gingen die Weizenimporte aus dem Ausland extrem zurück. Den Kommunen wurde die Zuständigkeit übertragen, für die Verteilung der vom Reich zugewiesenen Lebensmittel zu sorgen. Die Stadt Esslingen richtete hierfür im Neuen Rathaus Ende 1914 das „Städtische Mehlamt“ ein, das Ende 1916 in „Städtisches Lebensmittelamt“ umbenannt wurde, da sich mittlerweile die staatliche Zwangsbewirtschaftung auf fast alle Nahrungsmittel erstreckte.
Brot war Grundnahrungsmittel Nummer 1. Lag der tägliche Getreidekonsum vor Beginn des Krieges bei circa 340 Gramm pro Kopf, so wurde dieser stetig bis auf eine Tagesration von 170 Gramm im April 1917 reduziert. Um aus dem Getreide möglichst viel Ertrag zu erhalten, wurden die so genannten Ausmahlsätze bis auf über 94 % erhöht. Je höher der Ausmahlungsgrad, desto mehr Kornbestandteile wie z.B. der Spelzen sind enthalten.
Die Bevölkerung, die helleres Brot gewohnt war, erhielt schon bald nach Kriegsbeginn nur noch Schwarzbrot und das mit verschiedenen Mehlen aus Kartoffeln und Reis gestreckte „K-Brot“ oder „Kriegsbrot“. Ein Verfahren, Mehl durch andere Stoffe, z.B. Kartoffelmehl zu ersetzen, hatte in den 1840er Jahren als einer der ersten Julius Eugen Schlossberger erforscht. Eine dauerhafte Lösung war das Strecken mit anderen Lebensmitteln jedoch nicht, fehlte es dann doch noch an den zugesetzten Produkten wie Kartoffeln.
Das gestreckte Brot war oftmals schwerer zu verdauen und schmeckte unangenehm säuerlich. Als die Esslinger im Frühjahr 1917 häufig und deutlich ihren Unmut über den abscheulichen Geschmack des Brotes äußerten, berief die Esslinger Bäckerinnung eine Versammlung der Bäckermeister ein, um „Mittel und Wege zu finden, wie aus dem Mehl mit 94 prozentiger Ausmahlung ein genießbares Brot hergestellt werden könne“. Ein schwieriges Unterfangen – nicht zuletzt deshalb, weil einige geschäftstüchtige Bäcker und Müller immer wieder billige Streumehle in größeren Mengen unter das Brotgetreidemehl und den Teig mischten. Am 14. Juli 1916 warnte deshalb die Eßlinger Zeitung unter der Überschrift „Mehlverfälschung“ vor diesem Missbrauch: „Durch die Zusätze wird das Mehl sowohl in seinem Nährwert als auch in seinem Genußwert verschlechtert, also verfälscht. Dieser Unfug ist umso unzulässiger, als die Bevölkerung gerade in der gegenwärtigen Zeit, wo ihr das Mehl durch behördliche Maßregeln zur Verfügung gestellt werden muß, in besonderem Maße berechtigt ist, als Brot eine Ware zu erhalten, die frei von geringwertigen Zusätzen der genannten Art ist.“
September 2016 - Millionen für den Krieg: Kriegsanleiheplakat von Karl Sigrist
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Millionen für den Krieg: Kriegsanleiheplakat von Karl Sigrist
„Zeichnet Kriegsanleihe“Plakat für die 8. KriegsanleiheEntwurf Karl Sigrist1918(Stadtarchiv Esslingen )

Kriegführen kostet Geld. Mit Hilfe von Kriegsanleihen wollte das Deutsche Kaiserreich den Ersten Weltkrieg finanzieren. Etwa 98 Milliarden Reichsmark kamen mit Hilfe von neun Kriegsanleihen zwischen 1914 und 1918 zusammen. Jeweils im Frühjahr und Herbst war die Bevölkerung, die sich aus allen sozialen Schichten beteiligte, aufgerufen, Anleihen zu zeichnen. In der Stadt und im Oberamt Esslingen wurden um die 45 Millionen Reichsmark zusammengetragen. Anschläge an öffentlichen Gebäuden und Anzeigen in der Presse informierten in den ersten Kriegsjahren mit langen Texten die Menschen über die vielfältigen Vorteile des Kriegsanleihekaufs und verwiesen zugleich auf die moralische Pflicht der Menschen, mit ihrem Geld zum Gelingen des Krieges beizutragen. Für das Bewerben der Kriegsanleihen war die Reichsbank zuständig, die von Einrichtungen wie der Deutschen Bank unterstützt wurde. Auch die Eßlinger Zeitung druckte viele Artikel und Aufrufe zum Thema Kriegsanleihe ab. So hieß es beispielsweise am 15. September 1916: „Die Kriegsanleihe ist die beste und sicherste Kapitalsanlage! Die Steuerkraft des ganzen deutschen Volkes, das Vermögen sämtlicher Bundesstaaten sowie des Reiches selbst haften für Sie!“. Die Zeichnungsbereitschaft der Bevölkerung war zunächst groß, war das Vertrauen in den Staat und das deutsche Militär sowie die Bereitschaft, seinen Beitrag zum Krieg zu leisten, hoch. Doch im Laufe des Krieges, vor allem im Jahr 1916, als an der Westfront, in Verdun und an der Somme, Millionen Soldaten starben oder verwundet wurden, und ein schneller Sieg sich nicht abzeichnete, sanken die Anleihekäufe. Der Staat setzte deshalb auf eine offensivere Propaganda, um die Menschen zu mobilisieren, und wechselte auch bei der Werbung für Kriegsanleihen die Strategie: Mit Hilfe von eindrücklichen Bildplakaten und prägnanten Slogans sollte die Bereitschaft der Bevölkerung zum Unterzeichnen der Kriegsanleihe wieder angekurbelt werden. Die Bilder sollten die Inhalte dabei noch direkter transportieren und auf vorübergehende Betrachter von Litfaßsäulen wirken. Das Bildplakat trat zunehmend an die Stelle des Schriftplakats. Erstmals wurde anlässlich der 6. Kriegsanleihe ein Wettbewerb ausgerufen. Zwölf Künstler wurden eingeladen, die Jury wählte jedoch keinen von ihnen, sondern entschied sich für das Portrait eines Soldaten von Fritz Erler (1868-1940), Kriegsmaler und Graphiker. Die Darstellung des Frontkämpfers mit Stahlhelm wurde in Deutschland zu einer Bildikone. Aufgrund seiner großen Popularität und anlässlich seines 70. Geburtstages wurde auch Paul von Hindenburg ein wichtiges Motiv der Bildplakate. Für die 8. Kriegsanleihe im Frühjahr 1918 rief der Verein der Plakatfreunde einen Wettbewerb aus. Sechs der 1512 Entwürfe wurden schließlich als Plakat von der Reichsbank veröffentlicht. Darunter auch die Farblithographie des Stuttgarter Lithographen und Malers Karl Sigrist (1885-1986), der bei diesem Wettbewerb den zweiten Platz erzielte. Plakate gestalten gehörte neben dem Illustrieren von Büchern zu seinem Alltagsgeschäft. Das Plakat besticht durch seinen einfachen und zugleich ausdrucksstarken Bildaufbau: Der Adler steht als Greifvogel nicht nur für Kampf, sondern ist auch im Wappen des Deutschen Kaiserreiches vertreten und somit eines der wichtigsten nationalen Symbole. Die Taube mit einem Zweig im Schnabel verkörpert das biblische Symbol für Frieden und Hoffnung. Der am unteren Rand stehende Titel „Zeichnet Kriegsanleihe“ fordert den Betrachter auf, seinen Beitrag zu leisten und suggeriert in diesem Bildzusammenhang, dass eine hohe Beteiligung den Frieden beschleunigen könnte. Hintergrund des Plakats war auch die Situation an der Westfront im Frühjahr 1918: Hier sollte mit der Michaeloffensive die letzte große, für Deutschland siegreiche Schlacht des Krieges geschlagen werden. Hierfür galt es, die kriegsmüde Bevölkerung an der Heimatfront und die Soldaten nochmals zu mobilisieren. Das Plakat spielte folglich auch mit der Hoffnung der Bevölkerung, dass nach dieser Schlacht endlich Frieden sei.
August 2016 - Schützengrabenkrieg an der Heimatfront: Modellbogen
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Schützengrabenkrieg an der „Heimatfront“: Modellbogen des Verlag J. F. Schreiber
1915; nachgebaut 2016
Maße: 3x79,5x42cm
(Original im Besitz des Landesmuseums Württemberg, Stuttgart )
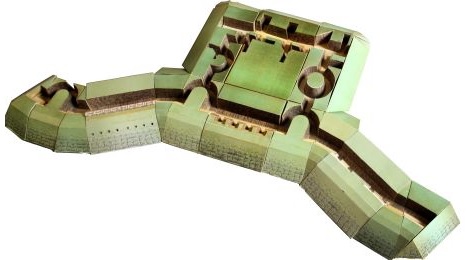
„So darfst du die Geduld nicht verlieren, wenn es dir nicht immer gleich gelingen sollte, hübsch ordnungsmäßig Grabenstück an Grabenstück zu fügen. Das wäre ein schlechter Soldat, der, was er sich zum Ziel gesetzt, nicht zum guten Ende führen wollte. Und ein guter Soldat willst du doch gewiss auch mal später werden! Also was Hänschen in geduldiger Arbeit mit Schreibers Modellierbogen jetzt schon übt, braucht künftig Hans als großer Soldat nicht mehr lernen“, so das Begleitheft zum Schützengraben-Modell aus dem Esslinger Verlag J. F. Schreiber aus dem Jahr 1915. Bereits dieses Zitat macht deutlich, dass der Schützengraben mehr als ein Spielzeug war. Er fungierte zugleich als Propagandamedium, um den Menschen an der „Heimatfront“ ein bestimmtes Bild der neuartigen Kampfweise des Schützengrabenkriegs zu vermitteln, der seit Herbst 1914 die Westfront prägte. Und das Spiel mit dem Modell sollte die Jungen für den Krieg begeistern und auf ihre Rolle als Soldat vorbereiten.
Dabei betonte der Hersteller die „Naturtreue“ des Modells im Maßstab 1:100. In Modul-Bauweise konnten aus 12 farbigen Ausschneidebogen „Schützengräben mit Unterständen“ auf verschiedene Art und Weise zusammengesetzt werden, um sie – wie an der „echten“ Front – an die Gegebenheiten anpassen zu können. Zahlreiche Details des Modells wie Mannschafts- und Offiziersunterstände, an denen kleine Schildchen wie „zum fröhlichen Feldgrauen“ oder „zum lustigen Blindgänger“ angebracht waren, sollten den realistischen Eindruck ebenso verstärken wie die Verwendung militärischer Fachausdrücke in der Aufbauanleitung: Sie verwies auf Schützennischen mit Schießscharten, den „Prügelbodenbelag“, die mit „Faschinen“ verkleideten Wände sowie einen Erdklotz als „Kugelfang“.
Weitere Kartonmodellbogen mit verschiedenen Front- und Etappenszenerien konnten hinzugekauft werden: Ein Feldlager mit Mannschafts-, Offiziers- und Sanitätszelt, ein Bogen „Moderne Festungswerke mit Panzertürmen“, eine „Küstenbefestigung mit Hafen, Torpedobooten und Unterseeboot“ sowie eine „Kriegsflotte mit Ergänzungsbogen“. Hinzu kam noch ein Bausatz „Flugapparat“, mit dem sich aus Pappe oder Sperrholz ein Ein- oder Doppeldecker für den Luftkrieg bauen ließ.
In den Beiheften zu den Modellen finden sich Spielanregungen, wie diese zusammen mit Spielzeugsoldaten und –waffen eingesetzt werden konnten. Das hier propagierte Spiel mit kriegerischen Szenarien war keineswegs neu, nur zwischenzeitlich an den modernen Krieg angepasst: Hatten vorher Jungen mit Zinnrittern um Modellburgen gekämpft, so konnten sie jetzt den aktuellen Krieg nachspielen. Dabei war das Spiel jedoch von echten Kämpfen inspiriert, von denen die Presse oder die Väter und Brüder berichteten. Dieser Aktualitätsbezug und dass kein Phantasie-, sondern ein realer Krieg der Bezugspunkt war, machte den Reiz der Modellbogen aus.
Die Miniaturisierung des Krieges verwandelte diesen in ein Spiel und reduzierte seine Komplexität auf ein paar wenige, überschaubare Szenen, in denen Freund und Feind, Gut und Böse leicht zu unterscheiden und die Kriegsmaschinerie kontrollierbar war. Diesen Eindruck sollten auch die so genannten Schauschützengräben in Originalgröße vermitteln, die Mitglieder der Jugendwehr oder Ersatz-Regimenter zwischen 1915 und Anfang 1917 auf öffentlichen Plätzen an der „Heimatfront“ errichteten.
Wie die Kartonmodelle enthielten sie wesentliche Elemente eines echten Schützengrabens wie Laufgräben, verschiedene Unterstände, Verbandsräume, sogar aus Fässern nachgebaute Geschützattrappen. In Esslingen hatte die Jugendwehr im März 1915 auf dem Spielplatz hinter der Burg einen solchen Graben ausgehoben, um militärische Übungen durchzuführen. Zudem war er für die Bevölkerung geöffnet, die sich dort von der Sicherheit der Anlage überzeugen sollte, indem sie für kurze Zeit in die Rolle des Frontsoldaten schlüpfen konnte. Ein Journalist der Esslinger Zeitung schrieb am 29. März 1915: „Man bekommt aber auch einen Begriff davon, was unsere Soldaten leisten müssen mit dieser Maulwurfsarbeit.“ Um den realistischen Eindruck zu verstärken, schickte man an manchen Orten wie in Heidelberg sogar Kriegsgefangene in die Gräben, die dort den „Angreifer“ spielen mussten.
Für die zweite Hälfte des Krieges sind keine solchen Errichtungen mehr überliefert, auch die Produktion von Kriegsspielzeug wurde weitgehend eingestellt. Anscheinend erfüllten die idealisierten Darstellungen der Schützengräben in Groß und Klein ihren propagandistischen Auftrag nicht mehr. Angesichts der Kriegsrealität der Massenschlachten an der Westfront mit hunderttausenden von Toten ist dies nicht erstaunlich.
Juli 2016 - Studenten an der Front: Durchschossenes Couleurband
52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Studenten an der Front: Durchschossenes Couleurband
1913
Seidenrips, Metallfaden
(Privatbesitz)

Für die Studenten, die aus dem städtischen Bildungs- und Besitzbürgertum stammten, sich Ihrer Rolle als Elite der Nation sehr bewusst waren und die dieses Elitebewusstsein in unterschiedlicher Ausprägung in studentischen Korporationen pflegten, war der Beginn des Ersten Weltkrieges ein großer Rausch. Endlich bot sich die ersehnte Möglichkeit, durch das Kriegserlebnis zum Manne zu werden und zu beweisen, dass man bereit war, für das „Vaterland“ sein „Opfer“ bringen.
Auch der in Esslingen geborene Eugen Wagner (1892-1968) meldete sich bei Kriegsbeginn – wie ein Drittel der Tübinger Studenten – freiwillig. Wagner, der dem Familienzweig Christian Wagner der bekannten Esslinger Gewerbefamilie entstammte, hatte nach seiner Kupferschmiedelehre 1913 in Tübingen das Studium der Evangelischen Theologie begonnen. Er trat in die evangelische Studentenverbindung Normannia ein, die größte Tübinger Verbindung. Diese war stark württembergisch geprägt, nicht schlagend, politisch neutral und farbentragend. Das wichtigste Erkennungszeichen der Verbindung war und ist bis heute das Seidenripsband in den Farben Rot-Gold-Weiß, das man von der rechten Schulter quer über die Brust und den Rücken zur linken Taille trägt.
Während des Krieges war das Tragen des Bandes mehr als ein Zugehörigkeitssymbol. Es machte den „Krieg zur persönlichen Herzensangelegenheit. Das Band verbürgte die selbst gestellten Anforderungen an Pflichterfüllung und Opferbereitschaft und machte sie gleichzeitig nach außen sichtbar. Es war das Erkennungszeichen einer elitären Gruppe gegen die oft beschworene Schützengrabengemeinschaft“, so der Studentenhistoriker Jens Griesbach.
Auch Eugen Wagner, der am 13. September nach fünf Wochen Ausbildung mit der 8. Kompanie der 125er ins Feld ausrückte, trug sein Band unter der Uniform. Bereits am 30. Oktober passierte es dann bei der kleinen westflandrischen Stadt Messines/Mesen: Eugen Wagner wurde durch zwei Gewehrschüsse in Hals und Rücken verwundet. Der Schuss in den Rücken muss knapp links vom Rückgrat vorbeigegangen sein und hat das Burschenband durchschossen. Das blutverschmierte Band mit dem Riss nahe dem unteren Ende kündet von dieser lebensgefährlichen Verwundung.
Nach sechs Wochen im Feldlazarett wurde er ins Vereinslazarett I (Krankenhaus in der Ebershaldenstraße) nach Esslingen verlegt, wo er seine spätere Frau Anna Wagner kennenlernte, die hier als Krankenschwester Dienst tat. Im März 1915 wurde er als genesen entlassen. Innerhalb des Sommers 1915 qualifizierte er sich in einem Offizierslehrgang zum Leutnant und kämpfte danach bis Februar 1917 mit dem Landwehr-Infanterieregiment 121 im Oberelsaß, in Lothringen und an der Ostfront, in Wolhynien im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet. Im Januar 1919 wurde er in Mergentheim demobilisiert. Wagner hat das Studium nicht wieder aufgenommen, sondern ist in den väterlichen Betrieb eingetreten, wo er nach dem Tod des Vaters 1933 diesem als Firmenchef nachgefolgt ist. Mit seinem Schwager Hanskarl Riedel leitete er die mittlerweile längst als industriell zu bezeichnende Firma bis in die späten 1960er Jahre.
Sein durchschossenes Burschenband hat Eugen Wagner mit weiteren Memorabilien des Krieges, darunter die Erkennungsmarken und diverse Orden sowie seine Frackkette in einer großen runden Schachtel aufbewahrt.
Durchschossene Memorabilien der Kriegsgeschichte gab es schon vorher. Eine der berühmtesten Geschichten ist die von Friedrich dem Großen, der in der für ihn desaströsen Schlacht bei Kunersdorf im August 1759 von einer Kugel getroffen wurde, die jedoch an seiner Tabaksdose abprallte. Solche Erinnerungsstücke sind etwas anderes als Orden, Dokumente oder Beutestücke. Sie zeigen vor allem, wie nahe der Tod war. Sie erzählen vom schwachen, verwundbaren Menschen. Man sieht hinter ihnen keine Helden, zum Glück auch keine Toten, aber immer Opfer, die dem Tode sehr nahe waren.
Für denjenigen, der sie getragen hat, sind sie in ihrer Bedeutung ebenfalls schwer zu erklären. Eugen Wagners Band ist nur subjektiv und damit letztlich nur von ihm selbst zu verstehen. Aber gerade deswegen ist es, in seiner Mischung von Gedenken und Andenken, so eindrücklich. Der industrialisierte Zermürbungskrieg hatte auch den so begeisterten jungen Männern wie Eugen Wagner die Zufälligkeit des eigenen Überlebens vor Augen geführt.
Juni 2016 - Militär in Esslingen: Soldaten und Kasernen
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Militär in Esslingen: Soldaten und Kasernen
Postkarten verschiedener Hersteller, 1914 - 1918
Papier, bedruckt und beschrieben
Maße: 9x14cm
(Privatbesitz, Stadtarchiv Esslingen, Postkartensammlung)

Mit der Mobilmachung am 2. August 1914 veränderte sich schlagartig das Leben in Esslingen in fast allen denkbaren Bereichen. Ein wesentlicher Aspekt war die nun auch hier an der „Heimatfront“ vorherrschende Allgegenwärtigkeit des Militärischen in seinen diversen Erscheinungsformen. Als Belege dieser Umkodierung dienen fotografische Zeugnisse, vor allem Postkarten, die noch heute vorhandene oder zwischenzeitlich niedergelegte Gebäude in Esslingen während des Ersten Weltkrieges zeigen. Darunter befinden sich sowohl zeitweise umgenutzte zivile als auch genuin militärische Bauten. Ergänzend lassen die typischen Gruppenfotos von Soldaten vor städtischen Kulissen erahnen, wie omnipräsent Militärangehörige im Stadtbild gewesen sind.
Als der Krieg ausbrach, besaß Esslingen - im Gegensatz zu anderen Städten vergleichbarer Größe - noch keinen Kasernenbau. Zwar war nach langjährigen Bemühungen 1913 beschlossen worden, eine Infanteriekaserne zu errichten und die Stadt hatte dem württembergischen Kriegsministerium als Bauherren einen zuvor vom Freiherren von Palm erworbenen Bauplatz in Hohenkreuz zur Verfügung gestellt, mit den Bauarbeiten war aber erst im Mai 1914 begonnen worden.
Mit dem Kriegsausbruch strömten auf einen Schlag Tausende von Zivilisten, Freiwilligen, Reservisten, Ersatzreservisten, Landwehr- und Landsturmmännern nach Esslingen, um im Bezirkskommando an der Entengrabenstraße erfasst, den jeweiligen militärischen Einheiten zugewiesen, eingekleidet, verpflegt und in die Garnisonen bzw. an die Front verlegt zu werden. In kürzester Zeit entwickelte sich eine militärische Infrastruktur, in der insbesondere die Schulgebäude als Quartiere für die Soldaten eine wichtige Rolle spielten.
Im weiteren Verlauf des Krieges waren in Esslingen dann vor allem zwei Einheiten präsent: Die Angehörigen des dem Esslinger Landsturmbezirk zugeordneten Landsturmbataillons XIII/8, die Ende Oktober 1914 an die Ostfront ausmarschierten. Die später rekrutierten Landsturmleute dieser Einheit, gestandene Männer von mindestens 39 Jahren, waren anfangs vornehmlich in Privatquartieren untergebracht, hatten dann aber in „Kugels Saal“ an der Bahnhofstraße ihr so genanntes „Massenquartier“.

Vor allem beherbergte Esslingen aber ab April 1915 das Ersatz-Bataillon - also die personelle Reserve - des Reserve-Infanterie-Regiments 246, dessen Kommandatur, aber auch Mannschaftsunterkünfte sich zunächst in Gebäuden der ehemaligen „Württembergischen Holzmanufaktur, vormals Bayer & Leibfried“ in Oberesslingen befanden. Weitere Behelfskasernen waren u.a. die Turnhalle der Oberesslinger Schule sowie in Esslingen die neu erbaute Schule in der Pliensauvorstadt, die 1869 erbaute Schelztorturnhalle und der Saal des Gasthofs „Traube“ unweit der Frauenkirche. Mit der Fertigstellung und dem Bezug der allen damaligen Funktionalitätskriterien entsprechenden Kaserne in Hohenkreuz im Juli 1916 - ab ca. 1935 „Becelaere-Kaserne“, heute Wohnanlage „Palmscher Park,“ - wurden die meisten der umgenutzten Unterkünfte aufgelöst.
Zu erwähnen ist noch eine zweite wichtige Gruppe von militärisch genutzten Gebäuden, deren Bewohner ab 1914 keine Zivilisten, sondern Soldaten waren: die vier vom Roten Kreuz betriebenen „Vereins-Lazarette“. Sie waren beim Städtischen Krankenhaus, im so genannten „Mädchenheim“ der Firma Merkel & Kienlin, in der Turnhalle des Lehrerseminars und auch im 1913 feierlich eingeweihten Israelitischen Waisenhaus eingerichtet.
Die Umnutzung vorhandener Gebäude zu militärischen bzw. mit der Verwaltung oder den Folgen des Krieges in Verbindung stehenden Einrichtungen war ein Signum des Krieges an der „Heimatfront“. Desgleichen prägten nun in einem zuvor unbekannten Ausmaß die Soldaten, Offiziere, Unteroffiziere oder Mannschaften, ob in Esslingen registriert, stationiert oder wohnhaft, gesund oder verwundet, unterschiedlichen Einheiten und Verwendungen zugeordnet, das Bild der Stadt. Und stellt man dazu die tief greifenden ökonomischen und kulturellen Auswirkungen dieser Entwicklung in Rechnung, kann man die substanzielle Veränderung einer Stadt wie Esslingen im Krieg ermessen.
Mai 2016 - "Schwert aus der Scheide": Kriegsgedichte von Isolde Kurz
52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg
"Schwert aus der Scheide": Kriegsgedichte von Isolde Kurz
Eugen Salzer Verlag, Heilbronn1916
Maße: 15,5x10cm
(Stadtarchiv Esslingen, Bibliothek 11216)

Schwert aus der Scheide!
In der Halle des Hauses da hängt ein Schwert,
Schwert in der Scheide.
In seinem Blitzen vergeht die Erd‘.
Wir hüten‘s und beten Tag und Nacht,
Daß es nicht klirrend von selbst erwacht.
Denn uns ist geschrieben ein heilges Gebot:
Ihr sollt es nur brauchen in letzter Not,
Schwert in der Scheide!
Wir sind geduldig wie Starke sind,
Schwert in der Scheide.
Wir achten‘s nicht, was der Neid uns spinnt.
Sie haben uns manchen Tort getan,
Wir litten‘s und hielten den Atem an.
Die Sonne glüht auf der Ernte Gold.
Friede, wie bist du so hold, so hold,
Schwert in der Scheide!
Doch der Neid mißgönnt uns den Platz am Licht,
Schwert in der Scheide!
Feinde umzieh‘n uns wie Wolken dicht.
Zehn gegen Einen in Waffenschein!
Wer bleibt uns treu? – Unser Gott allein.
Die Erde zuckt und der Himmel flammt.
Schwert, nun tu dein heiliges Amt!
Schwert aus der Scheide!
Isolde Kurz
Mit dem Gedicht „Schwert aus der Scheide“ vom August 1914, das 1916 in dem gleichnamigen Gedichtband erschien, reihte sich die Schriftstellerin Isolde Kurz in die Gruppe der Literaten ein, die damals zu Hunderten den Beginn des Krieges begrüßten und verklärten. Das knapp 100-seitige Bändchen erschien 1916 im Eugen Salzer Verlag in Heilbronn in einer Auflage von 10 000 Exemplaren. Den Einband ziert eine Zeichnung des Graphikers Karl Sigrist (1885-1986) in Goldprägung, die den Heiligen Georg zu Pferd zeigt, der ein Schwert über seinem Kopf schwingt und mit einem unter ihm liegenden Drachen kämpft. „Schwert aus der Scheide“ blieb Isolde Kurz erfolgreichster Gedichtband.
Isolde Kurz, geboren 1853 in Stuttgart, gestorben 1944 in Tübingen, war über Jahrzehnte hinweg eine Erfolgsschriftstellerin von europäischem Format. Über dreißig Jahre lang lebte die Tochter des schwäbischen Erzählers Hermann Kurz, die einen Teil ihrer Kindheit in Oberesslingen verbrachte, in Florenz. Und dennoch vereinte sie in sich die widersprüchlichen Tendenzen eines gelebten Kosmopolitismus und eines propagierten Nationalkonservatismus. Bei Kriegsbeginn nutzte sie ihr Talent und ihre Prominenz für öffentliche Stellungnahmen zum Weltgeschehen. Sie schrieb völkisch-patriotische Gedichte, die in Zeitungen, als Postkarten oder Feldpostbeigaben massenweise nachgedruckt wurden. Ohne Frage genoss es die Autorin, die sich zeitlebens als Außenseiterin gefühlt hatte, nun endlich Teil eines großen Ganzen zu sein.
Mit ihrer Euphorie zu Beginn des Ersten Weltkriegs ist Isolde Kurz ein typisches Beispiel für die Haltung vieler deutscher Schriftsteller, darunter rund 80 Autorinnen. Zwischen August und November 1914 verzeichnete der Buchhandel 7000 Neuerscheinungen zum Thema Krieg, allein im Laufe des August 1914 wurden etwa 3000 Kriegsgedichte in deutschen Zeitungen abgedruckt. Die vorherrschenden Themen waren Vaterlandsliebe und Feindeshass, und zwar in zum Teil erstaunlicher Primitivität und Aggressivität. Dies wandelte sich erst mit dem Verlauf des Krieges und den katastrophalen Schlachten an der Westfront 1916. Viele Autorinnen verstummten völlig, und immer mehr kriegskritische Stimmen wurden laut.
Der Band Schwert aus der Scheide beschreibt einen Bogen, der von anfänglicher Begeisterung und Zuversicht über die Klage um Gefallene hin zum Leiden und Erdulden führt. Von „Sieg“ ist nur in den ersten Gedichten die Rede. Es folgen Gedichte, die Verluste und Niederlagen, den Tod populärer Kriegshelden wie auch das massenhafte Soldatensterben zu verklären versuchen. Das letzte Wort des Buches heißt nicht etwa „siegt“, sondern „stirbt“. Der Band ist also keine Sammlung der erfolgreichsten Kriegsgedichte von Isolde Kurz, sondern eine absichtsvolle Komposition, deren Abfolge die Euphorie des Anfangs wieder relativiert.
Nicht wenige Gedichte des Bandes entstanden als Auftragswerke. Auch das Titelgedicht „Schwert aus der Scheide!“ sei, so Isolde Kurz in ihrer Autobiographie, nicht aus eigenem Ansporn, sondern auf die Bitte ihres Lieblingsneffen hin entstanden, der ihr gesagt habe, „die deutsche Jugend erwarte von mir ein Lied“. In der kriegsverherrlichenden Rezeption fühlte sich die Autorin jedoch missverstanden.
Die scheinbar kunstlos schlichten Verse kommen im Charakter einer volksliedhaften Ballade daher. Der wirkmächtigste Gegensatz im Gedicht ist der von Stillstand und Bewegung: Die Gedichtstrophen geben eine nahezu statische Zustandsbeschreibung, bis auf einmal mit einem maximalen Ausschlag des Bewegungspendels die „Erde zuckt und der Himmel flammt“. Auf gekonnte Weise bietet Isolde Kurz hier also die Illustration des beliebten Bildes vom Kriegs-„Ausbruch“, als handle es sich um eine kosmische Erscheinung. Die gern behauptete Passivität der Deutschen bleibt bis in den Schlussvers hinein bestehen: „Schwert aus der Scheide!“ heißt der Ausruf, unter Auslassung des Verbs – der Refrain hat kein Subjekt, niemand ergreift das Schwert. Das Gedicht beschreibt kein Handeln, sondern ein Geschehen, das von selbst abrollt.
Und genau deshalb stimmt Isolde Kurz’ beschönigende Selbstinterpretation nicht, man habe über dem Kriegsaufruf die fünfmalige Bitte um Frieden – „Schwert in der Scheide“ – überhört. Denn das Gedicht läuft in seiner gesamten Konstruktion auf den finalen Ausruf „Schwert aus der Scheide!“ hinaus. Dieser gibt schließlich auch den Titel des Gedichts und des ganzes Bandes ab. Der Effekt ihres Gedichts liegt darin, dass „es“ trotz der angeblichen Bitte um Frieden doch unvermeidlich geschieht, dass der Krieg wie von selbst beginnt. Das ist die Pointe ihres so scheinheilig schlicht daherkommenden Kunstwerks oder, aus heutiger Sicht, seine Perfidie.
April 2016 - Kopfschutz und Kriegssymbol: der Stahlhelm
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Kopfschutz und Kriegssymbol: der Stahlhelm
Stahlhelmglocke, Metallwarenfabrik F. W. Quist, 1916/1917
Chromnickelstahl, lackiert
Maße: Höhe 17cm, Breite 31,5cm, Tiefe 24cm, Gewicht 1038g
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 005369)

Der Erste Weltkrieg brachte mit dem massenhaften Einsatz von Artilleriegeschossen eine starke Zunahme tödlicher Kopfverletzungen mit sich. Daher führten nach und nach alle kriegführenden Staaten Helme aus Metall für ihre Soldaten ein, die bis dahin Kopfbedeckungen trugen, die eher gegen Wind und Wetter schützten als gegen feindlichen Beschuss. Nachdem die Kriegsgegner bereits seit Anfang 1915 Helme für ihre Soldaten erprobt und eingeführt hatten, wurde in Deutschland ab September 1915 ebenfalls an der Entwicklung eines Helmes gearbeitet.
Diese Aufgabe übernahm Professor Friedrich Schwerd von der Technischen Hochschule in Hannover, der, angeregt durch den Mediziner Professor August Bier, einen Helm entwarf, der die Soldaten vor Geschossen aber auch kleinsten Granatsplittern schützen sollte. Gerade letztere hatten häufig eine besonders verheerende Wirkung. Das Ziel war der optimale Schutz von Kopf- und Nackenbereich und das Ergebnis prägte die deutsche Stahlhelmform bis zum Zweiten Weltkrieg. Bereits nach wenigen Wochen wurden im Dezember 1915 Erprobungsversuche an der Front durchgeführt und im Frühjahr 1916 bei der Schlacht von Verdun die ersten 30.000 Helme an die Truppen verteilt. Insgesamt wurden bis 1918 7,5 Millionen Stahlhelme an das Heer geliefert.
Nur 12 Firmen waren anfangs in der Lage, das aufwändige Herstellungsverfahren durchzuführen. Vermutlich 1916 kam die Metallwarenfabrik F. W. Quist aus Esslingen hinzu. Ihr Inhaber Fritz Quist erhielt 1917 das Wilhelmskreuz – nach einer Firmenchronik aufgrund seiner „Verdienste in der Stahlhelmproduktion“. Bis 1914 hatte die Firma versilberte Metallwaren für den gehobenen Bedarf hergestellt.
Wie viele andere metallverarbeitende Firmen war Quist bei Kriegsbeginn aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen durch Transportprobleme, Arbeitskräfte- und Rohstoffmangel und den Wegfall des Absatzmarktes im Ausland gezwungen, von Friedens- auf Rüstungsproduktion umzustellen. So sollte der Betrieb der Firma aufrechterhalten und verhindert werden, dass Facharbeiter an andere Firmen oder als Soldaten abgegeben werden mussten. Neben Stahlhelmen stellte die Firma auch anderes Heeresgerät und Munitionsteile her. Mit zunehmender Dauer des Krieges entwickelte sich für diesen Industriezweig sogar ein „Kriegsboom“.
Dank der vorhandenen Erfahrungen im Bereich der Metallverarbeitung konnte die Herstellung der Stahlhelmrohlinge in sieben Pressgängen mit mehreren Zwischenhärtungen zur Zufriedenheit der bei den Herstellerfirmen angesiedelten Abnahmekommandos durchgeführt werden. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg stellte Quist neben seinen Hauptprodukten aus versilbertem Metall Stahlhelme für in- und ausländische Abnehmer her.
Der M 16 – wie der deutsche Stahlhelm in seiner ersten Herstellungsvariante offiziell genannt wurde – verlieh den Soldaten ein kriegerisches und archaisches Aussehen. Er entwickelte noch während des Krieges einen hohen Symbolgehalt und stand für den Frontkämpfer, der dem „Stahlgewitter“ der Schlacht trotzte. Damit wurde der M 16 zum Symbol des deutschen Weltkriegskämpfers schlechthin und häufig für propagandistische Zwecke und Illustrationen auf Kriegsanleihen verwendet. Mit ihm verband man „Durchhaltewillen“ und „ungebrochenen Kampfgeist“, Zeitgenossen bezeichneten ihn als „geschmiedete[n] Trotz“.
Nach Kriegsende fand er sich auf Buchtiteln zu Weltkriegsbüchern und auf Kriegerdenkmälern als Symbol für den Opfertod der Soldaten. Namensgebend war er für den von Franz Seldte 1918 gegründeten gleichnamigen Frontkämpferbund, der mit ca. 500.000 Mitgliedern eine der größten paramilitärischen Massenorganisationen der Weimarer Republik wurde. Antidemokratisch und antirepublikanisch ausgerichtet zielte diese Vereinigung wie die Nationalsozialisten auf die Errichtung eines „neuen Reichs“.
Der 1935 eingeführte M 35 nahm bewusst die Form des M 16 auf und stellte damit die neu gegründete Wehrmacht in die Tradition der alten kaiserlichen, „im Felde unbesiegten“ Armee. Er wurde in den von Deutschland besetzten Ländern zum Sinnbild der nationalsozialistischen Eroberung Europas und gilt noch heute vielen Pazifisten als Symbol für deutschen Militarismus.
März 2016 - Der Postmichelbrunnen: Entwurfszeichnung von Emil Kiemlen
52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Der Postmichelbrunnen: Entwurfszeichnung von Emil Kiemlen
um 1913
Bleistift auf Papier 22 × 17 cm
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 002261)

Mit dem Postmichelbrunnen schuf der Stuttgarter Bildhauer Emil Kiemlen (1869-1956) ein bis heute populäres Denkmal für die wohl bekannteste Esslinger Sagengestalt, den angeblich 1494 einem Justizmord zum Opfer gefallenen Postreiter Michael Banhard. Dabei war die Geschichte nicht sehr alt. 1845 hatte sie der Eltinger Pfarrer Wilhelm Friedrich Munder in der „Stuttgarter Stadtglocke“ publiziert. Doch die erfundene Legende verbreitete sich rasch und der Postmichel avancierte zu einem Identifikationsobjekt reichsstädtischer Historie.
Am 12. April 1916 wurde der neue Postmichelbrunnen eingeweiht, geplant wurde er jedoch bereits vor dem Krieg. Ermöglicht wurde die Finanzierung durch eine private, testamentarisch verfügte Stiftung der Stuttgarterin Anna Hecker, Gattin des Oberstaatsanwaltes a. D. Robert Hecker, zur „Erstellung eines monumentalen Brunnens“ im Jahr 1912. Noch im selben Jahr schrieb die Stadt einen begrenzten Wettbewerb unter vier Bildhauern aus. Unter den eingesandten 13 Modellen wurde im März 1914 das von Emil Kiemlen ausgewählt. Er hatte sich den Postmichel zum Thema genommen und damit ein in Esslingen ausgesprochen populäres Sujet gewählt. In vier Reliefs wird die tragische Geschichte vom unschuldig verurteilten Postreiter erzählt, der in Galvanobronze auf der Brunnensäule steht.Kiemlen war den Esslingern kein Unbekannter. Er hatte bereits das 1903 eingeweihte Denkmal für den Dichter Nikolaus Lenau geschaffen und war in der Stadt auch sonst mit Werken in Form von Bauplastik an Gebäuden gut vertreten. Erstaunlicherweise sind außer einer einzigen Bleistiftzeichnung, die offenbar den Ausführungsentwurf zeigt, keinerlei weiteren Entwürfe oder ein Modell für den Brunnen überliefert.Kiemlen stellt den Brunnen auf der Zeichnung fast genauso dar, wie er sich noch heute dem Auge des Betrachters darbietet. Der Anblick von Reiter und Relief ist vertraut – und doch stimmt etwas nicht. Denn in der Zeichnung steht der Reiter parallel zum darunter befindlichen Relief mit der Auffindung des Ringes durch den Postmichel. Eben diese Ausrichtung sollte zu ungeahnten Komplikationen führen.Als Fertigstellungstermin für den Brunnen war vertraglich der 31. März 1915 festgelegt worden. Und tatsächlich erscheint dieses Jahr am Kapitell der Brunnensäule. Doch verzögerte der Krieg die Aufstellung. Stadtbaurat Blümer bemerkte: „Wenn der Brunnen in Anbetracht des Krieges einige Wochen später fertiggestellt werden kann, so ist es eben in den augenblicklichen Verhältnissen begründet; ich halte dies für unerheblich!“ Doch erst im März 1916 konnte der Postmichelbrunnen errichtet werden. Aber die Empörung in der Bevölkerung war groß, als man feststellen musste, dass der Reiter aus Sicht der Bürger „falsch herum“ stand – und zwar genau wie in Kiemlens Zeichnung mit dem Rücken zur Ritterstraße. Sehr wahrscheinlich hatten sich die Arbeiter beim Aufbau an Kiemlens Entwurf orientiert. Die Bevölkerung war entsetzt und die Presse protestierte. Ein Leser forderte erbost: „„Kehrt! mit dem Gaul!“ Tatsächlich wurde die Figur schließlich um 90° mit Blickrichtung zur Ritterstraße gedreht, so dass er zur Einweihungsfeier „richtig herum“ stand – eine Schildbürgerposse mitten im Krieg. Dieser Krieg war bei der Einweihungsfeier durchaus präsent. So sorgte die Kapelle des Ersatzbataillons des Reserve-Infanterie-Regiments 246 für die musikalische Umrahmung. Oberbürgermeister von Mülberger betonte in seiner Rede, dass man dafür dankbar sein dürfe, „daß inmitten des schrecklichen Weltkriegs ein solches Friedenswerk vollendet werden konnte. Wer nicht draußen gewesen, habe keine Ahnung von dem Elend, das der Krieg mit sich bringe. Mancher werde später an diese Zeit zurückdenken und sagen: Es freut uns doch, daß wir unsern Postmichelbrunnen haben!“ Der Esslinger Historiker Paul Eberhardt hingegen meinte nur lakonisch: „Wie hätte sich der selige Sagenfabrikant Munder ins Fäustchen gelacht, wenn er das noch erlebt hätte.“
Februar 2016 - Krieg in Afrika: Erinnerungsstücke eines Esslinger Kolonialoffiziers
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Krieg in Afrika: Erinnerungsstücke eines Esslinger Kolonialoffiziers
1901-1920
Reisszahn, Zinn, Leder/Stahl, Fotografie; Länge Dolch: 37cm
(Privatbesitz)

Die deutsche Kolonie Kamerun war etwa doppelt so groß wie die heutige Bundesrepublik Deutschland. Dort lebten 1912 zwischen 4,1 Millionen Einheimischen 1.560 Deutsche. Erst 1885 war das Gebiet, wie man damals sagte, unter „deutschen Schutz“ gestellt worden. Die deutsche Beherrschung des Landes erschöpfte sich in Strafexpeditionen und Niederschlagung von Aufständen. Mitte der 1890er Jahre konnte die „Kaiserliche Schutztruppe für Kamerun“ den einheimischen Handel im Innern des Landes zu Gunsten deutscher Händler ausschalten. Die Truppe wurde bis auf 7.000 Mann aufgestockt. Es war schwer, dahin zu kommen: Jugend, Leistungsfähigkeit, Tropentauglichkeit und Intelligenz waren gefordert. Die Mannschafts-Dienstgrade waren so genannten Askaris, einheimische Söldner. Die Offiziere kamen aus Deutschland. Zu diesen gehörte Ernst von Raben, geboren 1877 in Schwäbisch Gmünd.
Sein Vater, Major Carl von Raben, war 1891-1899 Bezirksoffizier des Landwehrbezirks Esslingen. Vom Bezirkskommando wurden die Wehrpflichtigen einberufen, und hier war auch die Bezirks-Kleiderkammer. In Esslingen befand es sich bis 1906 an der Ecke Schelztor- und heutiger Kollwitzstraße, danach in der Entengrabenstraße.
Nach seiner Kadettenausbildung meldete sich Ernst von Raben 1901 zur Schutztruppe Kamerun. Ab 1910 war er stellvertretender Statthalter in Kusseri , ab 1913 in Mora im Norden des Landes. Als Hauptmann übernahm er im Mai 1914 die Führung der 3. Kompanie der Schutztruppe in Mora. Ihm unterstanden 204 Mann: 14 Europäer, der Rest Einheimische. Bis 1914 war von Raben sechsmal zwischen Deutschland und Kamerun hin- und hergereist. Dabei muss er die kolonialen Souvenirs mitgebracht haben: Das mit Sicherheit selbst erbeutete Löwenfell mit Kopf, von dem der Zahn abgebrochen ist. Außerdem zwei Becher mit Kameruner Szenen. Besonders spektakulär der so genannte Armdolch, den die westafrikanischen Krieger am linken Oberarm trugen.
1914 waren Briten und Franzosen aus den benachbarten Kolonien drei- bis vierfach überlegen, sodass der mit über 5.000 Mann größte Teil der Schutztruppe um die Jahreswende 1915/16 in die neutrale spanische Kolonie Río Muni (heute: Äquatorialguinea) floh. Nur die 3. Kompanie weit im Norden war völlig abgeschlossen. Ernst von Raben hatte im August 1914 eine Befestigung auf dem Berg Mora anlegen lassen. Ab Ende August griffen die Briten von den Nachbarhügeln an. Ein langfristiger Widerstand war mangels Nahrung, Medikamenten, Verbandszeug und militärischen Reserven wie z.B. Munition undenkbar.
Weitere britische und französische Angriffe mit Maschinengewehren und Artillerie im Herbst 1914 wurden abgewehrt und dazu genutzt Waffen und Munition zu erbeuten. Doch die Versorgung wurde immer schwieriger. 1915 erlebten die deutschen Truppen schwere Not. Erdnüsse mussten den Fettbedarf decken. Es gab keinen Kaffee, Tee, Zucker, Salz, Tabak und Alkohol. Verbandszeug und Medikamente fehlten, vor allem das zur Malariabehandlung notwendige Chinin. Mangelkrankheiten wie Skorbut oder Nachtblindheit griffen um sich.
Am 15. Februar 1916 teilte der britische General Cunliffe den Belagerten mit, dass die anderen deutschen Truppen sich nach Río Muni zurückgezogen hätten und bot eine ehrenvolle Kapitulation an. Von Raben ging angesichts der aussichtslosen Lage auf den Vorschlag ein und gab am 18. Februar 1916 auf.
Mit dem Abzug der letzten Deutschen endete die deutsche Kolonialzeit in Kamerun nach 31 Jahren. Das Land wurde 1919 zwischen Briten und Franzosen aufgeteilt.
Die Offiziere wurden in England interniert. Ernst von Raben kehrte 1916 über die Schweiz nach Deutschland zurück. Er erhielt 1919 seinen Abschied mit der persönlichen Erlaubnis zum Tragen seiner kaiserzeitlichen Kolonialuniform. Er starb am 8. Juni 1924
Die Kämpfe in den Kolonien zogen von Europa nur wenige Kräfte ab. Aber der Krieg hat Deutschland von seinen Kolonien befreit. Das kann man im Lichte der weiteren Entwicklung als eine glückliche Fügung betrachten.
Januar 2016 - Propaganda in der Vitrine: Patriotisches Porzellan
52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Propaganda in der Vitrine: Patriotisches Porzellan
1916
3 Schalen, 1 Wandteller
(Privatbesitz, Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 002325, STME 002326, STME 005555)

Als das Ehepaar Wilhelm und Berta Zeh sich 1916 während eines Fronturlaubs kirchlich trauen ließ, bekam es von der Verwandtschaft ein Porzellankörbchen geschenkt. Darauf abgebildet sind vier Männer-Porträts in Lorbeerkränzen, in Kreuzform angeordnet und flankiert von Fahnen sowie Sträußchen aus Eichenblättern und die Schriftzüge „AUS GROSSER ZEIT“ und „WELTKRIEG 1914-16“. Auch ohne zu wissen, dass es sich bei den Herren um Kaiser Wilhelm II. (l.), Kaiser Franz Joseph I. von Österreich-Ungarn (r.), Fürst und Zar Ferdinand I. von Bulgarien (o.) sowie den türkischen Kalifen und Sultan Mehmed V. Reçad (u.) handelt, die als Mittelmächte den Krieg gegen die Alliierten führten, ist die patriotische Botschaft des Geschenkes offensichtlich.
Es war ein typisches Geschenk, wie es zu dieser Zeit viele Hochzeitspaare, Kommunionkinder und Konfirmanden bekamen. Da es keine Gebrauchsspuren gibt, ist anzunehmen, dass die Eheleute das Körbchen, wie viele deutsche Bürger während des Krieges, als Kriegsandenken in ihre Wohnzimmervitrine gestellt haben. Zumal es sich nicht um billige Massenware, sondern aufgrund seiner aufwändigen Herstellung mit Durchbrucharbeiten um ein besonderes Sammlerstück handelt.
Andenken an den Krieg zu sammeln, war nichts Neues, sondern besonders im und nach dem deutsch-französischen Krieg und nach der Reichsgründung 1871 populär geworden. Nicht mehr nur die gesellschaftliche Oberschicht kaufte sich hochwertiges Geschirr mit patriotischen Motiven von großen Manufakturen wie Rosenthal oder der Großherzoglichen Majolika Manufaktur in Karlsruhe. Nun erreichten die Porzellanhersteller mit günstig produzierter Massenware, auf der die Bildnisse von Fürst Otto von Bismarck (1815-1898) oder Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) aufgemalt oder aufgedruckt waren, auch breite Bevölkerungsschichten.
Mit Beginn des Ersten Weltkriegs hatte die Produktion des patriotischen Porzellans, von den Kritikern auch „Kriegskitsch“ genannt, einen großen Aufschwung erhalten. Dabei verstand es die Keramikindustrie die patriotische und siegesgewisse Stimmung der Menschen zu nutzen. Sie produzierte Hunderttausende Gebrauchs- und Ziergegenstände mit hurra-patriotischen Motiven, wobei die Motivauswahl nicht „von oben“ angeordnet wurde. Die Hersteller waren selbst aktiv, suchten sich Künstler, die ihnen entsprechende Motive entwarfen, denen allen die national-patriotische Aussage gemeinsam war: „Wir Deutschen werden den Krieg ‚gegen eine Welt von Feinden‘ (Wilhelm II.) gewinnen.“
Eines der häufigsten Motive bildeten die Porträts der maßgeblichen Staatslenker wie Kaiser Wilhelm II. und von Kaiser Franz Joseph I. von Österreich-Ungarn (1830-1916). Populär waren auch ranghohe Militärs wie Generalfeldmarschall August von Mackensen (1849-1945), der U-Boot Kapitän Otto Weddigen (1882-1915) und vor allem Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg (1847-1934). Um den als „Russenschreck“ und „Retter Ostpreußens“ titulierte Hindenburg entstand eine Verehrung, die beinahe Kultcharakter erlangte.
Unter den Motiven, die als dekorative Elemente das Porzellan zierten, waren besonders das Eichenlaub (Macht und Treue), die Reichskriegsflagge und Ornamente in Schwarz-weiß-rot, der Lorbeerkranz (Sieg und Ruhm) und der Reichsadler (Stärke und Unbesiegbarkeit) beliebt. Vor allem das Eiserne Kreuz, die bekannteste Auszeichnung des Ersten Weltkriegs, fand großen Widerhall auf der Keramik.

Auch Szenen aus dem unmittelbaren Kriegsgeschehen wurden auf Porzellan verewigt. Auf Tellern der Porzellanmanufaktur Meißen waren Kriegsschiffe oder siegreiche Schlachten abgebildet. Es gab zudem Motive, die auf den Alltag der „Heimatfront“, der von zunehmendem Mangel geprägt war, Bezug nahmen. Besonders weit verbreitet war der Wächtersbacher Teller mit dem Dialektwortspiel „Besser ‚K‘ Brot als kaa Brot“ aus dem Jahr 1916. Mit „K-Brot“ war das Kriegsbrot oder auch Kartoffelbrot gemeint, das mit Kartoffel- und Maismehl gestreckt war. In Esslingen hing eine Ausgabe des Tellers, die ein gut genährtes Mädchen in Schwälmer Tracht mit zwei großen Broten unter den Armen zeigt, im Gasthaus „Froschwaid“ in der Urbanstraße 14 (Ecke Grabbrunnenstraße).
Angesichts der langen Dauer des Krieges und des zunehmenden Mangels machten sich Kriegsmüdigkeit und Hoffnungslosigkeit breit und der Absatz an patriotischem Porzellan ging zurück. Hinzu kamen die ständigen Engpässe in der Kohleversorgung, so dass im Laufe des Jahres 1917 viele Keramikmanufakturen die Produktion einstellen oder auf Produkte für die Rüstungsindustrie umsteigen mussten.
Dezember 2015 - Schule im Krieg: Weihnachtszeitungen der Esslinger Pennälerverbindungen
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Schule im Krieg:
Weihnachtszeitungen der Esslinger Pennälerverbindung
1915/1916
Maße 29x23cm
(Archiv des Georgii-Gymnasiums)

Mit dem studentischen Ruf „Burschen heraus!“ auf dem Titelblatt der Weihnachtszeitung von 1915 wurden die als „Burschen“ bezeichneten Oberprimaner des Esslinger Gymnasiums (heute Georgii-Gymnasium) aufgefordert, freiwillig in den Krieg zu ziehen. Die von Schülern gestalteten so genannten Weihnachts-, Kneip- bzw. Pennälerzeitungen – eine Art Vorläufer der heutigen Schüler- und Abizeitungen – geben in besonderer Weise Einblick in die Stimmungs- und Seelenlage der Esslinger Gymnasialschüler. Sie zeigen, wie der Krieg das Leben und Denken der Heranwachsenden zunehmend bestimmte. Zugleich lässt sich an den selbst verfassten Texten und Zeichnungen, die zumeist in einem humoristischen Ton gehalten sind, ablesen, dass mitten im Krieg die Freuden und Sorgen der Jugendlichen weiterhin von der Alltagswelt der Schule und Freizeit bestimmt wurden.
Die Pennälerzeitungen berichten vor allem „von der Primaner Taten und Sünden“. Und diese spielten sich in Esslingen und Umgebung ab, nicht im Schützengraben. Die kurzen Szenen und Gedichte handeln zumeist vom Schulalltag. Zahlreiche liebevoll gezeichnete Karikaturen von Lehrern und Mitschülern erinnern an die skurrilen Lehrer- und Schülertypen aus der „Feuerzangenbowle“, darunter auch Zeichnungen der umschwärmten Klassenkameradinnen Else Kienle und Lydia Treiber.
Ein beliebtes Thema waren die Folgen des in Gemeinschaft bei so genannten „Kneipen“ oftmals in großen Mengen genossenen Alkohols: „Grad aus dem „Palmschen“ komm ich raus, / Krumm sehn alle Häuser aus. / Und in meinem Kapitolium / Dreht sich alles rum und um!“, ist in der Pennälerzeitung von 1916 zu lesen. Auch während des Krieges trafen sich die Jugendlichen, die in der Pennälerverbindung des Gymnasiums waren, mehrmals im Jahr zu Kneipen und Feiern, an denen Schüler, Lehrer und Ehemalige, darunter zunehmend Soldaten, teilnahmen.
Jene, die noch nicht das wehrfähige Alter erreicht hatten, beteiligten sich begeistert an den örtlichen Kriegssammlungen, an patriotischen Veranstaltungen oder traten in die Jugendwehr ein. Auch wenn sich von dieser Kriegsrealität an der so genannten „Heimatfront“ wenig in den Pennälerzeitungen findet, zieht sich der Krieg wie ein roter Faden durch die Texte und Bilder – vor allem in Form von patriotischen, etwas schwülstigen Gedichten und Sprüchen. „Ruft um Hilf‘ das Vaterland / Frisch die Klingen dann zur Hand / Und heraus mit mutgem Sang / Wär es auch zum letzten Gang! / Burschen heraus!“, heißt es erneut in der Pennälerzeitung aus dem Jahr 1916.
Diesem Ruf waren auch viele angehende Abiturienten gefolgt. Um ihnen einen schnellen Eintritt ins Heer zu ermöglichen, konnten sie im August 1914 vorzeitig die Reifeprüfung ablegen. Zudem wurde eine so genannte „Notreifeprüfung“ eingeführt: ein Abitur unter erleichterten Voraussetzungen. Bereits am 9. August 1914 war der erste ehemalige Esslinger Gymnasiast gefallen, der aktive Leutnant des 8. Badischen Infanterie-Regiments Nr. 169, der zwanzigjährige Oberlehrerssohn Kurt Klotz.
Am Ende des Krieges waren unter den Kriegstoten rund 150 Schüler und drei Lehrer des Gymnasiums. Nimmt man noch die Schüler, die einstmals nur die beiden Klassen der Elementarschule besucht hatten und anschließend an andere Bildungseinrichtungen, insbesondere die Realanstalt (späteres Schelztorgymnasium), abgegangen waren, müsste man noch mindestens weitere 164 Kriegstote hinzuzählen.
Am 4. September 1921 wurde im Gymnasiumsgebäude schließlich ein Denkmal für die im Krieg gefallenen Lehrer und Schüler feierlich eingeweiht. Auf der noch heute im zweiten Stockwerk des Georgii-Gymnasiums hängenden Bronzetafel sind lediglich 66 Namen aufgeführt. Kurioserweise findet sich darunter ein vermeintlicher Gefallener, der bereits 1908 in die USA ausgewandert war.
November 2015 - Im "Vereinslazarettzug J": Das Tagebuch der Krankenschwester Anna Wagner
52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Im „Vereinslazarettzug J“: Das Tagebuch der Krankenschwester Anna Wagner
1915
14,5x8,5x0,5 cm
(Stadtarchiv Esslingen, Nachlass Haffner)

Schlägt man den unscheinbaren schwarzen Taschenkalender aus dem Jahr 1915 auf, so findet man auf der ersten Seite in feiner Handschrift mit schwarzer Tinte den Namen der Besitzerin „Anna Wagner“ eingetragen. Rote Stempelaufdrucke „Vereinslazarettzug ‚J‘“ und „1915/1916“ weisen auf Herkunft und Entstehungsjahr des Büchleins hin, das von der ersten bis zur letzten Seite eng beschrieben ist. Der erste Eintrag lautet: „20. Fahrt. Am 18. Mai Abfahrt nach Colmar. Unser kleines Zügle wurde an einem Militärzug angehängt. Das Einladen in Mülhausen ging bei den 3 Wagen natürlich schnell vor sich. Auf der Rückfahrt wurden wir an einen Güterzug angehängt u. fuhren mit öfterem Aufenthalt nach Freiburg. Dort mussten wir noch 2 Std. warten. Die Leichtverwundeten gingen an der Rampe auf u. ab, u. konnten sich so die Langeweile vertreiben, für die Schwerverwundeten aber war die Zeit recht lang. Die Fahrt ging durch Württemberg nach Augsburg, wo am [1]9. Mai vormittags alles ausgeladen wurde. Wir haben gleich geputzt, u. abends 6 Uhr fuhr ich mit dem Schnellzug nach Esslingen, um an Pfingsten daheim zu sein.“
In diesem eher protokollarischen Stil hat die aus der Esslinger Industriellenfamilie Wagner stammende Anna Wagner (1894-1934) ihre Fahrten mit dem Württembergischen „Vereinslazarettzug J“ zwischen 18. Mai und 5. Oktober 1915 festgehalten. Es gibt allerdings nur einen 5-monatigen Ausschnitt aus ihrer Dienstzeit als freiwillige Hilfskrankenschwester im Lazarettzug wieder, die vom 24. Oktober 1914 bis in das Frühjahr 1916 dauerte. Anna Wagners Aufzeichnungen, die sich im Stadtarchiv Esslingen erhalten haben, gewähren wenig Einblick in ihre Gefühle und intimen Gedanken. Sie sind vielmehr von der Frage angeleitet „Wann war ich mit wem an welchem Ort?“ und gleichen deshalb eher einem Reisetagebuch oder den dienstlichen „Kriegstagebüchern“, die von den Transportführern der Lazarettzüge geführt wurden.
Anna Wagners Entschluss, freiwillig für das Rote Kreuz zu arbeiten, scheint weniger von Patriotismus geleitet gewesen zu sein, als von Abenteuerlust und dem Wunsch aus der heimatlichen Enge herauszukommen und eigenes Geld zu verdienen. Deshalb tauschte sie wie Tausende junger Frauen aus adeligen und bürgerlichen Schichten das behütete Leben einer höheren Tochter gegen ein strapaziöses Leben in der Enge des Zuges und auf Güterbahnhöfen. Diese Frauen waren Grenzgängerinnen zwischen den gesellschaftlich festgelegten Sphären einer Frauen- und Männerwelt. Dabei kam ihnen zu Gute, dass sie die Tracht der Rotkreuz-Schwester trugen, die sie in ihrem alltäglichen Umgang mit Soldaten, Ärzten und Bahnhofsmitarbeitern unverdächtig machte.
Indem sie zwischen Front/Etappe und Heimat pendelten, brachten sie Geschichten über den Krieg in die Heimat. Durch sie erfuhren die Angehörigen in Esslingen das ein oder andere, was so nicht in der Zeitung stand. In ihrem Reisetagebuch spielt das Kriegsgeschehen eine eher geringe Rolle, über die Verwundeten schreibt Anna Wagner aus der professionellen Sicht einer Krankenschwester. Am liebsten schreibt sie über das Unterwegssein und über die Ausflüge ins Umland und in Städte. Denn wie viele ihrer Mitschwestern und Soldaten war sie durch den Krieg zum ersten Mal von zu Hause weggekommen. Das Reisen und das Leben auf den Güterbahnhöfen war für sie ein großes Abenteuer.
Die Routen des Lazarettzugs führten vom Hauptstandort auf dem Güterbahnhof in Freiburg im ersten Kriegsjahr zu den Aufnahmebahnhöfen in Colmar und Mühlhausen und danach in die Champagne. Von dort ging es zurück zu verschiedenen Heimatbahnhöfen in Bayern, Baden und Württemberg, wo Angehörige der freiwilligen Sanitätskolonne die Verwundeten ausluden und in die örtlichen Lazarette brachten. In Esslingen waren dies rund 6.100 Verwundete, die auf diesem Wege von der Front in die städtischen Lazarette gelangten.
Anna Wagner kehrte nach dem Krieg in ihr bürgerliches Leben zurück. Im April 1919 heiratete sie ihren Verlobten Erwin Haffner, Lehrer und Stadtarchivar in Esslingen, und bekam in den folgenden Jahren zwei Kinder. Der Krieg war also keineswegs ein „Schrittmacher der Emanzipation“ und hatte die Rollenbilder von Männern und Frauen langfristig nicht geändert. Allerdings, das zeigt zugleich das Beispiel Anna Wagner, eröffnete er im Persönlichen Freiräume und neue Handlungsmöglichkeiten, die ihr als Tochter aus dem Industriebürgertum verwehrt geblieben wären.
Oktober 2015 - Artillerie: 15cm-Luftminenwerfer M 15 System ME (Maschinenfabrik Esslingen)
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Artillerie: 15cm-Luftminenwerfer M15 System ME
(Maschinenfabrik Esslingen)
entwickelt 1915
Eisen, Holz, Leder,Messing, Stahl
Masse: 67X100X108 cm, 207 kg
(Deutsches Historisches Museum, Berlin, W59.3141)

Granat- und Minenwerfer gehörten zu den Waffen, die in diesem völlig neuen Krieg, der an der Westfront einer gigantischen Festungsbelagerung glich, massenhaft zum Einsatz kamen. In keinem Krieg zuvor wurden so viele Geschütze unterschiedlichen Kalibers eingesetzt; niemals zuvor gingen die meisten Verluste auf Kosten der Artillerie. 1914 waren in allen Armeen die leichten und die schweren Geschütze in eigenen Artillerieeinheiten zusammengefasst, die hinter der Frontlinie aufgestellt waren und zur Unterstützung der Infanterie feuerten.
Granat- oder Minenwerfer wiederum sollten als Steilfeuergeschütze bei Belagerungen von Festungen zum Einsatz kommen. Bald stellte sich heraus, dass Minenwerfer auch im Grabenkrieg geeignet waren, die Einsätze der Infanterie zu begleiten, denn es war nicht immer möglich, die Unterstützung der rückwärtigen Artillerie schnell genug anzufordern. Sie hatten zwar nur eine einfache Zieleinrichtung und eine relativ geringe Reichweite, konnten aber leichter von der Infanterie mitgeführt werden und ihre Bedienung setzte keine besonderen Kenntnisse voraus.
So stieg der Bedarf an Minenwerfern rasant an und löste in der Industrie eine Fülle von Entwicklungen aus. Auch die Maschinenfabrik Esslingen (ME), die vor dem Krieg keine Erfahrungen mit Rüstungsgütern hatte, entwickelte nach Anforderungen der deutschen Heeresleitung den 15cm-Pressluftminenwerfer M 15. Er war nur einer der vielen Heeresaufträge, die das Unternehmen mit Kriegsbeginn in Millionenhöhe erhielt und die schließlich die ME sanierten.
Dreh und Angelpunkt der Kriegsproduktion war das neue Werk in Mettingen. Vor allem die Gießerei war seit 1915 bis zum Letzten ausgelastet. Hunderte Mitarbeiter wurden eingestellt, darunter bis zu 30% Frauen, die die fehlenden Männer ersetzen sollten. Hunderttausende Mark wurden in Maschinen investiert, um die ungeheure Menge an Granaten, Minen, Kanonenrohren, Artilleriefahrzeugen, Spanischen Reitern und Luftminenwerfern überhaupt produzieren zu können.
Hauptauftraggeber für den 15cm-Luftminenwerfer M 15 war neben der deutschen Heeresleitung, die Anfang 1916 60 Stück sowie 17 100 passende Minen bestellte, die österreichisch-ungarische Armee, die 105 Werfer sowie 51 500 Minen in Auftrag gab. Dass man bei einer deutschen Firma bestellte, lag daran, dass die Industrie des k.u.k.Reiches nicht in der Lage war, den Bedarf der eigenen Armee an Minenwerfern zu befriedigen. Auf das Produkt der ME aufmerksam geworden war ein Offizier der Armee Österreich-Ungarns bei einer Vorführung der Waffe am 8. Juli 1915 auf dem Schießplatz Markendorf in Brandenburg. Nachdem das vorgeführte Modell nochmals überarbeitet wurde, ging es 1916 in Produktion.
Die Besonderheit des ME-Minenwerfers war sein Betrieb mit Pressluft. Während beim Abschuss eines herkömmlichen Minenwerfers Rauch und Abschussknall seinen Standort verrieten, entstanden beim Abfeuern mit Pressluft kein nennenswerter Knall und gar kein Rauch. Bei diesem „pneumatischen“ Werfer wurde die benötigte Kraft zum Abschuss der Mine durch Pressluft erzeugt, was ihn zu einer besonders tückischen Waffe machte. Der Gegner erhielt keine Warnung, dass gefeuert wurde. Er konnte auch nicht zurückschießen, da er nicht wusste wohin. Die Werfer selbst waren zudem relativ klein und leicht; sie konnten im Grabenkrieg einfacher mitgeführt werden als ein Feldgeschütz. Der Nachteil war die Störungsanfälligkeit der Ventile und vor allem die Notwendigkeit, stets schwere Pressluftflaschen mit sich zu führen.
Der „Pressluftminenwerfer System Maschinenfabrik“ Esslingen wurde deshalb über die ersten rund 150 Stück hinaus nicht weiter produziert, weil inzwischen von anderen Herstellern einfachere und weniger störanfällige Typen zur Verfügung standen.
September 2015 - Max von Mülberger: Oberbürgermeister im Kriegseinsatz
52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Max von Mülberger: Oberbürgermeister im Kriegseinsatz
1915/16
Ein Foto, zwei Schreiben, Siegelmarken in Dose
Stadtarchiv Esslingen, Nachlass Max von Mülberger, Fasz. 35 und 194/11)

Als letzter auf Lebenszeit gewählter Stadtschultheiß bzw. Oberbürgermeister in Esslingen hat Max von Mülberger (1859-1937) nicht weniger als eine „Ära“ (Otto Borst) geformt. Er gehört zu den prägendsten Persönlichkeiten der modernen Esslinger Stadtgeschichte: Nicht nur aufgrund seiner unerreicht langen Amtszeit von 38 Jahren, sondern auch wegen der großen Wandlungsintensität, der Esslingen in dem Zeitraum von 1891 bis 1929 unterworfen war und die Mülberger maßgeblich mitgestaltete, wenn nicht bestimmte.
Am Ende der Gemeinderatssitzung vom 26. Oktober 1914 verkündete von Mülberger, er sei „dem Rufe des Vaterlandes … gefolgt und [habe sich] als Offizier zur Verfügung gestellt“. Diese unerwartete Ankündigung verärgerte einige Mitglieder des Kollegiums und später auch zumindest Teile der Stadtbevölkerung, während andere Bürger vornehmlich Stolz angesichts dieses Entschlusses empfanden. Bis August 1916 blieb Mülberger in verschiedenen Verwendungen von seinen Esslinger Amtsgeschäften freigestellt. Seinen Platz als „Kriegsvorstand“ nahm sein Stellvertreter und späterer Ehrenbürger, Flaschnermeister Ernst Schwarz ein, als Leiter der zentralen „Armen-Deputation“ fungierte fortan der SPD-Gemeinderat Louis Schlegel.
Bereits am 27. Oktober 1914 rückte von Mülberger in das in Ludwigsburg neu aufgestellte „2. Landsturm-Infanterie-Bataillon XIII/9“ ein, wo er zum Führer der 2. Kompagnie erhoben wurde. Nach dem Abschluss der Grundausbildung und diversen Besuchen hochgestellter Persönlichkeiten am Garnisonsstandort wurde das Bataillon am 16. November 1914 in das Hinterland der zwischenzeitlich erstarrten Westfront verlegt. Dort war es vorrangig mit der Sicherung einer Bahnstrecke in der Gegend von Avesnes-sur-Helpe im französischen Département Pas-de-Calais, der Bewachung der Grenze zu Belgien, der Aufspürung von „Spionen“ und der Ausbeutung des besetzten Landes betraut. Bis zu seiner Abberufung im Sommer 1915 war der zwischenzeitlich zum Hauptmann beförderte und bei seinen Untergebenen offenbar sehr beliebte Mülberger - wie das gesamte Bataillon - in keinerlei Kampfhandlungen involviert; dies wird es ihm erleichtert haben, im Juni 1915 zur Wahrnehmung seines Mandats im württembergischen Landtag in die Heimat zu reisen.
Im Juli 1915 wechselte Mülberger vom württembergischen Heer zum General-Gouvernement Belgien mit Sitz in Brüssel, dem die militärische und zivile Verwaltung des besetzten Landes unterstand. Zeitlebens an Verkehrsfragen interessiert, leitete er dort die Abteilung „Zivil-Kraftwagenverkehr“, die u.a. den Transport von Gütern für die unter der deutschen Besatzung notleidende belgische Zivilbevölkerung überwachen und gewährleisten sollte. Der Nachlass Mülbergers im Stadtarchiv beinhaltet einige Dokumente, die belegen, dass der auf jedem gesellschaftlichen Parkett sichere Esslinger Oberbürgermeister in Brüssel auch am gesellschaftlichen Leben in der Hauptstadt teilnahm - und nebenbei offenbar auch zugunsten der Firma Kessler Wirtschaftsförderung betrieb.
Mit seiner Berufung zum „Kaiserlichen Kreischef“ des ca. 100 km östlich von Polen gelegenen Siedlce wechselte von Mülberger im März 1916 an die Ostfront, genauer in die Zivilverwaltung des General-Gouvernements Warschau im zuvor russischen, nun von deutschen Truppen besetzten sogenannte „Kongress-Polen“. Die wenigen diesbezüglichen Zeugnisse des Nachlasses verdeutlichen, wie fremd die dortige Welt und wie gewaltig die Aufgabe dort war: Mülberger war nun verantwortlich für ca. 90.000 polnische und jüdische Einwohner sowie Hunderte russische Kriegsflüchtlinge und sah sich, praktisch ohne funktionierenden Verwaltungsapparat, drängendsten Problemen gegenüber: Lebensmittelknappheit, Krankheiten wie Typhus, Pocken und Fleckfieber und einer weitgehend zusammengebrochenen Infrastruktur.
Bereits Mitte Juli 1916 stellte Max von Mülberger den Antrag auf Abberufung aus seinem Amt. Ab August 1916 wirkte er - mittlerweile hoch dekoriert - wieder als Oberbürgermeister von Esslingen am Neckar.
August 2015 - Flirt im Krieg: Zeitschriftenillustrationen von Brynolf Wennerberg
52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Flirt im Krieg: Farbige Zeitschriftenillustrationen von Brynolf Wennerberg 1914-1916
„In der Heimat in der Heimat… Kriegsbilder-Album“
Albert Langen Verlag, München, 1916
(Privatbesitz)
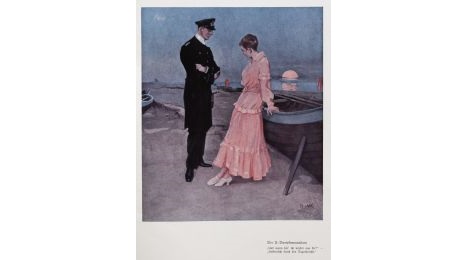
Die Publikation beinhaltet eine Sammlung von Illustrationen des Zeichners Brynolf Wennerberg, die bis auf eine Ausnahme auch in der Satirezeitschrift Simplicissimus zwischen 1914 und 1916 erschienen sind. Die satirische Wochenzeitschrift wurde von Albert Langen ins Leben gerufen und erschien von 1896 bis 1944. Sie zielte auf die Kritik von Bürgertum, Adel und Kirche ab und beschäftigte sich mit den innen- und außenpolitisch brisanten Themen der wilhelminischen Ära und der Weimarer Republik. Die Innenpolitik während des Nationalsozialismus blieb weitgehen unreflektiert. Belebungsversuche der Wochenzeitschrift nach 1945 scheiterten. Pfarrer Peter Schaal-Ahlers hat für das Projekt eine Ausgabe von Wennerbergs Kriegsbilder-Album aus seinem Familienbesitz zur Verfügung gestellt.
Wennerberg profitierte von den illustrierten Wochenzeitschriften, die sich der Themen Humor und Unterhaltung annahmen. Sie enthalten harmlose und lustige Karikaturen, Bilderabfolgen und Illustrationen. Viele Zeichner wurden für die Bilder in solchen Blättern benötigt. Auch Wennerbergs Graphiken, die im Simplicissimus veröffentlicht wurden, können als Karikaturen angesehen werden. Sie bedienen sich des Wechselspiels von Text und Bild, zeichnen humoristische, überspitzte Geschlechterbilder und besitzen einen Aktualitätsbezug. Wennerberg, 1866 in Schweden geboren und 1950 in Bad Aibling verstorben, besuchte die Kunstgewerbeschule in Stockholm und die Freien Studienschulen der Künstler in Kopenhagen. Anschließend arbeitete er als Illustrator vor allem in Deutschland für humoristische Blätter, als Gestalter von Postkarten und als Plakatkünstler in der Werbung.
Der Erste Weltkrieg wirkte sich auch auf das Verständnis der Geschlechter und ihrer medialen Repräsentation aus. Er war ein totaler Krieg, da die teilnehmenden Staaten sämtliche gesellschaftlichen und materiellen Ressourcen für ihre Kriegsführung beanspruchten und die endgültige Vernichtung ihrer Gegner anstrebten. Um die Kriegsziele zu erreichen, griffen Politik und Staat in alle Lebensbereiche ein. Das Ideal des starken und selbstbeherrschten Soldaten, der seine Nation verteidigt, wurde besonders in Propagandadarstellungen aufgegriffen und sollte das brutale Handeln im Krieg legitimieren. Der industrialisierte und entmenschlichte Krieg der Massen ließ dieses Bild jedoch bröckeln. Der Krieg war aber auch eng mit der weiblichen Zivilbevölkerung verknüpft, die sich an der Heimatfront für den Verlauf des Krieges einsetzte. Hier bediente sich die Kriegspropaganda eines neuen Frauenbildes, um die Frauen an der Heimatfront zu mobilisieren.
Wie hat nun Wennerberg Frauen und Männer dargestellt. Ein Beispiel soll Einblicke gewähren: Der Blick auf eine Illustration, die 1916 im Simplicissimus veröffentlicht wurde, verdeutlicht ein romantisches Motiv Wennerbergs. Es zeigt keine arbeitenden Frauen oder kriegsgebeutelten Militärs, sondern ein Paar fernab des Krieges. Der beigefügte Text weißt ihn als U-Boot-Kommandanten aus, was durch das Meer im Hintergrund unterstrichen wird. Durch die einsame Szenerie am Wasser mit der untergehenden Sonne spielt das Bild mit romantischen Attributen. Gleichzeitig ist diese Idylle nicht von Dauer und in den Worten beider schwingt der Erste Weltkrieg mit. Während sie sich um ihren Kavalier sorgt, „Und wann hör‘ ich wieder von dir?“, hofft er auf heroische Kriegstaten, „Hoffentlich durch den Tagesbericht“.
Wennerbergs Darstellung ist sehr stark idealisiert. Die schöne junge Frau sorgt sich um ihren Kavalier, während der attraktive und unversehrte U-Boot-Kommandant ein Kriegsheld werden möchte. Tod, Gewalt und Trauer sind in diesem Bild nicht auszumachen, dafür eine temporäre Szenerie des Glücks. Der U-Boot-Kommandant wird jedoch wieder in den Krieg ziehen und geht dabei von seiner ehrenvollen Pflichterfüllung aus.
Wennerbergs orientiert sich demnach an den konservativ bürgerlichen Klischees, wie sie schon seit dem 19. Jahrhundert zum Tragen kommen: Dem Mann kommt eine aktive und in der Öffentlichkeit agierende Rolle zu, während die Frau passiv in der Unsichtbarkeit ihres Haushalts angesiedelt wird. Dabei wird der Krieg als Mittel verwendet, um die Geschlechter in unterschiedlichen Sphären zu verorten und ihnen verschiedene Handlungen zukommen zu lassen. Neben solch romantischen Illustrationen, findet sich im Kriegsbilder-Album auch viel frivoler Humor. Die Graphiken verknüpfen auf humoristische Weise Krieg mit Anzüglichkeiten, aber erst die beigefügten Texte laden die harmlos scheinenden Bildszenerien doppeldeutig auf. Die erotische Spannung wird hier der Phantasie des Betrachters überlassen.
Juli 2015 - Jugend im Krieg: Fotografie des "Freiwilligen Korps Beutau"
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Jugend im Krieg: Fotografie des „Freiwilligen Korps Beutau“
Foto 28x39 cm, Rahmen 47x57,5 cm, 1915
Beschrifteter Fotoabzug in einem bemalten Holz-Gips-Rahmen.
(Privatbesitz)

In Uniform und Straßenanzug gekleidet, auf dem Kopf Militärmützen und Feuerwehrhelme, mit Säbel, Stöcken und Fahnen ausgestattet, blicken elf Jungen entschlossen in die Kamera. Einer von ihnen, der damals 15-jährige Eugen Mayer, der stolz einen Feuerwehrhelm mit Pickel trägt, hat die großformatige, aufwändig gerahmte Fotografie aufbewahrt.
Hinter dem „Freiwilligen Korps Beutau“, wie auf dem Schild zu lesen ist, verbarg sich keine militärische Jugendorganisation, sondern ein spontaner Zusammenschluss von Nachbarsjungen, die sich diesen Fantasie-Namen gaben. Sie wohnten alle in der Unteren Beutau im gleichnamigen Weingärtner-Stadtteil Esslingens. Sie alle einte, wie so viele Jugendliche zu dieser Zeit, „echte Begeisterung und heiße Liebe zum deutschen Vaterlande“, wie es am 19. Februar 1915 in der Esslinger Zeitung anlässlich einer Siegesfeier von Schulkindern hieß. Der Schriftzug auf dem Passepartout „Lieb Vaterland magst ruhig sein“, eine Zeile aus dem zu dieser Zeit populären Lied „Die Wacht am Rhein“, unterstreicht die patriotische Haltung der Jugendlichen. Er wurde, wie die Schrift auf dem kleinen Schild, nachträglich vom Fotografen Arthur Pfau aufgebracht, der in der Unteren Beutau 37 wohnte, wo die Aufnahme im Jahr 1915 entstand. Dahinter steckte zwar, wie im Zeitungskommentar, ein Gutteil Propaganda, doch gerade im ersten Kriegsjahr entfaltete die in Schulen, Vereinen, paramilitärischen Jugendorganisationen wie dem Jungdeutschlandbund und vielen Elternhäusern praktizierte militaristische Erziehung der Vorkriegszeit ihre Wirkung.
Die Reichsregierung nutzte die unter den Jugendlichen und in weiteren Bevölkerungskreisen wachsende Kriegsbegeisterung, um wenige Wochen nach Kriegsbeginn eine militärisch ausgerichtete Jugendorganisation zu schaffen. In Esslingen erging der erste Aufruf, dieser so genannten „Jugendwehr“ beizutreten, am 17. Oktober 1914. Offizielles Eintrittsalter war 16 Jahre, in Esslingen nahm man bereits Fünfzehnjährige auf.
Etwa 300 Jugendliche, aufgeteilt in drei Kompanien, die von Lehrern und Militärvereinsangehörigen geführt wurden, nahmen im ersten Kriegsjahr an den theoretischen und praktischen Übungen teil. In der Turnhalle am Schelztor, auf dem Spielplatz hinter der Burg und den Sirnauer Wiesen übten sie mehrmals wöchentlich Flaggenwinken, Brückenbau, Kartenlesen, Handgranatenwerfen, Zielen, Fechten und Scharfschießen. Wobei Letzteres den offiziellen Richtlinien der Jugendwehr widersprach, die ausdrücklich eine militärische Ausbildung ohne Waffen vorsahen. Doch in Esslingen umging man, wie in vielen deutschen Städten, mit Hilfe des Schützenvereins diese Anordnung. Denn das Schießen mit scharfer Munition war bei den Jugendlichen sehr beliebt und ein probates Mittel, um sie für die Jugendwehr zu gewinnen. Auch Abenteuer verheißende Aktivitäten, fern von der Kontrolle des Elternhauses, wie Tagestouren zum Truppenübungsplatz in Münsingen, oder das Anlegen einer großen Schützengrabenanlage hinter der Burg, zogen die Jugendlichen im ersten Kriegsjahr an.
Neben dem Bestreben des Staates, bereits Jugendliche gezielt auf den Krieg vorzubereiten, stand hinter der Gründung der Jugendwehr auch das politische Ziel, außerhalb der Schulen einen erzieherischen Zugriff auf die Jugendlichen zu bekommen. Im Fokus stand vor allem die Arbeiterjugend, die sich vielfach der staatlichen Kontrolle entzog. In Esslingen gelang zumindest im ersten Kriegsjahr, die Einbindung von rund 60 Lehrlingen und Auszubildenden in einer eigens für sie eingerichteten Kompanie unter Führung eines Meisters von Merkel & Kienlin. Danach flaute, wie überall im Deutschen Reich, die Begeisterung für die Jugendwehr ab. Das auf Dauer eintönige Programm, ständig wechselnde Leiter und die mit der Wirtschaftskrise zunehmende Alltagsbelastung, verleideten vielen Jugendlichen den zeitaufwändigen Einsatz in der Jugendwehr.
Von den Jungen aus der Beutau erfüllte, bis auf Eugen Mayer, keiner das Eintrittsalter für die Jugendwehr. Und so demonstrierten sie mit ihrer Fantasie-Organisation auf spielerische Weise ihren Stolz auf das „Vaterland“ und ihren Willen, etwas für den erhofften Sieg zu leisten. Für die meisten von ihnen wurde aus dem Kriegsspiel erst im Zweiten Weltkrieg Ernst.
Juni 2015 - Propaganda aus Esslingen: Das Bilderbuch "Heil und Sieg"
52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Propaganda aus Esslingen: Das Bildbuch "Heil und Sieg"
Bilderbuch von Marie Flatscher und Ludwig Morgenstern
Verlag J.F. Schreiber, Eßlingen und München, o.J. [Ende 1915 bis 1916]
22,5 x 30,5 cm, 1. Auflage: 4000
( J. F. Schreiber-Museum, JFS 000102)

Kriegsbilderbücher zählen zu den Besonderheiten des Ersten Weltkrieges, in England und Frankreich ebenso wie in Deutschland und Österreich. Sie weisen teilweise eine bemerkenswerte künstlerische Qualität auf.
Zwar wurden patriotisch-militaristische Botschaften schon im Kaiserreich des 19. Jahrhunderts sowohl in der Jugendliteratur als auch in spezifischen Kinderzeitschriften verbreitet. Auffällig mit Ausbruch des „großen Krieges“ ist jedoch die Erweiterung des Angebots um propagandistisch unterfütterte Bild-Textwerke schon für die Kleinsten, die keineswegs immer “von oben“ angeordnet war.
Wie viele solcher Titel bei dem 1831 gegründeten, durch seine Ausschneidebogen und Papiertheater bekannten Schreiber-Verlag insgesamt erschienen sind und in jeweils welchen Auflagen, ist nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass sie gerade 1915 und 1916, den Spitzenzeiten der Kinderbuchproduktion, der Konkurrenz vergleichbar renommierter Druckhäuser Stand hielten.
Neben berühmten Illustratoren und Autoren, die zuvor und später vom Schreiber-Verlag verpflichtet wurden, wie etwa Sibylle Olfers („Etwas von den Wurzelkindern“) oder Fritz Koch-Gotha ("Häschenschule"), sind die Urheber von "Heil und Sieg" unbekannt geblieben. Gleichwohl überzeugen die kolorierten Zeichnungen von Marie Flatscher durch ihre bemerkenswerte Klarheit, während Ludwig Morgensterns Reime scheinbar leichtfüßig daherkommen. Sie sind stets kaisertreu und bisweilen martialisch in der Aussage.
Das Bilderbuch mit erzieherischem Anspruch richtete sich augenscheinlich an eine Altersgruppe von 4 bis 8 Jahren. Es griff ein in der älteren Kinder- und Jugendliteratur beliebtes und immer wieder variiertes Thema auf: die enge Verschränkung von Kinderspiel und Soldatenleben.
Auf dem Titelbild des Buches stürmt uns eine Kinderschar in der Kleidung der Mittelmächte entgegen. Ihre Nationalität wird durch ihre Uniformen und Fahnen kenntlich: Auf den kleinen österreich-ungarischen Soldaten links folgt das deutsche Kampfesbrüderchen mit Pickelhaube, dann ein Knirps aus dem Osmanischen Reich (bzw. Türkei) und an seiner Seite jener aus Bulgarien. Die Illustratorin hat offenkundig minutiöse Studien nicht nur an kindlichen Gesten, sondern ebenso an Uniformen durchgeführt. Dieser Detailreichtum verleiht auch den folgenden sieben Bilderzählungen, bei allen durchaus zum Schmunzeln anregenden Beobachtungen, eine irritierend realitätsbezogene Authentizität.
Angesichts der geradezu liebevoll gestalteten Zeichnungen konnten nicht zuletzt die erwachsenen Buchkäufer übersehen, dass in eben dieser Realität aus dem Krieg “spielen” mittlerweile blutiger Ernst geworden war. Bei einer verkauften Auflage von mindestens 4.000 Exemplaren ist zu vermuten, dass der mal verniedlichende, mal unverblümte Ton von Ludwig Morgenstern die Seelenlage so manches Deutschen genau getroffen hat. Im Kapitel "In der Festung" etwa, in dem die tapferen Krieger vor einem Holzklötzchen-Fort ihre zitternden Schwesterchen “verteidigen“, heißt es: "Kameraden! Auf, nehmt die Flinten zur Hand /... Glaubt nur, wir schlagen kräftig drein / Und unsere Geschosse nicht minder". Kein Wunder also, dass die kleinen Kampfgenossen so gewappnet schließlich in ein hoffnungsfrohes Jubellied in der Variation der titelgebenden Parole "Sieg und Heil, ihr Waffenbrüder" einstimmen können.
Etliche der im Krieg erschienenen Titel erlebten ach dem Ersten Weltkrieg noch weitere Auflagen, so wurden etwa Else Urys Bücher der Nesthäkchen-Reihe (dabei u.a. "Nesthäkchen und der Weltkrieg") bis 1933 insgesamt 1,5 Millionen Mal verkauft. Dazu gesellten sich noch bis in die 30er Jahre auflagenstarke Erlebnisberichte und andere Darstellungen, die den Krieg verherrlichten und zur unbedingten Vaterlandsliebe aufriefen. Dem „Sieg und Heil“ vergleichbare, „unschuldig“-verspielte Bilderbücher, zudem aus künstlerisch versierter Hand, sollte es später kaum mehr geben.
Mai 2015 - Dank des Vaterlands: Ordensspange mit Eisernem Kreuz und Württembergischer Verdienstmedaiille
52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Der Dank des Vaterlands: Orden und Ehrenzeichen
Ordensspange mit Eisernem Kreuz und Württembergischer Verdienstmedaille, 1914-1918
Gusseisen, Silber, Ripsband, ca. 6x7,5 cm
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 002519)

Das Eiserne Kreuz zweiter Klasse und die Silberne Württembergische Verdienstmedaille gehören zu den wenigen persönlichen Dingen, die der Cannstatter Arbeiter Hermann Rudolf Nill (1884-1960), der Vater der Esslinger SPD-Politikerin Elisabeth Nill, über den Zweiten Weltkrieg retten konnte, als die Familie ausgebombt wurde. Vor allem das Eiserne Kreuz war eine der wichtigsten Auszeichnungen, mit der Soldaten aller Klassen im deutschen Heer symbolisch der so genannte „Dank des Vaterlandes“ vermittelt wurde. Es gilt als die bekannteste Auszeichnung der preußischen und deutschen Militärgeschichte. Neben dem Stahlhelm gehört es zu den symbolisch hoch verdichteten Gegenständen, die für den Ersten Weltkrieg stehen.
Mit der Neustiftung des Eisernen Kreuzes zu Beginn des Ersten Weltkrieges sollte eine Tradition aus den Befreiungskriegen gegen Napoleon wiederbelebt werden. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. hatte sich bei seinem Entwurf, den Friedrich Schinkel konkretisierte, in Form und Aussehen an das Balkenkreuz des Deutschen Ordens, also an ein christliches Symbol, angelehnt. Der Materialwert war im Gegensatz zu seinem Symbolwert gering, bestand das ausschließlich aufgrund von Verdiensten verliehene Ehrenzeichen doch aus schwarzem Gusseisen.
Auf der Vorderseite ist reliefartig unten das Jahr 1914, mittig auf dem Eisenkern der Buchstabe W für Wilhelm II und im oberen Kreuzarm die preußische Königskrone eingegossen. Die Rückseite des E.K. II war eine Reminiszenz an die ersten Verleihungen des Kreuzes im Jahr 1813: Hier sind drei Eichenlaubblätter mit zwei Eicheln, die preußische Königskrone sowie die Initialen F und W. (für Friedrich Wilhelm III.) und die Jahreszahl 1813 aufgesetzt. Das E.K. II wurde am schwarz-weißen Band im zweiten Knopfloch der Uniformjacke getragen; Zivilisten konnte es am weißschwarzen Band verliehen werden, was jedoch bei den kämpfenden Truppen bald als „Schieberkreuz“ verschrien war. Das seltenere E.K. I wurde ohne Band als Steckkreuz auf der Brust getragen; in seinem Aussehen unterschied es sich nicht von der zweiten Klasse, jedoch war die Rückseite frei von gestalterischen Elementen. Ungefähr 5,4 Millionen Eiserne Kreuze wurden während des Ersten Weltkriegs an die rund 13 Millionen Angehörigen des deutschen Heeres verliehen. Jeder dritte Soldat wurde mit dem E.K.II ausgezeichnet, was diese Kriegsauszeichnung in den Augen der Zeitgenossen stark entwertete.
Die Württembergische Tapferkeitsmedaille wurde 1794 durch Herzog Ludwig Eugen von Württemberg gestiftet. Seit 1892 zierte die Vorderseite der Medaille das Bildnis des Württembergischen König Wilhelm II. mit der entsprechenden Umschrift. Auf der Rückseite ist ein Lorbeerkranz dargestellt, in dessen Mitte die dreizeilige Inschrift FÜR TAPFERKEIT UND TREUE steht. Ursprünglich waren zur Auszeichnung für herausragende Tapferkeit vor dem Feinde ausschließlich Offizieren vorgesehen. Im Ersten Weltkrieg wurde das ständische Auszeichnungsmonopol aufgehoben. Nun konnten auch einfache Soldaten geehrt werden. Von 600.000 Soldaten der Württembergischen Armee erhielten 201.412 die Silberne Militär-Verdienst-Medaille, darunter auch Hermann Rudolf Nill. Weit weniger Soldaten, 1832 Offiziere und 2402 Unteroffiziere und Mannschaften, wurden mit der Goldenen Militär-Verdienst-Medaille ausgezeichnet, deren Verleihung der König von Württemberg sich selbst vorbehielt.
Beide Kriegsauszeichnungen standen symbolisch für den „Dank des Vaterlandes“, den die Soldaten für ihre Opferbereitschaft erhalten sollten. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, was es für einen Soldaten aus bäuerlichem oder proletarischem Milieu bedeutete, wenn er von Repräsentanten des Staates mit jenem Zeichen der Anerkennung dekoriert wurde. Doch die inflationäre Verleihungspraxis machte diese Auszeichnungen zu einem „billigen Zahlungsmittel“, mit dem das Anerkennungsbedürfnis der Kriegsteilnehmer befriedigt werden sollte. Bis zu ihrer Entwertung im Laufe des Krieges trugen auch jüdische Soldaten und jene Kriegsteilnehmer, die eine kriegskritische Haltung hatten, die Zeichen der Anerkennung mit Stolz. Auch nach Kriegsende wurden die Auszeichnungen nicht nur von Militaristen in Ehren gehalten; für Witwen und Mütter von gefallenen Soldaten standen sie im Zeichen der Erinnerung, und für viele Veteranen waren sie eine Erinnerung an die Entbehrungen und Opfer, die von ihnen abverlangt wurden.
April 2015 - Traditionspflege: Fahne des "Krieger- und Militärvereins Esslingen"
52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Traditionspflege:
Fahne des "Krieger- und Militärvereins Esslingen", 1915
Seide, Garn, Metall, 158,5cm breit x 131,5cm hoch
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 004247)

Die Fahne des „Krieger- und Militärvereins Esslingen“ von 1915 wurde anlässlich der Umbenennung des seit 1889 bestehenden „Militärvereins Esslingen“ angefertigt. Sie zeigt auf der Mitte der Vorderseite den Reichsadler mit Brustschild als Wappentier der Stadt, darunter ein Eisernes Kreuz. Die Jahreszahl 1889 steht für das Gründungsjahr, 1915 für das Jahr der Umbenennung. Auf der Rückseite findet sich das Wappen des Königreichs Württemberg auf schwarz-rotem Grund. Der Zustand der Fahne ist erstaunlich gut, war sie doch bei offi ziellen Veranstaltungen und Vereinsanlässen häufig Wind und Wetter ausgesetzt. Weitere Informationen zu ihr liegen bedauerlicherweise nicht vor.
Für die Militärvereine war die Vereinsfahne das wichtigste Symbol militärischer Wertvorstellungen. Ursprünglich als Orientierungszeichen in der Schlacht eingesetzt, bekamen Fahnen im Laufe der Zeit immer größere symbolische Bedeutung. Sie entwickelten sich zum Ehrenzeichen der Soldaten. Daher wollten viele Militärvereine möglichst bald eine eigene Fahne besitzen, denn „der Stolz eines jeden Kriegervereins ist seine Fahne“ (Alfred Westphal, 1912). Sie war das Symbol gemeinsamer Überzeugungen und Verpflichtungen sowie des Ehrenkodex‘ des Vereins.
Nach den „Einigungskriegen“ entstanden seit 1871 überall in Deutschland Kriegervereine. Sie dienten der Erinnerungs- und Kameradschaftspflege und wirkten bei öffentlichen Anlässen und Begräbnissen verstorbener Mitglieder mit. Später kam noch die Unterstützung von hilfsbedürftigen Vereinsangehörigen und deren Familien hinzu. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Deutschland rund 30.000 Krieger- und Militärvereine mit rund 3 Mio. Mitgliedern. Sie entstammten vor allem dem kleinbürgerlichen Milieu (Handwerker, Arbeiter, Angestellte und Beamte). Nur wenige gehörten höheren Gesellschaftskreisen an. Aufgrund dieser Mitgliederstruktur und dem durch sie verkörperten Militärkult der Gesellschaft des wilhelminischen Deutschlands wird das Phänomen der Krieger- und Militärvereine auch als „Militarismus der ‚kleinen Leute‘“ bezeichnet.
In Esslingen gründeten ehemalige Soldaten der Einigungskriege 1872 den „Deutschen Krieger-Verein Eßlingen“. Hier konnten nur Veteranen dieser Kriege Mitglied werden. Für Reservisten, die lediglich ihren Wehrdienst und noch keinen aktiven Einsatz geleistet hatten, entstand daher im Januar 1889 zusätzlich der „Militärverein“. Dessen erste Fahne wurde 1892 angeschafft. Der „Militärverein“ veranstaltete monatliche Versammlungen, Vorträge und Ausflüge. Seine Mitglieder nahmen auch an den Württembergischen Kriegerbundtagen teil. Ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens war die Mitwirkung bei Beerdigungen von Mitgliedern. Bis 1914 gab es 619 aktive Vereinsmitglieder - zumeist ebenfalls Handwerker und Arbeiter sowie Angestellte und Beamte.
Nach Kriegsbeginn rückten rund 300 Angehörige des „Militärvereins“ zum Kriegsdienst ein. Daher beschloss man am 18. September 1915, den Verein in „Krieger- und Militärverein“ umzubenennen, da seine Mitglieder „nun als ‚Krieger‘ zu behandeln und verehren“ waren. Für 46 im Weltkrieg gefallene „Krieger“ wurde 1920 eine Ehrentafel angefertigt und im Vereinslokal, dem „Palmschen Bau“, angebracht.
In der Heimat übernahmen die Mitglieder Wachtdienste und beteiligten sich an der Ausbildung der Jugendwehr und von „Landsturmpflichtigen“. Der Verein versandte „Liebesgaben“ und unterstützte die Familien einberufener und gefallener Mitglieder. Diese Hilfe leistete der Verein in 667 Fällen in einer Gesamthöhe von 3763 Mark. Außerdem gehörte weiterhin die Mitwirkung an Begräbnissen zu den wichtigen Aufgaben. Monatliche Versammlungen wurden hingegen nur noch unregelmäßig durchgeführt.
Kriegsende und -niederlage sowie der politische Umbruch 1918 prägten das Selbstverständnis des Vereins nachhaltig. Die Erfahrungen des Krieges sorgten zudem für einen Mitgliederschwund und die Beteiligung an den Veranstaltungen nahm stark ab. Neu war jetzt die Mitwirkung an den Gedenkfeiern für die Gefallenen des Weltkrieges und die Beratung von Mitgliedern im Rahmen des "Reichsfürsorgegesetzes“. Auch setzte sich der Verein für die Errichtung eines städtischen Gefallenendenkmals ein. 1928 fusionierte der „Deutsche Krieger-Verein“ von 1872, der nur noch 17 Mitglieder hatte, mit dem „Krieger- und Militärverein“.
Nach 1933 wurden auch die Militärvereine gleichgeschaltet. Der 1937 aus den Landesverbänden geschaffene „NS-Reichskriegerbund“ wurde 1943 aufgelöst. 1945 erfolgte ein Verbot der Kriegervereine, sie bildeten sich aber seit Anfang der 1950er Jahre neu. In Esslingen gab es 1953 wieder eine Kameradschaft des „Kyffhäuserbundes“
März 2015 - Mangelwirtschaft: Esslinger Lebensmittelmarken
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Mangelwirtschaft: Esslinger Lebensmittelmarken
Februar 1915 – November 1916
Bedrucktes und beschriebenes Papier, 30,5 cm breit x 21 cm hoch
(Stadtarchiv Esslingen, Materialsammlung Erster Weltkrieg, Nr. 1)

Schlägt man das prächtige, grüne Album, reich verziert mit goldenen und weißen Ornamenten auf, ist man überrascht. Nicht Familienfotos, wie vielleicht erwartet, sind darin sorgfältig aufgeklebt und beschriftet, sondern Lebensmittelmarken und -karten aus dem Oberamt und der Stadt Esslingen und den Bezirken Schongau und Marbach. Wer die Marken und Karten aus der Zeit zwischen Februar 1915 und November 1916 gesammelt und in das Album eingefügt hat, ist nicht bekannt.
Kaum ein Gegenstand spielte wohl im Alltag der Menschen während des Krieges eine so große Rolle wie die Lebensmittelmarken. Seit dem Frühjahr 1915 hantierten tagtäglich Millionen Deutsche mit den kleinen bunten Zetteln und DIN A4 großen Bögen, auf denen die Marken aufgedruckt waren. Ihre Einführung änderte das Konsumverhalten der Bürger grundlegend. Spontanes, bedarfsgerechtes und vor allem selbstbestimmtes Einkaufen war nicht mehr möglich. Nun legte der Staat die Menge an Lebensmitteln oder Gütern fest, die einer Person in einem bestimmten Zeitraum zustand. Dabei orientierte sich die Mengenzuteilung an Alter, der beruflichen Beanspruchung und dem Gesundheitszustand.
Wie die Esslinger die Einführung der Marken am 15. Februar 1915 erlebten, hat Gertrud Förster ihrem Mann an die Front geschrieben: „Bei uns ist jetzt vieles anders geworden. Von Montag ab dürfen Bäcker nur auf Karten Brot abgeben und die muss man auf dem Rathaus holen, für ½ Monat.“ Im Vergleich zur Vorkriegszeit, als die Tagesration etwa 380 Gramm Brot pro Person betrug, lag nun die Zuteilung mit 200 Gramm weit darunter.
Vor dem Einkauf stand nun der Behördengang. Aus Zeitungsinseraten der Stadtverwaltung erfuhren die Esslinger, wann und wo sie die nach dem Alphabet der Nachnamen ausgegebenen Marken bekamen. Ausgabestellen waren das Neue Rathaus, die Oberrealschule und die Katholische Volksschule am Waisenhof sowie der Konsum- und Sparverein in der Ritterstraße 5. Anzahl, Zusammenstellung und Gültigkeit der Marken variierten über die Kriegszeit hinweg. Die wechselnde Farbe der Karten erlaubte es den Händlern, auf einen schnellen Blick zu sehen, ob die die Marken noch gültig waren. In Esslingen gab es die Besonderheit, dass bis Herbst 1917 auch Marken aus anderen Oberämtern eingelöst werden konnten, was darauf schließen lässt, dass bis dahin die Versorgungslage nicht so dramatisch war, wie in anderen Orten des Reiches.
Im Laufe des Krieges erfasste die staatliche Zwangswirtschaft alle Bereiche des täglichen Bedarfs. Fleisch, Zucker und Butter ebenso wie Seife, Kohlen, Kleider und Schuhe gab es seit 1916 nur noch gegen Marken. Wobei nur mit den Mehl- und Brotkarten ein Anrecht auf Erhalt der Waren verbunden war, die anderen, so genannte „Spar- oder Sperrkarten“, legten lediglich die maximale Verbrauchsmenge fest. Da es vor allem in der zweiten Kriegshälfte zu Engpässen in der Kartoffel-, Fleisch- und Milchversorgung kam, mussten sich viele Esslinger mit geringeren Mengen zufrieden geben, als ihnen laut Marken zustand.
Das Markensystem sollte eine gerechte Verteilung der wenigen Waren ermöglichen und den Ansturm der Bürger auf die Geschäfte in geregelte Bahnen lenken. Doch letztlich fehlte es an einem staatlichen Gesamtkonzept zur Versorgung der Bevölkerung. Auch Städte wie Esslingen waren gezwungen zu reagieren anstatt zu agieren und sahen sich am Ende nur noch in der Rolle von Verwaltern des Mangels. Die Folgen waren gravierend: Die Bürger verloren zunehmend das Vertrauen, das Verhältnis zwischen Verwaltung und Bürgern verschlechterte sich und die soziale Schere zwischen Kriegsgewinnern und Verlierern ging immer weiter auf. Wer konnte, half sich selbst – mal mehr, mal weniger gesetzeskonform. Kriegsgärten wurden angelegt, um Obst und Gemüse für den Eigenbedarf anzubauen. Andere fuhren auf „Hamstertour“ ins Umland oder versuchten auf dem Schwarzmarkt die notwendigen Lebensmittel zu bekommen.
Zu Lebensmittelkrawallen und einer Hungersnot wie in anderen deutschen Städten kam es in Esslingen zwar nicht, aber es starben wohl etliche körperlich geschwächte Bürger im Herbst 1918 an der Spanischen Grippe. Und obwohl die Versorgungslage prekär war, verweigerte der Gemeinderat den Esslingern in den letzten Kriegswochen die Ausgabe von Kartoffelvorräten. Er wollte sie für die heimkehrenden Soldaten aufbewahren.
Februar 2015 - Kriegsspiele: Kriegswaffen für Kinder
52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Kriegsspiel: Kriegswaffen
Spielzeugkanone auf Lafette mit Protze, ca. 1902-1916
Messing, Holz, lackiert, ca. 60cm lang
(Privatbesitz)

Kinderspielzeug ist Ausdruck seiner Zeit und verweist zugleich auf bestimmte Realitäten, die Kinder durch das wiederholende Spiel einüben sollen. Auch Kriegsspielzeug war seit seiner Entstehung ein gängiges Spielzeug der Jungen und sollte die dem männlichen Geschlecht zugeordneten militärischen Verhaltensweisen wie Kampf, Disziplin und gesellschaftliche Anerkennung vermitteln. Aber Kriegsspielzeug ist keine Erfindung des Ersten Weltkrieges, sondern seit dem 17. Jahrhundert bekannt, als es für Königssöhne als Lehrmittel zum Einsatz kam. Mit dem Entstehen des Nationalismus und durch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert breitete es sich aus.
Schon über drei Generationen befindet sich die Spielzeugkanone im Besitz der Familie Proß und soll vom Großvater Carl Proß (1870-1954) selbst angefertigt worden sein. Carl Proß wurde in Esslingen geboren, absolvierte zwischen 1884-1888 eine Lehre als Ziseleur bei der ortansässigen Metallwarenfabrik Deffner und beschäftigte sich mit der Verzierung von Metalloberflächen. Diese Kenntnisse konnten ihm bei der Spielzeuganfertigung für seine beiden Söhne Hermann (*1903) und Alfred (*1904) nützlich gewesen sein. Hermann Proß, der Enkel des Ziseleurs, stellte dem Stadtmuseum die Spielzeugkanone zur Verfügung.
Aber was bedeutete es, Kind im Ersten Weltkrieg zu sein? Die Erfahrungen sind alters- und wohnortsbedingt vielfältig, dennoch wurden die Grenzen zwischen der gewaltausübenden Welt der Erwachsenen und der zu verschonenden Welt der Kinder brüchig.
Die Kinder waren einer enormen Kriegspropaganda ausgesetzt, die den Krieg als erzieherischen Wert deutete. Wie die Kinder darauf reagierten, ist schwer zu sagen: In der Schule angefertigte Zeichnungen, Aufsätze und ausgeübte Spiele verweisen auf die Wirkung der Propaganda. Gleichzeitig erlebten viele Kinder Verluste und sahen die gezeichneten Rückkehrer. Dies führte auch zur Ablehnung des Krieges oder zu einer eigenen Sichtweise. So ist in einem Protokoll des Gemeindewaisenrats in Esslingen 1915 vom Schüler Hermann Oefele (*1904) die Rede, der „fortgesetzt die Schule schwänzte“. Der Grund für dieses Verhalten wird mit dem kriegsbedingten Fehlen des Vaters und einer kränklichen Mutter begründet. Weiter heißt es: „Seit der Vater vom Felde beurlaubt ist, kommt der Knabe regelmässig in die Schule und […] führt sich seither auch gut“.
Die väterliche Rolle des Ernährers, Beschützers und Richters konnten Mütter nur unzureichend ausfüllen. Ihre Kinder waren oft ohne Beaufsichtigung und schlossen sich in Banden zusammen, die durch die übermittelten Kriegseindrücke realistische Schlachten gegeneinander führten oder sich am Schwarzmarkt beteiligten. Der Städtische Schularzt Esslingens wies 1914 in der Eßlinger Zeitung auf die Gefahren des Kriegsspiels hin: „Außerdem wird noch einmal auf die Gefahren der allzu wilden Soldatenspiele der Knaben erinnert; Pistolen, spitze Säbel und Lanzen können bedenkliche Verletzungen, namentlich der Augen, verursachen.“ Dennoch lobte die Erwachsenenwelt das kindliche Kriegsspiel recht häufig, da es die Jungen auf ihre Funktion als zukünftige Soldaten vorbereiten sollte.
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam der deutsche Spielzeugexport zum Erliegen. Deshalb konzentrierten sich die Spielwarenhersteller auf den deutschen Markt. Auch Neuentwicklungen der Zeit, zum Beispiel das U-Boot oder der Zeppelin, färbten auf die Spielzeugentwicklung ab. In der Eßlinger Zeitung fanden sich 1914 Werbeanzeigen für Spielzeugkanonen und anderes Kriegsspielzeug der Esslinger Spielzeugfirma Karl Gross, des Kaufhauses Burkhardt und des Spielzeug- bzw. Ledergeschäfts Wilhelm Heiges. Bereits 1915 kam es zu einer Übersättigung des Spielzeugmarktes. Die Kriegsmüdigkeit und Ernüchterung innerhalb der Gesellschaft führten zu einem geringeren Interesse am Kriegsspielzeug.
Januar 2015 - Sehnsucht: Liebesbriefe an die Front
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Sehnsucht: Liebesbriefe an die Front
1915 bis 1918, gebunden nach 1936
2 Bände, grauer Einband (Leinwand), Folio ca. 31 x 33cm
(Stadtarchiv Esslingen, Nachlass Förster, Bände 1/2)

Im Stadtarchiv befinden sich seit 2000 vier eher unscheinbare Bände mit Briefen, von denen zwei die Zeit des Ersten Weltkriegs betreffen. Nach dem Tod seiner Ehefrau Gertrud (1936) hat der Ingenieur Moritz Förster ihre Briefe an ihn aufgeklebt und in chronologischer Reihenfolge einbinden lassen. Auf den Einbänden steht: „Mein treuer liebster Kriegskamerad 1914-1918“, und: „Briefe von meiner lieben Frau I bzw. II“.
Die fast 1000 innigen Briefe („Mein süßer, goldiger, von ganzem Herzen geliebter, bester, liebster Herzensschatz!“) stehen für sich selbst: Sie sind weder kommentiert, noch hat Moritz Förster seine eigenen Schreiben von der Front miteingeklebt, so dass wir nur eine, Gertruds Seite des Briefwechsels kennen.
Viel wissen wir nicht über die Försters: Gertrud Meissner wurde am 11. März 1889 in Zittau in der südlichen Oberlausitz geboren. 1909 heiratete sie den sieben Jahre älteren Ingenieur Moritz Förster. Mitte 1912 zog das Paar nach Esslingen, wo Förster eine Stelle bei der Bettfedernreinigungsmaschinenfabrik L. H. Lorch antrat. Das Paar wohnte in der heutigen Richard-Hirschmann-Str. 16, gemeinsam mit der Mutter Gertruds, die ihre Anfang 1915 im sechsten Monat schwangere Tochter unterstützte. Moritz Förster weilte als „Waffenmeistergehilfe“ von Januar 1915 bis zum Kriegsende als Angehöriger des Landwehr-Infanterie-Regiments 119 in Sennheim (Czernay) im Oberelsaß.
Schon am 10. Januar 1915 schrieb Gertrud den ersten Brief an ihren „lieben, guten Morle“ als Antwort auf seine ersten „3 lieben Karten“. Sie möchte „gern ein wenig mit Dir plaudern“ und erzählt von der Rückfahrt mit dem „DZug“ von Stuttgart, von den Briefen an Verwandte und Freunde, von ihrem Husten und vom Trost, den der Glauben schenkt: „Heute früh war ich in der Stadtkirche. […] Immer war es mir als säßest Du neben mir“.
Am wichtigsten aber waren und blieben: Sorge und Sehnsucht, nach Frieden („wenn es doch bald Frieden gebe“) und dem Partner: „Wie es Dir wohl gehen mag? Ich denke immer u. immer an Dich“! Hunderte solcher Passagen finden sich und zeugen von der Liebe und dem Verlangen der Eheleute. Liebe und Sorge materialisieren sich in endlosen Überlegungen, dem geliebten Mann zu helfen, und daraus resultierend in zahllosen Paketen mit „Liebesgaben“, deren Inhalt feinsäuberlich aufgelistet wird: Die Bandbreite reicht von Eingekochtem über Ripple und Knödeln und Süßigkeiten wie Rosinen und Cognacbohnen bzw. Tee und Kakaotabletten bis zu Kirschgeist, Zigaretten, Zigarren und Zeitungen. Daneben gab es Strümpfe, Seife und Wäsche in jeder Form.
Für das Projekt „52 x Esslingen“ wird vor allem die stadthistorische Dimension der gut lesbaren und flüssig geschriebenen Briefe wichtig werden. Zwar stehen persönliche Befindlichkeiten und Familiäres wie der kleine Sohn im Vordergrund, doch immer wieder schimmert das Leben in Esslingen im Krieg durch; Beobachtungen: „Heute habe ich seit langer Zeit einen Flieger in Esslingen gesehen. Neulich sahen wir auch […] an der Neckarverlegung gefangene Franzosen arbeiten“ (13.2.1915), Versorgungslage: „Muttel [hat] Brotmarken geholt. Jetzt mußte man ganz genau angeben, wieviel man Mehl hat“ oder Esslinger Kriegswirtschaft: „Lorch dreht jetzt Geschosse. Haben einen Auftrag bekommen“ (19.1.1915).
Die fortzuführende Auswertung aller Briefe ist ein wesentlicher Bestandteil des historischen Projekts zum Ersten Weltkrieg in Esslingen. Auch wenn Feldpostbriefe wie diese einen hohen Zeitaufwand für die Lektüre erfordern und behutsam interpretiert werden müssen, bieten sie neben den Informationen zu allgemeinen Themen wie Kriegserfahrung, Geschlechterverhältnis oder Mentalitäten von Menschen im Krieg vor allem einen bislang noch nicht bekannten „O-Ton“ aus dem Esslingen des Ersten Weltkriegs und damit eine zwar subjektive, aber höchst seltene authentische Stimme als unschätzbare Quelle für die Alltags- und Mentalitätsgeschichte unserer Stadt.
Dezember 2014 - Erste Kriegsweihnacht: Postkarten von der Front
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Erste Kriegsweihnacht: Postkarten von der Front, September 1914 bis August 1915
Papier, bedruckt und beschrieben, 9 x 14 cm
(Stadtarchiv Esslingen, Bestand Militärverein)

Im Stadtarchiv Esslingen wird ein Stapel von drei Briefen und 100 Postkarten aus dem Bestand des Esslinger Militärvereins aufbewahrt: 66 klassische Feldpostkarten, 34 Karten mit einem Motiv auf der Rückseite. Die meisten von ihnen sind adressiert an „Obersekretär Wilhelm Sprandel“ oder den „Militärverein Eßlingen“ und wurden zwischen Ende September 1914 und August 1915 von mehr als hundert Mitgliedern des Militärvereins von der Front und aus der Etappe verschickt. Mit den Postkarten bedankten sich die Soldaten für Liebesgaben (z.B. Zigarren), die Sprandel ihnen im Namen des Vereins geschickt hatte, sowie für die finanzielle Unterstützung, die ihre Familien vom Verein erhalten hatten.
Feldpostkarten, darunter 5,5 Milliarden Bildpostkarten, waren während des Ersten Weltkrieges das wichtigste Kommunikationsmittel zwischen Front und Heimat. Für die Angehörigen zu Hause waren sie ein wichtiges Lebenszeichen. Für die Männer an der Front war der Kontakt in die Heimat, zu ihrem „alten“ Leben überlebenswichtig. Nur wenige schrieben über ihre Erlebnisse im Krieg, - wenn, dann versuchten sie zuversichtlich, siegesbewusst und unerschrocken zu wirken. Schließlich schrieb man den Kameraden des Militärvereins. Als Motiv wählten die meisten – in Touristenmanier – klassische Ansichtskarten. Einige schickten eine Fotografie von sich selbst im Kreis der Frontkameraden, Trümmerlandschaften und Propagandapostkarten sind selten. Vielleicht empfanden die Esslinger Soldaten diese Motive anlässlich von Weihnachten und Neujahr als unpassend. Die einzige weihnachtliche Kunstpostkarte zeigt eine Zeichnung des bekannten Münchner Karikaturisten Karl Arnold (1883-1953).
Die Dankespostkarten sind eine eindrückliche Momentaufnahme aus dem ersten Kriegsjahr, vor allem aus den Monaten um Weihnachten 1914. Keineswegs waren die Soldaten siegreich wieder zuhause, wie man es erwartet hatte. Die Daheimgebliebenen mussten stattdessen ohne sie feiern. Indem sie auf den Weihnachtsfeiern Dankespostkarten der Soldaten verlasen, holten Angehörige und Freunde sie symbolisch in ihren Kreis hinein.
November 2014 - Liebesgaben: Zigarettendose "Deutsche Helden rauchen"
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Zigarettendose "Deutsche Helden rauchen", 1914
Blech, innen verzinnt, aussen lackiert, 2,5x8,3x12,2cm
(Privatbesitz)

Eine Zigarettendose, deren Deckel durch ein einfaches Drahtscharnier aufklappbar ist. „Deutsche Helden Zigarette“ steht in deutscher Frakturschrift auf dem Deckel. Die Dose enthielt laut Aufschrift 50 Zigaretten der „Compagnie Laferme“ mit „Goldmundstück flach“, also von elegantem ovalen Querschnitt. 1862 war die die „Compagnie Laferme“ als erste deutsche Zigarettenfabrik in Dresden gegründet worden und begründete dort eine große Tradition der Zigarettenherstellung.
Fünfzig Jahre später, 1912, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, wurden in Deutschland 128 Zigaretten pro Einwohner konsumiert. Nach dem Krieg hatte sich der Verbrauch mehr als verdoppelt: 319 Zigaretten pro Einwohner und Jahr.
Das internationale Flair, das viele Zigaretten durch ihren Markenauftritt (so würde man heute sagen) um 1900 vermittelten, war 1914 nicht mehr attraktiv. Wie andere Genussmittel mit internationalem Zuschnitt – Cognac, Champagner, Whisky – wurden auch die Zigaretten national vereinnahmt. Das war die Geburtsstunde der Marke „Deutsche Helden Zigarette“. Sie wurde 1914 erfunden und in einer vornehmen, im Dekor reduzierten, aber deutlich national wirkenden Form präsentiert.
Die Blechdose wollte seriös wirken, eine Offizierszigarettendose sozusagen. Und gnadenlos modern: Die Aufmachung wirkt wie eine vorgezogene Art-déco-Gestaltung. Die Flächigkeit der rein grafischen Lösung ist an Ruhe und Klarheit schwer zu überbieten. Es waren edel erscheinende und teure Orientzigaretten in einer schwarzweißroten Designerdose.
1914/15 gab es einen echten Nachfrageboom bei den teuren Zigarettenmarken: Man wollte den Soldaten im Felde ja etwas wirklich Gutes tun. Nach den amtlichen Feldpostbestimmungen konnte man die 50-Zigaretten-Dose als Päckchen mit unter 250 Gramm jederzeit für 10 Pfennige Porto versenden. 16 Millionen solcher Kleinstpäckchen, Briefe und Postkarten beförderte die Feldpost 1914 bis 1918 täglich.
Ein der Dose beigelegter Zettel informierte: „Diese Schachtel wurde gefüllt und gestiftet von“ und dann handschriftlich ausgefüllt weiter: „teilnehmenden Kriegereltern Dir, dem tapfern Vaterlandsverteidiger“. Dieser Adressat war der Maschinentechniker Walter Lutz, evangelisch, noch ledig, geboren am 11. Juni 1895 in Esslingen. Am 4. August 1914 hatte er sich als Kriegsfreiwilliger gemeldet und war am 30. August der 9. Kompanie des Reserve-Infanterieregiments 247 zugeteilt worden. Dort wurde er fünf Wochen lang ausgebildet. Am 11.10. brach das Regiment Richtung Flandern auf und kam am 20.10. in Kortrijk an. In den folgenden fünf Wochen waren die Württemberger gut 20 Kilometer weiter westlich in die so genannte Erste Flandernschlacht verwickelt und kämpften im Oktober und November 1914, also in diesen Tagen vor hundert Jahren, östlich von Ypern bei Bezelaere und danach bis zum Frühjahr 1915 im dortigen durch diese verlustreichen Kämpfe berühmt-berüchtigten Polygonwald.
1915 wurde Lutz zum Gefreiten befördert, 1916 zum Unteroffizier und am 14.9.1918 wegen „Tapferkeit vor dem Feinde“ zum Vizefeldwebel. Die ganze Zeit war er an der Westfront eingesetzt. Entlassen wurde er im Dezember 1918 mit 50 Mark Entlassungs- und 15 Mark so genanntem Marschgeld sowie „einem Marschanzug“ und dem truppenärztlichen Befund „kv“ (kriegsverwendungsfähig).
Während der Ersten Flandernschlacht im Herbst 1914 muss er diese Zigarettendose bekommen haben, die bis heute in der Familie weitergegeben und aufbewahrt wird. Die trostspendenden Zigaretten waren die beliebtesten „Liebesgaben“ vor Schnaps und Schinken, Seife und Kerzen, Socken und Schokolade. Die massenhafte Versendung dieser Überlebensmittel an die Front war den ganzen Krieg hindurch eine wichtige Aufgabe von Kriegervereinen, Schulen, dem Nationalen Frauendienst, aber auch dem Roten Kreuz oder einzelnen Firmen oder Personen.
Der Erste Weltkrieg hat die Vorherrschaft der Zigaretten bei den Rauchwaren endgültig besiegelt; Pfeife, Zigarre oder Kautabak nehmen seither beim Tabakgenuss nur noch eine kleine Randstellung ein.
Oktober 2014 - Trauer: Gedenkblatt für Gottlob Metzger
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Gedenkblatt für Gottlob Metzger,1915
Gerahmt, 72,4 x 51,6 cm
Rasterdruck. Kunstanstalt Gustav Eyb, Stuttgart
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 001384)

In die offiziell und propagandistisch verbreitete Kriegsbegeisterung mischte sich schon in den August- und Septembertagen 1914 die Erfahrung, dass Krieg auch bedeutete, dass Menschen sterben würden. Da es an der Westfront darauf ankam, am besten wie 1870 mit einem Sieg eine schnelle Entscheidung herbeizuführen, wurden dort viele Kräfte gebündelt und massiv eingesetzt. So wurde auch das Infanterieregiment „Kaiser Wilhelm, König von Preußen“ (2. Württembergisches) Nr. 120 dorthin verlegt, das in Ulm stationiert war, in dem aber viele Esslinger dienten.
Emil Gottlob Metzger, evangelisch, Weingärtner aus Esslingen, genauer: Aus der Unteren Beutau 32, war als einfacher Musketier am 7. August 1914 in der 4. Kompanie des Regiments eingerückt. Mit 21 Jahren, einer guten Führung und ohne Strafen war er angetreten. In Lothringen hatte er an der Maas und im Argonnerwald gekämpft und starb am 23. September in der zweiten Schlacht um Varennes. Sein Grab ist nicht bekannt.
Emil Gottlob Metzger war als zweites von fünf Kindern am 10. März 1893 in eine Weingärtnerfamilie hineingeboren worden; zwei der Geschwister starben noch im Kindesalter. Die Familie lebte von 22 Ar Weinberg, verteilt auf Neckar- und Ebershalde, sowie 54 Ar Garten, Acker und Streuobstwiesenland. Damit gehörte sie nicht zu den ärmsten in der Weingärtnergenossenschaft.
Obwohl Gottlob Metzger schon Ende September 1914 gefallen war, schickte die württembergische Regierung erst Ende 1915 ein Gedenkblatt an die Familie. Entworfen hatte diesen großformatigen farbigen Rasterdruck Robert von Haug (1857-1922), württembergischer Hofmaler und Lithograph. Er war zu dieser Zeit Direktor der Stuttgarter Kunstakademie und berühmt für seine Bilder mit Motiven aus den Befreiungskriegen gegen Napoleon (1813-1815).
Das Gedenkblatt wurde von der Familie mit einer einfachen Holzleiste gerahmt, die durch Gipsauftrag und einen wertvolle Hölzer imitierenden Anstrich repräsentativen Charakter gewann. Später wurde das Bild wohl in feuchten Kellerräumen gelagert, weshalb die Gipsschicht vor allem unten abgeplatzt ist.
Das Bild zeigt einen gefallenen und aufgebahrten Soldaten naturalistisch, aber auch die Trauer um ihn sowie tröstende Elemente. Wie in einem Epitaph nennt es in einem Schriftfeld den Verstorbenen und die wesentlichen Umstände des Gedenkens: „Zum Gedächtnis an / GOTTLOB METZGER / Musketier i. württ. Infanterie-Regiment Nr. 120. / Er starb fürs Vaterland am 23. September 1914.“. Daneben die Unterschrift des württembergischen Königs, ebenfalls gedruckt: „Wilhelm“.
Auf dem Wiesenstück, das die Schrifttafel umgibt, liegt der Tote quer über die ganze Breite des Bildes auf dem Rücken, in Uniform, der Großteil des Körpers ist aber mit einer Decke umhüllt. Hinter ihm stehen rechts zwei Kameraden, links die Eltern und die Braut. Zwischen diesen beiden Gruppen leuchtet unter dem württembergischen Motto „FURCHTLOS UND TREW“ (das auch das Koppelschloss der Soldaten aus Württemberg zierte) in der Bildmitte eine fahle aufgehende Sonne.
Natürlich sind es nicht die wirklichen Familienangehörigen und die wirklichen Kameraden. Hier wurde in einem massenhaft hergestellten Druck das Idealbild der Trauer um einen Sohn und Freund zusammengefasst. Dazu gehört die vaterländisch korrekte württembergisch-deutsche Einordnung, die mit den dargestellten Wappen des Königreichs Württemberg (links) und des Deutschen Reichs (rechts) sichergestellt werden. Zwischen diesen kniet auf einer Wolke ein an seinen Flügeln als Engel erkennbares Wesen, das einen Eichenkranz so in den Händen hält, als wollte es ihn neben den Toten niederwerfen.
Die Szenerie ist in gedeckten und kühlen Farben gehalten und erscheint in ihrer Zusammenstellung unzusammenhängend, enthält aber die zeittypischen nationalen und emotionalen Elemente der Trauer um einen Gefallenen. Sie weist kaum christliche Andeutungen auf, jedoch mit der Sonne und dem nationalen Ehrenkranz deutlich sinnstiftende Elemente für den Tod im Felde.
September 2014 - Kopfschutz: Artilleriehelm, "Pickelhaube"
52x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Artilleriehelm, "Pickelhaube", um 1900
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 001999)

Es war eine höchst eigenartige Silhouette, die den deutschen Soldaten zu Beginn des Ersten Weltkrieges kennzeichnete. Sie wurde von einer Kopfbedeckung bestimmt, die eine Mehrheit der fast 4 Millionen Männer, die im Sommer 1914 mobilisiert wurden, zu tragen hatte: offiziell als „Helm mit Spitze“ bezeichnet, kennt sie doch jeder unter dem spöttischen Namen „Pickelhaube“. Schon vor dem Krieg war dieser Helm, ungeachtet seiner internationalen Verbreitung, zum Symbol für Preußen-Deutschland und den Militarismus geworden, die Karikaturen der alliierten Propaganda machten sie zum Stereotyp für den Deutschen schlechthin. Noch heute bedeutet eine mit den Händen geformte Pickelhaube in der internationalen Gebärdensprache „deutsch“.
Wo kam dieser für uns so merkwürdige Kopfschmuck her? Zuerst ist festzuhalten, dass es sich bei ihm um den Teil einer Uniform handelt. Die einheitliche, fest geregelte Bekleidung von Soldaten ist eine Erfindung der Neuzeit, die wir auf das späte 17. Jahrhundert datieren können; sie war gebunden an die Entwicklung dauerhafter militärischer Organisationen mit langfristig dienenden Soldaten, den Stehenden Heeren. Erst mit ihnen entstand auch ein Bedarf für zentral beschaffte Bekleidung. Das erklärt aber noch nicht, wofür Uniformen gebraucht wurden.
Wenn man vom Krieg und vom Kämpfen ausgeht, waren sie nichts Notwendiges. Der kriegspraktische Bedarf der Unterscheidung von Freund und Feind erforderte keine Uniform, wie viele Jahrhunderte belegen, in denen irgendwelche Zeichen am einzelnen Kämpfer oder der Gruppe ausreichten: aufgenähte Kreuze, farbige Schärpen oder Armbinden, Federn oder Laubbüschel.
Uniformen sind auch nur sehr bedingt als Funktionskleidung anzusehen, die etwa auf das Kämpfen, den Schutz vor Verletzungen oder das Ertragen rauher Witterung optimiert worden wäre. Diese elementaren Bedürfnisse der Träger spielten zwar auch eine Rolle, entscheidend für die Gestaltung der Uniform war der äußere Eindruck; sie war ein Element der visuellen Kommunikation. Ihre Wirkung hing ab vom kulturellen Wandel der Gesellschaft, von Mode und ästhetischen Maßstäben: sie bestimmten, was als Repräsentation staatlicher Macht ernst genommen, was als männliche Schönheit des Soldaten empfunden wurde.
So entstand auch der lederne „Helm mit Spitze“ als Ausdruck eines spezifischen Zeitgeschmacks. Als er 1842 in Preußen eingeführt wurde, war dies Ergebnis langjähriger Überlegungen und Experimente auf der Suche nach einer neuen Kopfbedeckung für Soldaten, wie sie in vielen Armeen angestellt wurden und zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen führten. Praktisch stellte er einen Kompromiss dar, indem er eine gewisse Schutzfunktion (gegen Säbelhiebe von oben) mit vergleichsweise angenehmen Trageeigenschaften verband: er war leichter und billiger als ein Metallhelm, haltbarer als die bis dahin getragenen hohen Filz-Tschakos und zudem wasserdicht. Optisch orientierte er sich an den Vorstellungen der Zeitgenossen von Helmen der Antike und an manchen orientalischen Formen, die im frühen 19. Jahrhundert populär waren, dazu bot er Platz für repräsentative Zierate.
Die „Pickelhaube“, die ihre Form im Lauf der Zeit veränderte, entwickelte sich zum internationalen Erfolg. So wurde sie, das preußische Modell imitierend oder bewusst variierend, zeitweilig von Schweden bis Italien, von Russland bis England und Südamerika getragen; in einigen Ländern gehört sie bis heute zur Paradeuniform.
In den Armeen, die das deutsche Reichsheer bildeten, wurden Uniformen und Ausrüstung nach der Reichsgründung 1871 dem preußischen Modell angeglichen. So kamen auch die Württemberger, die bisher eine Mütze getragen hatten, an die Pickelhaube, die aber durch das Staatswappen auf der Stirne unübersehbar als württembergisch gekennzeichnet war.
Als Europas Armeen 1914 in den Krieg zogen, war bereits viel über die Wirkung moderner Waffen bekannt, die sich in den Kriegen auf dem Balkan, in Afrika und Asien gezeigt hatte. So waren die bunten Röcke der deutschen Armeen seit 1907 für den Kriegsfall durch feldgraue Uniformen ersetzt worden, die blitzenden Helmzierate wurden durch einen Stoff-Überzug getarnt. Ihre Silhouette machte die Soldaten gleichwohl zur Zielscheibe, und die Pickelhaube bot keinerlei Schutzwirkung gegen Geschosse und Granatsplitter. Es dauerte anderthalb Jahre, bis 1916 der schwere Stahlhelm produziert wurde, der das Bild des „modernen“ Soldaten prägen sollte.
Vorbesitzer und Herkunft des Helms, der sich in den Sammlungen des Esslinger Stadtmuseums befindet, sind unbekannt. Es handelt sich um eine Sonderform des „Helms mit Spitze“, vulgo „Pickelhaube“, wie sie bei der Artillerie getragen wurde. Bei dieser Waffengattung wurde anstelle der typischen Spitze eine runde Kugel aufgeschraubt, was verhindern sollte, dass sich die Soldaten bei der Bedienung der Kanonen gegenseitig verletzten. Von diesem praktischen Gesichtspunkt abgesehen symbolisierte die Kugel die traditionellen Geschosse der Artillerie, Kanonenkugeln und Mörserbomben. Der Träger gehörte also einem Feld- oder Fußartillerie-Regiment an.
An der Silhouette des Helms und weiteren Details lässt sich ablesen, dass es sich um das vorletzte Modell handelt, das ab 1895 eingeführt wurde. Das Kopfteil, die aus gehärtetem Leder bestehende Kalotte, war im Vergleich zu den früheren Modellen nochmals niedriger geworden. Der tarnende Überzug wurde seit 1907 zur Felduniform getragen; es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Träger am Krieg 1914-1918 teilgenommen hat.
Als Kopfbedeckung einer Truppeneinheit der königlich württembergischen Armee trägt sie das aus Messing geprägte württembergische Wappen mit Löwe und Hirsch und der Devise „Furchtlos und Trew“ als „Beschlag“ auf der Stirnseite; außerdem ist auf der einen Seite eine schwarz-rote württembergische, auf der anderen die schwarz-weiß-rote Reichskokarde angebracht.
Der Helm ist kein so genanntes „Kammerstück“, das an die wehrpflichtigen Soldaten ausgegeben und nach Ende Ihrer Dienstzeit wieder eingezogen wurde. Dies beweist das Fehlen entsprechender Stempel. Vielmehr handelt es sich um ein privat erworbenes Exemplar. Neben den Offizieren (es handelt sich aber nicht um einen Offiziershelm) mussten sich auch die „Einjährig-Freiwilligen“, junge Männer mit höherem Schulabschluss, die nur eine verkürzte Dienstzeit zu absolvieren hatten, auf eigene Kosten ausrüsten. Auch bei den lange dienenden Berufssoldaten, Unteroffizieren zumeist, kam es oft vor, dass sie Uniform und Ausrüstung selbst kauften, um eine bessere Qualität und Passform zu erhalten. Bei der Mehrzahl der heute noch erhaltenen Uniformteile handelt es sich um solche privaten Fertigungen spezialisierter Hersteller, die in Familienbesitz überliefert wurden.
August 2014 - Kriegsbeginn: Extrablatt "Mobilmachung"
52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg
Extrablatt "Mobilmachung", August 2014
(Stadtarchiv Esslingen, Materialsammlung 1. Weltkrieg, Nr. 9)
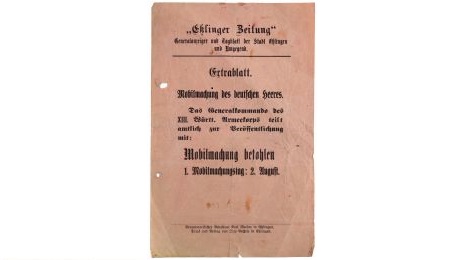
Das unscheinbare, etwa DIN A 4 große hellrote Blatt veränderte das Leben der 34 000 Einwohnerstadt grundlegend. Mit ihm wurde am 1. August 1914 in wenigen Zeilen verkündet: „Mobilmachung des deutschen Heeres. Das Generalkommando des XIII. Württ. Armeekorps teilt amtlich zur Veröffentlichung mit: Mobilmachung befohlen. 1. Mobilmachungstag: 2. August.“ Allen war klar: Dies bedeutete Krieg.
Wie viele andere Zeitungsverlage im Deutschen Reich nutzte auch der Bechtle Verlag dieses um die Jahrhundertwende erstmals in der Berliner Zeitungslandschaft erschienene Format, um die Bevölkerung über besondere und aktuelle Ereignisse zu informieren. Teilweise lagen die Extrablätter der Tageszeitungen bei, umfangreichere Ausgaben wurden gesondert verkauft. Umfunktioniert zum Plakat klebten sie auf Litfaßsäulen und wurden an öffentlichen Gebäuden ausgehängt. So auch am 31. Juli 1914. Diesmal waren es grüne Extrablätter der Eßlinger Zeitung, die am Rathaus, am Wolfstor, am Bezirkskommando und an mehreren Plätzen der Stadt angeschlagen, den „Kriegszustand“ bekannt gaben. Nun galt Kriegsrecht und die vollziehende Gewalt ging an das Generalkommando des XIII. Württembergischen Armeekorps mit Sitz in Stuttgart über.
Von dieser Instanz kam schließlich am nächsten Tag, dem 1. August, um 6.00 Uhr abends die Gewissheit: Die Bekanntgabe der deutschen Mobilmachung – und damit des Krieges – durch den Anschlag des roten Extrablattes. Zudem wurde die Nachricht, wie es die gesetzliche Form vorsah, durch den Ortsbüttel unter Trommelschlägen verkündet.
Wie im ganzen Deutschen Reich und in ganz Württemberg lief die Mobilmachung in Esslingen nach Plänen ab, die vor dem Krieg von den Militärs für den Kriegsfall ausgearbeitet worden waren. Die einberufenen Reservisten und Landwehrmänner, die dem Esslinger Bataillon des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 120 zugeordnet waren, meldeten sich beim Königlichen Bezirkskommando. Aus Kirchheim, Nürtingen und Urach, die in dessen Zuständigkeitsbereich gehörten, reisten weitere Männer mit Zügen an. Hinzu kamen 500 Freiwillige. Eingekleidet und ausgestattet wurden die Soldaten in Turnhallen und leer stehenden Schulgebäuden. Danach ging es in Kugels Saal zum Essen, anschließend unter Begleitung von Angehörigen zum Bahnhof. Zeitgenossen schildern die Stimmung als ruhig und ernst. Von einer „Augustbegeisterung“ war in Esslingen in den Mobilmachungstagen nichts zu spüren.
Über Stuttgart und weitere Stationen wurden diese Soldaten am 10. August ins Elsass gebracht. Bereits einen Tag zuvor fiel der erste Soldat aus Esslingen. Leutnant Kurt Klotz, ehemaliger Schüler des Gymnasiums, Mitglied des 8. Badischen Infanterie-Regiments, starb dort mit 20 Jahren. Viereinhalb Jahre später lautete die Bilanz: etwa 1500 gefallene Soldaten aus Esslingen und den Bezirksorten, hinzu kamen Tausende Kriegerwitwen, Waisen und Kriegsinvalide.
