Unsere Objekte vergangener Monate
Hier finden Sie alle Historischen Schätze seit Mai 2014.
Oktober 2024 - Porträt von Adolf Braungart (?)
Porträt von Adolf Braungart (?)
Johannes Braungart (1803-1849)
Ca. 1837/1838

Der Künstler Johannes Braungart (1803-1849) ist heute insbesondere für seine Esslinger Ansichten bekannt. In zahlreichen Gemälden und Skizzen hielt er in den 1830er und 1840er Jahren Straßen- und Mauerzüge sowie einzelne Gebäude fest, die später teilweise abgerissen wurden. Ohne seine Arbeiten wüssten wir deutlich weniger über das Stadtbild Esslingens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es wird vermutet, dass sein Interesse an der mittelalterlichen Bausubstanz im Zusammenhang steht mit seiner Freundschaft zum Historiker Karl Pfaff. Die Bedeutung seiner Arbeiten ist daher bei der Erforschung der städtebaulichen Entwicklung vor der Erfindung der Fotografie nicht zu unterschätzen. Sein Werk wurde bisher mit drei großen Themen umrissen: Architektur, Landschaft und Pflanzen. Porträts waren bislang nicht bekannt. Im Ausstellungskatalog zu einer Braungart-Schau des Stadtmuseums im Jahr 1999 heißt es noch: „Nie wagt Braungart sich ans Porträt heran.“
Nachfahren von Johannes Braungart haben jüngst den Städtischen Museen Esslingen eine Reihe von bislang unveröffentlichten Arbeiten Braungarts vorgelegt, die sich im Familienbesitz befinden. Darunter ist ein zauberhaftes Porträt, das höchstwahrscheinlich seinen erstgeborenen Sohn Adolf Braungart (1835– 1892) zeigt. Das annähernd quadratische, leicht stockfleckige Blatt ist nur etwa 17 auf 17 cm klein. Mit zarten Bleistiftstrichen sind Kleidung und Körper des Kindes, breitbeinig auf einem Kissen oder Polster sitzend, skizzenhaft angelegt. Das Gesicht hingegen ist – ebenfalls mit Bleistift – detailliert ausgearbeitet. Ernsthaft blickt das Kind dem malenden Vater bzw. dem Betrachter entgegen.
Auf der Rückseite des Blatts findet sich mit Bleistift der Satz „Adolf Braungart gezeichnet von seinem Vater J. Braungart.“ Diese Erklärung wurde sehr wahrscheinlich nachträglich ergänzt, da es sich augenscheinlich nicht um Johannes Braungarts Handschrift handelt. Unten links ist zudem mit Tinte und wiederum in einer anderen, „moderneren“ Handschrift der Name Paul Braungart vermerkt. Paul war der Sohn von Adolf und lebte von 1864 bis 1935.
Eine Jahreszahl ist auf dem Blatt nicht angegeben, doch aufgrund des geschätzten Alters des dargestellten Kindes könnte das Bild um 1837 oder 1838 entstanden sein (sofern es sich um Adolf handelt). Braungart hat bis auf wenige Ausnahmen seine Arbeiten nicht signiert und datiert. Die Zeichnung macht hier keine Ausnahme. Stilistisch passt die Skizze in das Œuvre Braungarts. Dass Braungart das Talent besaß, Porträts anzufertigen, zeigt das vorliegende Blatt. Warum nicht mehr derartige Arbeiten von ihm bekannt sind, muss offen bleiben.
Johannes Braungart wurde 1803 in Rottenacker (im heutigen Alb-Donau-Kreis) geboren. Als kurz nacheinander beide Elternteile starben, kamen Johannes und sein älterer Bruder ins Waisenhaus nach Stuttgart. Dort wurde sein Talent zum Zeichnen und Malen früh erkannt und gefördert. Nach Beendigung der Schule lernte er in der Metallwarenfabrik Carl Deffner in Esslingen das Bemalen von Dosen, Tellern und anderen Haushaltsgegenständen aus Blech. Nach Ende seiner Lehrzeit war er als freier Mitarbeiter weiterhin für die Firma Deffner tätig, doch auch privat zeichnete und malte er viel und bot in Esslingen auch Unterricht in diesen Disziplinen an.
Im Herbst 1834 heiratete Braungart Pauline Scheffauer, die Tochter des Bildhauers Philipp Jakob Scheffauer. Ihr Sohn Adolf erblickte 1835 das Licht der Welt, 1837 folgte Tochter Adelheid und 1839 Sohn Hermann. In den ersten Jahren lebte die kleine Familie in der Heugasse 15, später in der Fabrikstraße. Das Geld muss häufig knapp gewesen sein, wie man seinen Briefen entnehmen kann. 1849 starb Braungart infolge einer Lungenkrankheit.
Über Braungarts Wesen ist nicht viel bekannt. Aus den Briefen, die er und seine Frau sich schrieben, geht jedoch eine tiefe Zuneigung hervor. Vielleicht können wir die liebevolle Darstellung seines Kindes so interpretieren, dass er auch als Familienvater ein großes Herz hatte.
Ob sein Sohn Adolf, mit vollem Namen Johannes Adolf Eberhard Theodor Friedrich Braungart, das künstlerische Talent seines Vaters erbte, wissen wir nicht. Er blieb nicht in Esslingen: Nach seiner Dienstprüfung 1858 nahm er 1862 eine Pfarrstelle in Berneck an. Dort heiratete er Pauline Heuss; die beiden bekamen zwei Töchter und einen Sohn. 1892 verstarb Adolf Braungart in Althengstett.
September 2024 - Erinnerungsalbum
Erinnerungsalbum
Hertie Waren- und Kaufhaus-GmbH
Februar 1962 bis Dezember 1963
Städtische Museen Esslingen, STME 008364

Viel Selbstbewusstsein und ein bisschen Stolz sprechen aus dem großformatigen Album, in dem Hertie-Mitarbeiter:innen über zwei Jahre akribisch Zeitungsartikel, Fotografien und andere Erinnerungsstücke an „ihr“ Kaufhaus in der Esslinger Bahnhofstraße gesammelt haben. Mit dem Charme eines Familienalbums lässt es die Anfangsjahre 1962/63 und die (schon bald verblassende) Strahlkraft der großen Konsumtempel des 20. Jahrhunderts wiederauferstehen.
Ende der 1950er Jahre bewegte den Esslinger Gemeinderat die Frage, wie der Einzelhandel vor Ort mit dem großen Konkurrenzangebot der Stuttgarter City noch standhalten könne. Aus diesem Grunde sollte die neue Bebauung der Bahnhofstraße dazu dienen, wirtschaftliche Impulse zu geben. Der Entschluss, das Grundstück, auf dem sich der Städtische Saalbau befunden hatte, an die Hertie Waren- und Kaufhaus-GmbH zu verkaufen, wurde deshalb mit großer Mehrheit getroffen. Das Kaufhaus sollte dazu beitragen, die Innenstadt zu beleben.
Das Album beginnt mit Berichten der Esslinger Zeitung über das Voranschreiten des Baus im Jahr 1962. Die Begeisterung der Redakteur:innen ist spürbar, wenn Bauabschnitte geschafft werden und darüber, dass sich „eines der höchsten Gebäude unserer Stadt“ (EZ vom 17. August 1962) nun über die Bahnhofstraße erhebt. Es folgen verschiedene Anzeigen, in denen Dutzende Verkäufer:innen, Schaufenstergestalter:innen, Lehrlinge, Köch:innen und viele mehr gesucht werden, um das neue Kaufhaus in Betrieb zu nehmen.
Am 1. März 1963 fällt schließlich der Startschuss – um 9 Uhr öffnet „eines der modernsten Kaufhäuser Deutschlands“ (EZ vom 1. März 1963). Eine Einladungskarte für die Feier mit den Ehrengästen am Vortag bezeichnet das Kaufhaus gar als „Das neue Schmuckstück der Stadt“. Einige hundert Menschen warten am Morgen des 1. März vor den Türen und werden von acht Feuerwehrleuten hinter den Absperrungen gehalten. Um die Mittagszeit muss sogar die Polizei eingreifen, da der Andrang zu groß wird.
Ein besonderes Erinnerungsstück im Album ist eine Schallfolie zur Schau „Jugend International“ mit dem Musikstück „Davon träumen alle jungen Leute“ von Monika Grimm und René Kollo. Mit ihr bewarb Hertie seine erste Modenschau, die am 18. März 1963 im Scala stattfand und musikalisch von Bibi Johns, Greetje Kauffeld und anderen Musiker:innen begleitet wurde. Der Eintritt kostete 2 DM; eine Eintrittskarte findet sich zusammen mit Fotos von der Veranstaltung ebenfalls im Album.
Es folgen eine Reihe Werbeanzeigen („Ohne Kühlschrank geht es nicht!“) und Fotos von verschiedenen Schaufensterdekorationen und besonderen Aktionen („Von Tokio bis Neu-Delhi“, „Mensch oder Roboter? Worauf tippen Sie?“). Großformatige Fotografien der einzelnen Abteilungen zeugen davon, dass die Entbehrungen des Kriegs endgültig hinter den Stadtbewohner:innen lagen und wieder in Hülle und Fülle konsumiert werden konnte. Doch schon 30 Jahre später endete die „Ära Hertie“.
Das erste Warenhaus der Kaufleute Oskar und Hermann Tietz entstand 1882 in Gera. In den kommenden Jahren expandierte das Unternehmen und gründete zahlreiche Filialen. 1926 übernahm es vom Unternehmen A. Jandorf & Co. das legendäre Kaufhaus des Westens in Berlin, das KaDeWe. 1934 wurden im Zuge der so genannten Arisierung die Gesellschafter der jüdischen Familie Tietz gezwungen, aus dem Geschäft austreten. Nach 1945 wurden die westdeutschen Filialen wieder aufgebaut, neue kamen hinzu. Das Unternehmen florierte und profitierte vom Wirtschaftswunder. Es galt das Prinzip: Waren und Konsum für alle. In dieser Zeit entstand auch das Esslinger Kaufhaus. Doch in den 1980er Jahren gingen die Umsätze stark zurück und der Niedergang begann. 1993 wurde Hertie an die Karstadt AG verkauft. Heute, über drei Jahrzehnte später, hat das Konzept des Vollsortimenters aufgrund eines geänderten Konsumverhaltens weitestgehend ausgedient.
August 2024 - Modell einer Bettfedern-Reinigungsmaschine
Modell einer Bettfedern-Reinigungsmaschine
L. H. Lorch AG
Um 1930

Rund ein Drittel ihres Lebens verbringen die Deutschen durchschnittlich mit Schlafen. Ein optimaler Schlaf zeichnet sich dabei vor allem durch Ruhe und Wärme aus. Die Firma H. Lorch beschäftigte sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts mit dieser Thematik. In ihrer Jubiläumsschrift zum 75-jährigen Bestehen der Firma 1952 bezeichnete sie sich daher als „Maschinenfabrik im Dienst am Bett“. Doch was war genau das Verdienst des Unternehmens, welches 1877 in Bad Cannstatt gegründet wurde und 1903 nach Esslingen in das Gebäude der ehemaligen Hardtmann’schen Tuchfabrik an der Maille zog?
Der Firmengründer Ludwig Hermann Lorch verdiente sein Geld ursprünglich als beratender Zivilingenieur. Als solcher arbeitete er des Öfteren für Bettfedernhersteller. Er erkannte, dass es bei der Aufbereitung von Bettfedern noch deutliches Verbesserungspotenzial gab. Vor allem die Reinigung der Rohfedern, die aus hygienischen Gründen unabdingbar ist, erfolgte noch viel zu umständlich. Die maschinelle Aufbereitung und Pflege war noch nicht möglich. Diese Marktlücke nutzte der Tüftler aus und wagte im Alter von 26 Jahren den Schritt vom Berater zum Konstrukteur und Hersteller von Maschinen für die Bettfedernindustrie. Sein Mut sollte sich auszahlen. Die Firma wuchs schnell und beschäftigte bereits 1899 zwanzig Mitarbeiter am Standort in Bad Cannstatt. Vier Jahre später folgte der Umzug nach Esslingen in ein größeres Fabrikgebäude, das die Möglichkeit der Nutzung von Wasserkraft bot. Anfang des 20. Jahrhunderts zeichnete sich das Unternehmen auch als Arbeitgeber aus, der einen Großteil seiner Belegschaft selbst ausbildet. Das Modell einer Bettfedern-Waschmaschine legt hiervon Zeugnis ab. Es wurde um 1930 als Lehrlingsarbeit hergestellt. Wer genau der oder die Entwickler:in war, ist jedoch nicht bekannt.
Bereits in den ersten Jahren des Bestehens der Firma L. H. Lorch gehörten Bettfedern-Waschmaschinen zum Produktportfolio. In der Aufbereitung von Bettfedern spielen sie eine wichtige Rolle. Die Rohfedern werden in der Produktion zunächst durch Aussieben und Entstäuben von trockenen Verunreinigungen wie Sand und Steinchen befreit. Durch das Waschen wird anschließend der übrige Schmutz aus den Federn gelöst. Spätere Maschinen aus dem Hause Lorch waren im Gegensatz zum Lehrlingsmodell zylindrisch. Bei den restlichen Elementen gleicht das Modell jedoch seinen großen Geschwistern.
Bettfedern-Waschmaschinen von Lorch waren mit einem Rührwerk für eine schonende Reinigung der Federn ausgestattet. Der untere Teil ist mit einem Sieb ausgelegt, unter welchem sich der Ablauf für das Schmutzwasser befindet. Die gereinigten Federn gelangten über einen Auslauf an der Stirnseite in die angeschlossene Zentrifuge, in welcher die Federn getrocknet wurden. Da die Bettfedern nach der Zentrifuge jedoch noch immer 35-40% Feuchtigkeit enthielten, erfolgte eine weitere Trocknung und Sterilisation in Dämpf- und Trockenapparaten. Sortiermaschine übernahmen schließlich den letzten Arbeitsschritt, bei welchem die Federn durch fein einstellbare Luftströme nach ihrer Größe und Dichte eingeteilt wurden.
Jeder dieser Vorgänge konnte durch eine Maschine von L. H. Lorch durchgeführt werden. Später kamen dann noch Geräte zum Abfüllen der Bettfedern in Säcke sowie Reinigungsmaschinen für die regelmäßige Pflege. Mit diesem Produktportfolio konnte sich das Esslinger Unternehmen dauerhaft am Markt etablieren und war sehr erfolgreich. Hiervon zeugen nicht nur zahlreiche Patentanmeldungen, sondern auch Aufträge aus der ganzen Welt. Kund:innen aus China, Russland, Kanada, Südafrika, Australien und den USA führten zur Einführung einer Weltkugel im Firmenlogo. Trotz allem musste die L. H. Lorch AG Ende der 1990er Jahre Konkurs anmelden und wurde 2001 aufgelöst.
Juli 2024 - Fotoalbum mit Bildern der Armenspeisung der Aargauer Küchen
Fotoalbum mit Bildern der Armenspeisung der Aargauer Küchen
Januar/Mai 1924
Stadtarchiv Esslingen, Fslg. 10709

Vor 100 Jahren war Deutschland ein Notstandsgebiet. Der verlorene Weltkrieg hatte neben Trauer und Wut politische, soziale und wirtschaftliche Verwerfungen hinterlassen. Bereits im Krieg hatte eine rasante Geldentwertung eingesetzt. Sie beschleunigte sich aufgrund der enormen Kriegsschulden und Reparationslasten nach 1918 und mündete in Folge der französischen Besetzung des Ruhrgebietes 1923 in eine Hyperinflation, den Kollaps der Währung. Die lokalen Auswirkungen lassen sich in den Esslinger Gemeinderatsprotokollen fassen. Geldwirtschaft und Versorgungskreisläufe stockten. Weil kaum einer bereit war, Ware gegen wertloses Papier abzugeben, wurde es immer schwieriger, die Bevölkerung mit dem Nötigsten wie Mehl, Kartoffeln, Milch oder Kohle zu versorgen. Im November 1923 stabilisierte eine Währungsreform die Lage. In altem Papiergeld angesammelte Ersparnisse waren aber verloren, und die auf die neue Rentenmark umgestellten Löhne, Gehälter und Renten lagen kaufkraftbereinigt empfindlich unter dem Niveau der Vorkriegsjahre. Auf durchschnittlich 40 % schätzte die Esslinger Stadtverwaltung das Minus für ihre Beschäftigten.
Das gezeigte Fotoalbum gehört in den beschriebenen Katastrophen-Zusammenhang. Spenderinnen und Spender aus dem Schweizer Kanton Aargau hatten es ermöglicht, in Esslingen von Januar bis Mai 1924 vier Not-Küchen zu betreiben. Sie wurden im Lutherbau des CVJM, im Neuen Ritter, damals ein Lokal der Abstinenzbewegung, in der eigentlich für Wanderarbeiter bestimmten Herberge zur Heimat am Kronenhof und im evangelischen Gemeindehaus Oberesslingens eingerichtet. Die nötigen Suppenzutaten, insgesamt 12.725 kg, lieferte das von dem Aarauer Pfarrer René Gloor geleitete Aargauer Hilfskomitee. Auf Esslinger Seite war das städtische Wohlfahrtsamt federführend, das einen Kreis von Ehrenamtlichen mobilisierte. Am Ende der Aktion waren fast 103.000 Liter-Portionen Suppe ausgegeben worden.
Die Aufnahmen in dem Album, das erst im vergangenen Jahr vom Stadtarchiv Esslingen angekauft werden konnte, dokumentieren die in den Lokalen geleistete Arbeit, dazu Lagerung und Transport der Lebensmittel. Die Fotos waren vom Aargauer Hilfskomitee zu Pressezwecken in Auftrag gegeben worden. Adolf Murthum nutzte Abzüge für mindestens drei Alben. Das hier gezeigte Exemplar ging als Ehrengabe der Stadt an die Leiterin der Not-Küchen, Lena Mayer-Benz, eine frauenpolitisch profilierte Esslingerin. Den Aargauern dankte die Stadtverwaltung mit einer Ansicht Esslingens, die bei dem Kunstmaler Karl Fuchs in Auftrag gegeben wurde. Am 10. Januar 1925 wurde das Gemälde von Esslingens Bürgermeister Max Mülberger in Aarau feierlich der Kantonsregierung übergeben.
Die Aargauer Küchen sind nur ein Beispiel für die umfangreiche Schweizer Nothilfe vor 100 Jahren. Sie begann mit der Aufnahme von 120.000 mangelernährten, oft tuberkulosekranken Kindern und Jugendlichen aus Deutschland, Belgien und Frankreich in den Kriegsjahren. 1919 kam die Unterstützung deutscher und österreichischer Kinderheime hinzu. Schockierende Aufnahmen extremster Unterernährung hatten vor Augen geführt, dass es hier akut um Leben und Tod ging. Für die Küchen-Hilfe der Jahre 1923 und 1924 koordinierten sich die Hilfskomitees der gesamten Schweiz. Verabredet wurde eine Konzentration auf Süddeutschland. Die Aargauer unterstützen Esslingen, Reutlingen und Nürnberg, Zürich Stuttgart, Fribourg im Waadtland, Freiburg i. Br. u.s.w.
Gemessen an der Einwohnerzahl der Eidgenossenschaft übertraf die Schweizerhilfe das, was nach 1918 von den anderen großen Gebernationen, Schweden, den Niederlanden und den USA geleistet wurde. In absoluten Zahlen war aber die US-Hilfe am größten. Von den Schulspeisungen der amerikanischen Quäker profitierten 1921 und 1922 auch viele Esslinger Kinder.
Heute ist die damalige internationale Hilfe so gut wie vergessen. Sie wurde im kollektiven Gedächtnis von den Care-Paketen und Aufbauhilfen nach 1945 überlagert. Mancherorts erinnern aber noch Straßennamen, so die Schaffhausenstraße in Tübingen oder die Aaraustraße in Reutlingen, an die Schweizer-Küchen vor 100 Jahren.

Juni 2024 - Tretkurbelfahrrad oder Velociped
Tretkurbelfahrrad oder Veloziped
Eisen, Holz, Leder
Jakob Kottmann, Öhringen
Um 1870
(Städtische Museen Esslingen, STME 007719)

So wegweisend die Erfindung der Laufmaschine durch den badischen Forstbeamten Karl Drais im Jahr 1817 gewesen sein mag, richtig Fahrt nahm die Entwicklung hin zum Fahrrad erst auf, als die Laufmaschine Tretkurbeln bekam und damit den Fahrer vom Boden entkoppelte. Auf diese Idee kamen unabhängig voneinander mehrere Tüftler. Kommerziell erfolgreich wurden Tretkurbelfahrräder allerdings erst, als die französischen Kutschenbauer Pierre und Ernest Michaux ein Tretkurbelfahrrad auf der Weltausstellung 1867 in Paris vorstellten. Ein Jahr später begannen sie, dieses industriell zu produzieren.
Die Idee verbreitete sich rasch international und regte unzählige Nachahmer an. Oft waren es zunächst Stellmacher und Schmiede, die sich an der handwerklichen Produktion von Velozipeden versuchten. Velozipede haben einen massiven Rahmen aus schmiedefähigem Eisenguss. Eine aus Blattfedern bestehende, auf den Rahmen montierte Konstruktion trägt einen Sattel, der mittels Flügelschrauben auf der Längsachse verschiebbar ist, um die Sitzposition an unterschiedliche Körpergrößen anzupassen. Die mit der Nabe des Vorderrads verbundenen Tretkurbeln haben Kurbelarme mit variabler Pedalaufnahme, so dass die Kurbellänge und damit der beim Pedalieren beschriebene Kreis an unterschiedliche Beinlängen angepasst werden können. Da die Kurbeln ohne Freilauf starr mit der Nabe verbunden sind, drehen sie sich immer mit, wenn das Rad in Bewegung ist. Um beispielsweise bergab nicht ständig pedalieren zu müssen, können die Beine auf eine so genannte Fußruhe über dem Vorderrad abgelegt werden. Gebremst wird mit einem Hebel, der auf den Radreifen des Hinterrads drückt. Betätigt wird dieser mittels eines Seils, das über den drehbaren Lenker aufgewickelt und so gespannt wird. Eine Rückholfeder bringt den Bremshebel wieder in seine ursprüngliche Position.
Die Laufräder der ersten Velozipede waren wie Kutschenräder konstruiert und wiesen hölzerne Naben, Speichen und Felgen mit eisernen Radreifen auf. Kurze Zeit später kamen bereits kugelgelagerte Räder mit Metallspeichen und Metallfelgen mit Vollgummireifen auf den Markt. Innovationstreiber waren erste Radrennen in Frankreich gewesen. Die einzige technische Möglichkeit, höhere Geschwindigkeiten zu erzielen, war die Erhöhung des Umfangs des Antriebsrads. Deshalb wurden diese immer größer und die hinteren Räder immer kleiner: Die sogenannten Hochräder der 1880er Jahre waren gewissermaßen die Rennräder ihrer Zeit. Erst als der Hinterradantrieb mittels Fahrradkette erfunden wurde, erhielt das Fahrrad seine heutige Form. Velozipede und Hochräder waren damit technisch überholt.
Das Veloziped aus der Museumssammlung des Esslinger Geschichts- und Altertumsvereins lässt sich mit großer Sicherheit der Firma Jakob Kottmann in Öhringen zuordnen, die vor allem Landmaschinenherstellte und um 1870 auch mit der Produktion von Tretkurbelfahrrädern begann. Man erkennt sie an den nur für die Firma Kottmann nachweisbaren charakteristischen Rosettenpedalen mit ihren an gotische Rundfenster erinnernden durchbrochenen Flanken. Ob der nach vorne weisende, vierkantige und mit einer Bohrung versehene Sockel am Steuerrohr die Aufnahme für eine nicht mehr erhaltene Fußruhe oder eher für eine Lampe gewesen ist, ist unklar. Gegen eine Aufnahme für eine Fußruhe spricht, dass diese normalerweise aus gutem Grund kein angeschraubtes Teil, sondern eine horizontal verlaufende Fortsetzung des Rahmens war: Schließlich mussten sie 40% des Körpergewichts des Fahrers tragen können. Eine angeschraubte Konstruktion wäre somit möglicherweise nicht stabil genug gewesen. Der Radumfang des Vorderrads beträgt 2,90 Meter, was bei einer Trittfrequenz von 40 bis 70 Umdrehungen pro Minute auf eine Geschwindigkeit von 7-14 km/h schließen lässt - solange es nicht bergauf ging, denn mit 28 kg wiegt das Veloziped annähernd das Doppelte eines heutigen Alltagsfahrrads und das Eineinhalbfache eines Pedelecs.
Wie das Veloziped seinen Weg von Öhringen nach Esslingen gefunden hat, bleibt unklar. Eine Fahrradindustrie mit entwickelten Vertriebsstrukturen und Händlernetz gab es um 1870 noch nicht. Velozipedisten und Velozipedistinnen waren zu dieser Zeit sicher kein gewöhnlicher Anblick auf den Straßen in und um Esslingen. Es dauerte noch mehr als ein Vierteljahrhundert, bis sich erste Fahrradhändler und Reparaturwerkstätten in Esslingen etablierten. Es waren zunächst Schlosser, Mechaniker und Uhrmacher, die neben Nähmaschinen auch Fahrräder anboten und reparierten und ab 1898 Eingang in die Adressbücher der Stadt fanden.
Mai 2024 - Löscheimer von I. K.
Löscheimer von I. K.
Esslingen
1700 (?)
(Städtische Museen Esslingen)

Hat dieser Eimer den Stadtbrand von 1701 erlebt und überlebt? Über Jahrhunderte gehörten Löscheimer in jeden Haushalt und jede Werkstatt. Brände waren in den mittelalterlichen und neuzeitlichen Städten sehr gefürchtet, denn durch die enge Bebauung aus leicht brennbaren Materialien wie Holz und Stroh konnten sich Feuer rasend schnell ausbreiten. Zur Vermeidung von Bränden und zur Regelung der Brandbekämpfung hatte auch die Reichsstadt Esslingen spätestens ab dem Ende des 15. Jahrhunderts eine Feuerordnung, die regelmäßig überarbeitet und angepasst wurde. Dennoch konnte auch sie nicht die große Brandkatastrophe von 1701 verhindern.
Doch zunächst zum Eimer. Er ist aus mehreren Lederschichten gefertigt; die einzelnen Teile sind fest miteinander vernäht. Seine Stabilität erhält das Behältnis durch ein hölzernes Grundgerüst. Eine breite Lederschlaufe dient als Henkel und Aufhängevorrichtung. Manche Löscheimer hatten eine zusätzliche Handhabe an der Unterseite, um das Gefäß beim Ausgießen besser greifen zu können. Bis zum Rand mit Wasser gefüllt, fasste dieser Eimer rund fünf Liter. Bei einer Eimerkette wurden Dutzende der Eimer durchgereicht, um so das Feuer rasch unter Kontrolle zu bekommen.
Wichtig bei Löscheimern war die namentliche Kennzeichnung. Sie diente nach dem Ende eines Löscheinsatzes dazu, die Behältnisse ihren Eigentümer:innen zurückzugeben. Dieser Eimer zeigt die Initialen I. K. sowie die Jahreszahl 1700. Die Buchstaben und Ziffern sind auf einer kleinen Plakette eingetieft, die mit zwei Nieten am Eimerrand befestigt ist. Um wen es sich bei I. K. gehandelt hat, lässt sich heute nicht mehr ermitteln. Die Jahreszahl 1700 lässt aufhorchen: War dieser Eimer ein Zeitzeuge des Brandes von 1701? Die Voraussetzung dafür wäre, dass die Plakette schon immer zu diesem Eimer gehörte und nicht erst nachträglich angebracht wurde. Der Schriftzug „Esslingen“, der sich direkt auf der Lederhülle befindet, passt nämlich auch gut ins 19. Jahrhundert.
Gehörte die Plakette wirklich zu diesem Eimer, so konnte I. K. nicht ahnen, dass dieses Behältnis nur ein Jahr später bei einem der verheerendsten Ereignisse der Esslinger Stadtgeschichte zum Einsatz kommen könnte: dem berüchtigten Stadtbrand. Am 25. Oktober brach in der Herberge „Zum Schwarzen Adler“ beim Hafenmarkt ein Feuer aus und griff rasch auf die benachbarten Gebäude über. Trotz großer Bemühungen, mit Unterstützung der umliegenden Städte das Feuer einzudämmen, loderte es 36 Stunden und zerstörte mehr als 200 Gebäude, darunter auch das Rathaus der Reichsstadt. Die Brandursache wurde nie aufgeklärt.
Aus der Katastrophe zogen die Esslinger:innen ihre Lehren. Da vor allem die enge mittelalterliche Bebauung für die schnelle Ausbreitung des Feuers gesorgt hatte, wurden die neuen Straßenzüge breiter angelegt. Zudem errichteten die Baumeister deutlich größere Häuser im Barockstil. Um die enormen Kosten für den Wiederaufbau stemmen zu können, erhielt die Stadt die Genehmigung, eine reichsweite Kollekte durchzuführen. Bis nach Hamburg, Breslau, Wien und in die Schweiz wurden Sammler entsandt. Viele Städte und Stände spendeten für den Wiederaufbau der Reichsstadt, wobei sich Ulm und Augsburg am großzügigsten zeigten und Esslingen jeweils 900 Gulden zukommen ließen.
Die im Jahr 1700 bereits 28 Seiten umfassende Verordnung, „wie es in vorfallenden Feuers Nöthen in und außerhalb der Statt gehalten werden soll“, wurde weiterhin regelmäßig geprüft und überarbeitet. Dazu gehörte auch die Anschaffung von ledernen Schläuchen, wie man sie von den Stuttgarter Helfern beim Löscheinsatz in Esslingen kennengelernt hatte. Weiterhin hatte im Falle eines Brandes jede:r Einwohner:in einen nach Alter, Berufsstand oder Zunft festgelegten Platz und Aufgabenbereich. Das änderte sich erst im 19. Jahrhundert, als die Einwohnerschaft nicht mehr in Zünften organisiert war und eine neue Regelung gefunden werden musste. Durch die fortschreitende Industrialisierung mit neuen Energiequellen und durch den Einsatz von leicht entzündlichen Rohstoffen waren insbesondere die Fabrikanten „Lobbyisten“ für eine Feuerwehr in Esslingen. 1847 wurde in der Maschinenfabrik Esslingen die Werksfeuerwehr eingerichtet. Fünf Jahre später, 1852, erfolgte schließlich die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Esslingen.
April 2024 - Volksempfänger
April 2024 - Radio Volksempfänger 301W
Radio Volksempfänger 301W
Ca. 1934
(Städtische Museen Esslingen)

Das Zeitalter des Radios in Deutschland hatte kaum zehn Jahre zuvor begonnen, als der Rundfunk ab 1933 von den Nationalsozialisten vereinnahmt und für deren Propagandazwecke radikal umgestaltet wurde. Radiosendungen waren ein Schlüssel zur erfolgreichen ideologischen Durchdringung der Gesellschaft. Das vielleicht erfolgreichste Produkt der NS-Zeit überhaupt war hierbei ein Radioempfänger für die Massen – der so genannte Volksempfänger. Selbst seine technische Produktbezeichnung ist propagandistischer Natur: Das Kürzel VE steht für Volksempfänger. Die Zahl 301 erinnert an den 30. Januar 1933, den Tag an dem Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde.
Konstruiert wurde das Gerät von Otto Grießing, dem Chefentwickler der Firma Seibt in Berlin. Das Gehäuse wurde von Walter Maria Kersting, Professor für künstlerische und technische Formgebung der Kölner Werksschulen, entworfen. Es besteht aus Bakelit, einem frühen
Kunststoff. Der VE 301, den es in Ausführungen für Wechselstrom (gekennzeichnet mit dem Kürzel W wie bei dem vorliegenden Gerät), Gleichstrom und Batteriestrom sowie Allstrom gab, war das erste Volksempfänger-Modell, später kamen noch der günstigere Kleinempfänger
DKE, im Volksmund Goebbels-Schnauze genannt, und der Arbeitsfrontempfänger DAF zur Beschallung von Betrieben auf den Markt. Praktisch alle Radiohersteller wurden dazu verpflichtet, diese Geräte zu produzieren.
Auch in Esslinger Haushalten hielten Rundfunk und der Volksempfänger Einzug. Während 1927 im Esslinger Adressbuch nur ein einziger Radiohändler verzeichnet ist („Eberspächer“ in der Inneren Brücke 12), erhöht sich die Anzahl innerhalb von 10 Jahren auf 19 Händler
im Jahr 1937. Ein Blick in die Adressbücher aus den 1930er Jahren vermittelt dabei auch, dass Radiohören in den Anfangsjahren einiges technisches Verständnis erforderte. Esslingens Radiohändler führten überwiegend auch Radio-Bauteile und Ersatzteile aller Art oder waren, wie die Firma Hirschmann mit ihren Antennen, auf einzelne Bauteile spezialisiert. Des weiteren fällt auf, dass das Laden von Akkus besonders beworben wurde. Offensichtlich war dies eine erforderliche und damit wirtschaftlich sinnvolle Dienstleistung, die ein Indiz dafür sein mag, dass auch an Orten ohne Elektrizität Radio zum Beispiel mit dem batteriebetriebenen VE 301B gehört wurde.
Der VE301 wurde im August 1933 auf der 10. Großen Funkausstellung in Berlin vorgestellt und kostete 76 Mark. Die Parole „Ganz Deutschland hört den Führer“ formulierte unmissverständlich den Anspruch, die ideologische Gleichschaltung der Deutschen praktisch bis in jedes Wohnzimmer zu tragen. Binnen weniger Monate waren 200.000 Geräte verkauft. Ausländische Sender wie Radio London, die sich an deutsche Radiohörer:innen richteten, sendeten auf Kurzwelle. Dies stellte insbesondere Radio-Amateure, die sich ihre Ausrüstung oft aus Bausätzen selbst zusammengebaut hatten, vor keine großen Hürden. Auch die Volksempfänger konnten mit relativ einfachen Mitteln modifiziert werden.
Mit Kriegsbeginn wurde das Hören von feindlichen Sendern verboten. In der „Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen“ vom 1. September 1939 wurden Zuwiderhandlungen als „Rundfunkverbrechen“ und Täter als „Volksverräter“ bezeichnet. Zuchthausstrafen
und in schweren Fällen sogar die Todesstrafe sollten die Bevölkerung einschüchtern und abschrecken. Ab 1941 kontrollierten Blockwarte Privatwohnungen und brachten an den Radiogeräten Pappetiketten an, die das Abhören von ausländischen Sendern als Verbrechen gegen die nationale Sicherheit bezeichneten. Für die Jahre 1939 bis 1942 verzeichnete die Reichskriminalitätsstatistik rund 2.700 so genannte Rundfunkverbrechen für Deutschland.
März 2024 - Selterswasserflaschen
März 2024 - Selterswasserflaschen
Selterswasserflaschen
Steinzeug
19. Jahrhundert
(Städtische Museen Esslingen, STME 008319.1-4)

In den Jahren 1978/79 wurde der Gebäudekomplex des heutigen Stadtmuseums umgebaut. Die beiden Häuser sind seitdem durch ein gemeinsames Treppenhaus miteinander verbunden. Für die erforderlichen Baumaßnahmen benötigten die Statiker:innen und Architekt:innen neue, genauere Pläne. Aus diesem Grunde wurde das Stadtmessungsamt der Stadt Esslingen beauftragt, die Gebäude vom Keller bis zum Dachfirst, Stockwerk für Stockwerk zu vermessen. Dabei fand man in einem Kellerraum des Hauses Hafenmarkt 7 eine große Anzahl an Steinzeugflaschen.
Es handelt sich um sogenannte Selterswasserflaschen. Der Name leitet sich ab aus dem Namen der Ortschaft Niederselters, welche ab dem 17. Jahrhundert durch ihre Mineralquellen überregional bekannt war. Neben der großen Kuranlage mit Badeanstalten und Hotels begründete sich die Popularität vor allem auf die Abfüllung des Heilwassers in Flaschen und den anschließenden Export. Der massenhafte Vertrieb des Wassers – zu Hochzeiten 1856 wurden über zwei Millionen Flaschen verkauft – ließ das Selterswasser zum Markenartikel werden und gab den für den Transport so typischen Flaschen ihren Namen. Der Absatzmarkt beschränkte sich dabei nicht nur auf den deutschen Raum. Funde aus den Niederlanden, Irland, den USA und Indonesien zeugen vom internationalen Erfolg der Mineralwasserquelle.
Die therapeutische Wirkung von Mineralwasser wurde seit Ende des 16. Jahrhunderts von Ärzten erkannt, die sowohl Bade- als auch Trinkkuren empfahlen. Große Probleme bereitete aber lange Zeit der Transport, denn das Wasser wurde schnell ungenießbar und verlor somit auch die heilende Wirkung. Der Abfüllung in Fässern und in Tonkrügen folgte schließlich die Möglichkeit mit Flaschen aus Steinzeug und einem Korkenverschluss. Im 19. Jahrhundert, als der Versand von Heilwasser Hochkonjunktur hatte, wurden zylindrische Flaschen gefertigt, die wesentlich platzsparender und auch besser gegen Transportschäden zu schützen waren.
Bei den im Keller gefundenen Selterswasserflaschen stammen zwei aus Niederselters. Diese weisen jedoch einen unterschiedlichen Stempel des Quellortes auf, wodurch eine Datierung der Flaschen möglich wird. Die ältere der beiden stammt aus der Zeit zwischen 1836 und 1866. In diesem Zeitraum prangte der Löwe des Herzogtums Nassau, in dessen Herrschaftsgebiet sich Niederselters befand, auf dem Stempel. Als Nassau 1866 an Preußen fiel, änderte sich auch das Emblem der Mineralwasserquelle. Fortan trat an die Stelle des Löwen der preußische Adler, welcher auf der zweiten Flasche aus Niederselters zu sehen ist. Der gerippte Flaschenhals deutet auf eine Entstehungszeit nach 1870 hin, denn zu diesem Zeitpunkt kamen Metallverschlüsse für die Flaschen auf, welche von den Rippen festgehalten wurden. Die beiden anderen Flaschen stammen aus Göppingen und Bad Ditzingen und somit aus der näheren Umgebung Esslingens. Beide sind in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zu datieren.
Wie das Heilwasser seinen Weg in den Keller des heutigen Stadtmuseums fand, ist unklar. Jedoch lassen sich einige Theorien aufstellen, denn im in Frage kommenden Zeitraum lebten einige Bewohner:innen im Haus Hafenmarkt 7, die sich in schlechter gesundheitlicher Verfassung befanden, gleichzeitig aber finanziell in dazu der Lage waren, sich teures Heilwasser zu kaufen. Hier ist zunächst Jakob Ferdinand Schreiber zu nennen, der 1867 einem schon lange vorhandenen Brustleiden erlag. Seine Enkelin Johanna, die Tochter des Komponisten Christian Fink, erkrankte bereits in jungen Jahren an einem Hirntumor, durch welchen sie im Alter von 33 Jahren verstarb. Auch von ihrer Mutter Rosa Fink sind lange Kuraufenthalte in Heilbädern bekannt. Es bleibt jedoch bei reinen Spekulationen. Warum die leeren Flaschen auch noch rund 100 Jahre nach ihrer Entstehung gefunden werden konnten, ist hingegen leicht zu erklären: Der Transportaufwand für einen Rücksendung zum Quellort war zu groß, sodass die Flaschen oft für selbstgemachte Getränke weiterverwendet wurden.
Februar 2024 - Pain Expeller der Schwanen-Apotheke
Februar 2024 - Pain Expeller der Schwanen-Apotheke
Pain Expeller der Schwanen-Apotheke
Glas, Papier, Kork
Um 1890
(Städtische Museen Esslingen, STME 007381)

„Dieses vorzügliche Präparat wird seit langen Reihen von Jahren als wirksamstes Hausmittel Aeusserlich angewendet.“ Mit dieser Beschreibung warb der Esslinger Apotheker Wilhelm Häberlen für ein von ihm hergestelltes Heilmittel, ein sogenannter Pain Expeller („Schmerzvertreiber“). Als Pain Expeller wurden verschiedene Präparate bezeichnet, die als Universalmittel gegen jegliche Art von Krankheit helfen sollten. Diese Wundermittel erfreuten sich Ende des 19. Jahrhunderts größter Beliebtheit.
In Esslingen gab es jahrhundertelang lediglich drei Apotheken, welche die medizinische Versorgung der Reichs- und späteren Oberamtsstadt sicherstellten. Eine dieser Apotheken war die Schwanen-Apotheke, welche sich bis 2014 am Marktplatz 25 befand. Das Gebäude war 1718 vom Apotheker Johann Adam Wiedersheim gekauft worden, der damit die rund 300jährige Tradition als pharmazeutisches Gebäude begründete. Wilhelm Häberlen kam in den 1880er Jahren in den Besitz des Gebäudes.
Die Rezeptur des von Häberlen entwickelten Fabrikats ist nicht bekannt. Sein Pain Expeller „Made in Esslingen“ musste laut dem Etikett des Fläschchens mit Öl oder Branntwein vermischt und an die schmerzenden Stellen eingerieben werden. Eine weitere Möglichkeit bestand darin, das Präparat mit Wasser zu verdünnen und als Umschlag anzuwenden.
Häberlen war mit seiner Erfindung eines Wundermittels nicht allein. Der wohl berühmteste Pain Expeller wurde von der chemisch-pharmazeutischen Firma F. A. Richter im thüringischen Rudolstadt hergestellt. Der Firmengründer Friedrich Adolf Richter (1846-1910) war gelernter Drogist, betrieb jedoch seit 1869 einen Kolonialwarenladen in Duisburg. Hier hatte er zunächst den aus den USA stammenden Pain Expeller Dr. Radways Ready Relief vertrieben, welchen er u.a. als bestes Mittel gegen Cholera, rote Ruhr und Diarrhoe bewarb. Kurz darauf nahm er mit dem Cherwy’s Cordial Drink einen weiteren Pain Expeller in sein Produktportfolio auf, der gegen alle als unheilbar geltenden Krankheiten helfen sollte. Nach der Übersiedelung nach Rudolstadt brachte Richter schließlich sein eigenes Wundermittel auf den Markt. Der sogenannte Anker Pain Expeller bestand aus spanischem Pfeffer, Kampfer, medizinischer Seife, Salmiakgeist, Alkohol und verschiedenen ätherischen Ölen. Er verkaufte sich deutschlandweit und trug maßgeblich zur Popularität der Arznei in Deutschland bei, die bald in keinem Haushalt mehr fehlen durfte.
Die Apotheker in Deutschland reagierten auf das Wundermittel aus dem Hause Richter gemischt. Pharmazeutische Fabriken waren erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden. Zuvor stellten die Apotheken ihre Produkte selber her und vertrieben diese alleinig. Die versprochene Wirkung des Pain Expellers wurde in Fachkreisen ohnehin schon lange angezweifelt. Dementsprechend sahen viele Apotheker durch den Verkauf des Wundermittels in ihren Geschäften den Ruf der Branche in Gefahr und lehnten es strikt ab, Geheimmittel von pharmazeutischen Fabriken zu verkaufen. Um die große Nachfrage nach diesen Mitteln trotzdem befriedigen zu können, bot sich die Eigenproduktion in den Apotheken an. Dieser Weg wurde auch in Esslingen eingeschlagen.
Für Wilhelm Häberlen rechnete sich die Herstellung eines eigenen Pain Expellers nicht. Zu groß war vermutlich die Konkurrenz aus den pharmazeutischen Fabriken. Um 1894 verkaufte er die Schwanen-Apotheke an Benjamin Krauß. Der Erfolg der Pain Expeller im Allgemeinen hielt hingegen an. Noch während des Zweiten Weltkriegs erfreute der Anker-Pain-Expeller sich großer Beliebtheit, indem er als Heilmittel gegen Rheuma und Erkältungskrankheiten eingesetzt wurde. Bis 1997 war das Wundermittel in der BRD noch im Handel erhältlich, zuletzt jedoch ohne den Zusatz von spanischem Pfeffer.
Januar 2024 - Nähbuch von Mathilde Jacob
Januar 2024 - Nähbuch von Mathilde Jacob
Buch „Hand- und Maschienen=Nähen“ und Schnittmusterteile
Mathilde Jacob
Papier, Pappe
1892-1903
(Städtische Museen Esslingen, STME 008296)

Wer Kleidung trägt, sollte nähen können – das galt lange Zeit für weite Teile der Bevölkerung. Ob von Hand oder später mit der Nähmaschine, das Nähen gehörte in jeden Haushalt. Oft war es Frauensache. Das vorliegende Buch ist das Pendant zu einem handgeschriebenen Kochbuch, in dem eine Hausfrau in vergangenen Zeiten ihre erprobten Rezepte notierte – nur dass es sich hierbei um Anleitungen zum Fertigen von Wäschestücken handelt.
Das schwarz gebundene Notizbuch ist etwas größer als ein DIN A4-Format. Die 30 Seiten sind beidseitig mit einem roten, seitenfüllend vorgedruckten Punktraster bedeckt. Die Skala am Rand zeigt die Maße an: Auf dem Raster konnte eine Stofffläche von insgesamt 65 x 110 Einheiten (d.h. im Falle von Zentimeter im Maßstab 1:4) dargestellt werden. Die Eigentümerin des Buchs hat ihren Namen auf dem Deckel vermerkt: „Mathilde Jacob 1892“. Laut der Vorbesitzerin arbeitete jedoch nicht nur Mathilde mit diesem Buch. Auch ihre Tochter nähte auf dieser Grundlage Bekleidung für die Familie. In dem Buch befinden sich noch drei aus Zeitungspapier ausgeschnittene Fragmente von Schnittmusterteilen. Sie alle entstammen der Ausgabe der Eßlinger Zeitung vom 30. Juni 1903. Das Buch war also mindestens zwischen 1892 und 1903 in Gebrauch. Über 20 Anleitungen und Schnittmuster für Wäsche, darunter insbesondere Hemden, sind enthalten. Vorlagen für reine Oberbekleidung finden sich darin hingegen nicht.
Das Hemd wird zu den ältesten, heute noch verbreiteten Kleidungsstücken gezählt. In der Zeit um die Jahrhundertwende, als die Anleitungen entstanden, kamen ihm zwei Funktionen zu. Es schützte den Körper vor Schmutz und gleichzeitig schützte es die Oberbekleidung vor Schweiß und anderen Ausscheidungen des Körpers. Es bildete also eine „Zwischenschicht“. Direkt auf dem Körper getragen, kam ihm eine Funktion als Unterwäsche zu.
Das Buch beginnt mit einem „Damen Hemd mit 1 Spickel und eckigem Halsausschnitt“ und weiteren Varianten von Damenhemden, die sich anhand des Halsauschnitts, des Kollers etc. unterscheiden. Darauf folgen verschiedene Hemden für „Mädchen von 10 bis 12 Jahren“, ein Hemd für „Kinder von 3 bis 5 Jahren“ und ein Flügelhemdchen für Kinder von 1 bis 2 Jahren. Der Familienstand von Mathilde Jacob zum Zeitpunkt ihrer Aufzeichnungen ist nicht bekannt, doch kann die Wahl der Kleidergrößen ein Hinweis darauf sein, dass sie möglicherweise Kinder in den entsprechenden Altersgruppen hatte. Alle Anleitungen notierte sie fein säuberlich in akkurater Handschrift mit Tinte. Die ordentlich ausformulierten Angaben deuten darauf hin, dass es sich nicht um rasch notierte Informationen handelt, sondern dass sie entweder vorformuliert oder sogar aus einer Vorlage sorgsam abgeschrieben wurden.
Zu jeder der oben genannten Anleitungen zeichnete sie eine Schnittmuster-Vorlage im Maßstab 1:8. Durchgezogene Linien zeigen an, wo geschnitten werden sollte, gestrichelte Linien bezeichnen den Stoffbruch. Zudem hat sie rote Hilfslinien eingezeichnet. Die einzelnen Schnittteile sind bereits so arrangiert, dass möglichst wenig Verschnitt entsteht. Um was es sich bei den einzelnen Teilen handelt – ob Ärmel, Koller, Verstärkungen von Säumen o.ä. – wird in den gezeichneten Vorlagen nicht benannt. Es ist davon auszugehen, dass bei der Näherin das Verständnis, welches Teil sie gerade vor sich hatte, aufgrund ihrer Erfahrung vorhanden war.
Auf diesen ersten Abschnitt folgen stichwortartige Angaben über den Materialverbrauch von „Leibweisszeug“ (Schürzen, Unterröcke, Untertaille) und „Kindszeug“ (Flügelhemdchen, Wickeltuch etc.) sowie weitere Anleitungen mit einem Schnittmuster für Damen-Beinkleider und eine Vielzahl verschiedener Ausführungen von Herrenhemden. Das Buch schließt mit einem Damen-Nachthemd.
Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde Wäsche verstärkt industriell gefertigt, beispielsweise auch im Raum Albstadt auf der Schwäbischen Alb. Wie wir heute wissen, setzte sich die anschmiegsame Maschenware rasch gegen die mühsam in Handarbeit gefertigten (Leinen-)Hemden, wie Mathilde Jacob sie für sich schuf, durch. Ihre Anleitungen waren schon zwei Generationen später völlig aus der Mode.
Dezember 2023 - Uhrmacher-Drehbank mit Zubehör
Dezember 2023 - Uhrmacher-Drehbank mit Zubehör
Uhrmacher-Drehbank mit Zubehör
G. Boley
Holz, Metall
um 1950
(Städtische Museen Esslingen, STME 008071)

Präzisions-Drehstühle für Uhrmacher bot die Esslinger Firma Boley in den 1950er Jahren in unterschiedlichen Zusammenstellungen und mit passendem Zubehör an. Ein entsprechender Produktkatalog weist das gezeigte Werkzeug als Drehstuhl mit geschlossener Wangenführung, einer Spindelbohrung von 8mm, einer Spitzenhöhe von 45mm und einer Wangenlänge von 260mm in der mittleren Zusammenstellung FM aus, die aus 75 Teilen bestand. Der Setpreis betrug 600 Mark. Der Antrieb erfolgte per Riemen durch einen Schwerfußmotor, der extra dazugekauft werden musste. Die Herstellung von qualitativ hochwertigen Uhrmacherwerkzeugen war die ursprüngliche Geschäftsidee der Firma Boley und ihr Anspruch präziser Fertigung definierte mehr als 120 Jahre deren Markenkern.
Der 1835 in Köngen geborene Uhrmacher Gustav Boley erkannte während seiner Tätigkeit in Uhrmacherhochburg La-chaux-de-Fonds in der französischen Schweiz, wie wichtig hochwertige Werkzeuge für seinen Beruf waren. Allerdings waren die meisten Instrumente, mit denen er und seine Kollegen zu jener Zeit arbeiteten, keinesfalls optimal, da sie meistens selbst hergestellt waren. Als Boley im Jahr 1870 in seine Heimat zurückkehrte und sich in Esslingen niederließ, war sein Ziel eigentlich eine Uhrenproduktion mit Uhrmacherschule. Da ihm hierfür die Unterstützung der Württembergischen Regierung sowie eigene Mittel in ausreichender Höhe fehlten, gründete er ein Unternehmen für die Herstellung „verbesserter Werkzeuge“ für Uhrmacher. So entstand in der Mettinger Straße 11 das erste Unternehmen in Deutschland, das sich auf die Herstellung von Geräten und Werkzeugen aller Art für die Produktion und Reparatur von Uhren spezialisierte. Zu dieser Zeit befand sich die Uhrenindustrie in Deutschland im Aufschwung, weshalb Boley-Produkte bald sehr gefragt waren. Auch die Maschinen, die zur Herstellung der Uhrmacherwerkzeuge erforderlich waren, entwickelte und produzierte Boley selbst. Man fand für diese ebenfalls gute Absatzmöglichkeiten und erweiterte das Werk um eine Abteilung für die Herstellung von hochpräzisen Werkzeugmaschinen. Damit trug Boley wesentlich zum Entstehen und zur Entwicklung einer württembergischen Präzisionsindustrie bei. Wie wegweisend die Firma Boley mit ihrem besonderen Qualitätsanspruch und ihrem Knowhow für die Industrialisierung war, zeigt sich auch daran, dass mehrere Mitarbeiter später eigene Betriebe gründeten, die zu erfolgreichen Unternehmen an den Weltmärkten wurden. Unter ihnen auch der junge talentierte Feinmechaniker Ernst Sachs aus Konstanz, der in seiner vierjährigen Tätigkeit für Boley eine Werkzeugmaschine zur Patentreife brachte, bevor er wenige Jahre später sein Schweinfurter Unternehmen Fichtel und Sachs zu Weltgeltung führte und mit der Erfindung kugelgelagerter Fahrradnaben mit Freilauf und Rücktrittbremse sowie mit der industriellen Produktion von Kugellagern sprichwörtlich die Welt veränderte.
Die Firma Boley profitierte lange vom globalen Vormarsch der Industrie. Die Maschinen aus Esslingen waren weltweit gefragt und kamen in vielen Fabriken mit besonderen feinmechanischen Anforderungen zum Einsatz: in der optischen Industrie ebenso wie in elektrotechnischen Fabriken, in der Automobilindustrie ebenso wie in der Luft- und Raumfahrt. 1992 wurde das Unternehmen Teil des Drehmaschinenherstellers Citizen Machinery Europe, einer Tochterfirma des japanischen Unternehmens Citizen Watch Co. Ltd. 2003 erfolgte die Fusion zu Citizen Machinery & Boley GmbH (CMB), 2008 verschwand Boley schließlich ganz aus dem Firmennamen. Die Citizen Machinery Europe GmbH (CME) ist für den Vertrieb und Service von Citizen-Drehmaschinen in Europa zuständig und betätigt sich auf dem Geschäftsfeld der Automatisierung.
November 2023 - Serviertablett "Rheinfall"
November 2023 - Serviertablett "Rheinfall"
Serviertablett
um 1870
Blech, lackiert und bedruckt
Metallwaren-Fabrik C. Deffner, Esslingen
(Städtische Museen Esslingen, STME 006909)

Die „Lackier- und Metallwaarenfabrik“ von Carl Deffner, gelegen am Neckar, wo heute das neue Esslinger Landratsamt gebaut wird, produzierte im 19. Jahrhundert lackierte Metallwaren. Aus Eisenblech verfertigte Haushaltsgegenstände waren rostanfällig und wurden dadurch unansehnlich und hygienisch zweifelhaft. Dem konnte man durch eine Lackierung begegnen. Der Lack schützte und sah hübsch aus. Aber bei Deffner kam man zusätzlich noch dem dekorativen Bedürfnis der Zeit entgegen und gestaltete Alltagsgegenstände durch abstrakte Dekors und sogar durch richtige Bilder. Das Tablett mit dem Rheinfall bei Schaffhausen aus den 1860/70er Jahren zeigt das sehr schön.
Der Rheinfall, größter Wasserfall Europas mit 23 Meter Höhe und 150 Meter Breite und einer durchschnittlichen Wasserführung von 373 Kubikmetern pro Sekunde, ist ein Produkt der letzten Eiszeit und etwa 17000 Jahre alt.
Schon im Mittelalter wurde von ihm berichtet und seit 400 Jahren wurde er häufig abgebildet. Wer auch nur halbwegs in der Nähe war und es sich leisten konnte, besuchte dieses Naturwunder. Der viel reisende Goethe etwa war auf seiner dritten Schweizerreise am 18. September 1797 dort und schrieb eine Woche später unter Hinweis auf dessen Ballade vom „Taucher“ an den Dichterkollegen Friedrich Schiller: "Bald hätte ich vergessen Ihnen zu sagen daß der Vers: es wallet und siedet und brauset und zischt pp. sich bey dem Rheinfall trefflich legitimirt hat, es war mir sehr merkwürdig wie er die Hauptmomente der ungeheuern Erscheinung in sich begreift.“
Mit dem Aufkommen der Eisenbahn um die Jahrhundertmitte begann hier der Massentourismus. Da brauchte es massentaugliche Erinnerungsbilder. Das schwarze Tablett mit der goldenen Ornamentik verbindet seine praktische Funktion als hauswirtschaftliches Arbeitsgerät mit dem bekanntesten Blick auf diesen imposanten Fall, das sich seit Generationen in unserem Bildgedächtnis befindet: Die Perspektive von der rechten Rheinseite unterhalb des Falls auf den Ort Neuhausen links und das Schloss Laufen rechts, dazwischen, geteilt durch den großen Rheinfallfelsen, der donnernd in die Tiefe stürzende Fluss.
Der Rheinfall war keine zum Selfiehintergrund herabgesunkene, längst bekannte Kulisse, sondern warf die Menschen buchstäblich um und riss sie zu Begeisterungsrufen hin: „Halte dein Herz, o Wanderer, fest in gewaltigen Händen! Mir entstürzte vor Lust zitternd das meinige fast. Rastlos donnernde Massen auf donnernde Massen geworfen, Ohr und Auge, wohin retten sie sich im Tumult?“ beginnt Eduard Mörikes Gedicht über seinen Besuch des Falls 1846.
Das Eisenbahnviadukt knapp oberhalb des Falles, das seit 1857 Schaffhausen mit Winterthur und Zürich verbindet, gehörte zum festen, damals modernen Inventar der Abbildungen. Wenn dazu darüber der Vollmond leuchtete, und das ist hier der Fall, wurde der romantische Effekt maximal. Die biedermeierlichen Andenkenmaler hatten ähnliche Bilder schon in den 1820/30er Jahren in ganz Europa bei einer betuchten Klientel abgesetzt. Aber moderne Reproduktionstechniken waren effektiver, erlaubten höhere Auflagen, waren damit preiswerter und entsprachen den Erfordernissen des immer massenhafter werdenden Tourismus. So auch hier, wo mit einer Art Abziehbild eine graphische Vorlage auf das bereits mit einer immer passenden Standard-Randverzierung versehene Blechtablett übertragen wurde. Und so wurde aus dem Gebrauchsgegenstand, mit dem man Geschirr von der Küche ins Esszimmer trug, gleichzeitig ein emotional aufgeladenes Bild.
Von den Anfängen mit einem Objekt wie diesem Esslinger Blechtablett bis heute nutzt die touristisch orientierte Souvenirindustrie die Verbindung von erinnerungsgeladenem Bild, praktischer Verwendung und massenhafter Produktion. Im 19. Jahrhundert war das privat besessene Bild jedoch noch recht selten und seine Attraktivität ungleich höher als in unserer bilderüberfluteten Gegenwart.
Oktober 2023 - Tell Geck: "Blick auf Esslingen"
Oktober 2023 - Tell Geck: "Blick auf Esslingen"
Tell Geck (1895-1986)
Öl auf Sperrholz; 52,5 x 78,0 cm
1940
(Städtischer Kunstbesitz, Inv. 1642)

Esslingen im Kriegsjahr 1940, dargestellt vom Maler Tell Geck, der zu diesem Zeitpunkt mit Berufsverbot belegt war. Der Künstler zeigt die Stadt von Süden, vom Eisberg aus über den Neckar hinweg blickend. Abgebildet sind die Werkshallen und Schlote der Kammgarnspinnerei Merkel & Kienlin. Daneben das Gärtnerhaus und die Villa Merkel, inmitten von Bäumen, gerahmt durch die Bahngleise auf der einen und den Neckar auf der anderen Seite. Im Hintergrund erhebt sich die Burg und zeugt von der Bedeutung Esslingens in der vorindustriellen Zeit. Der Ausdruck der Malerei ist expressionistisch, die Bäume erinnern in ihrer gen Himmel strebenden Wuchsart an die Schornsteine der Fabrik. Die Fabrik scheint sich in die Natur einzuordnen. Es ist die Ambivalenz zwischen Natur und gebauter Umwelt, die die Widersprüchlichkeit des industriellen Aufschwungs beschreibt: Einerseits wirtschaftliches Fortschrittsdenken, andererseits der Versuch, trotz des industriellen Wachstums eine Art vom Menschen gemachte, zweite Natur nachzuahmen. In dem Gemälde finden sich diese Kontroversen wieder, ungeschönt und ausdrucksstark.
In Gemäldeansichten Esslingens zu Beginn des 20. Jahrhunderts stehen die Schornsteine der Industrie neben den Bäumen wie eine zweite Natur. Viele dieser Schornsteine wurden während des Zweiten Weltkriegs abgebrochen, um die Fabriken vor Luftangriffen zu schützen. Zu Zwecken der Tarnung entwickelte der Maler Oskar Schlemmer einen Anstrich für den Stuttgarter Gaskessel, um ihn durch diese „Camouflage“ vor der Zerstörung zu bewahren. Hans Merkel, Urenkel von Oskar Merkel und von 1929 bis zur Liquidierung 1973 Leiter der Kammgarnspinnerei, berichtet in seinen Kriegstagebüchern, dass auch das Werksgebäude von Merkel & Kienlin schwarz, grün oder braun bemalt und ein Kamin abgebrochen wurde. Die Fabrik sollte aus der Luft wie eine Landschaft aussehen. In den Eisberg wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs unter erheblichem materiellem und personellem Aufwand ein Stollen getrieben. Vermutlich diente er als Schutzraum für die Belegschaft, die ihn über den Alicensteg erreichen konnte.
Der in Offenburg geborene Maler Tell Geck lebte ab 1919 in Stuttgart. Von 1933 bis 1945 war er von den Nationalsozialisten mit einem Ausstellungs- und Berufsverbot belegt. 1986 kaufte die Stadt Esslingen das Gemälde, das daraufhin in den Räumen des damaligen Oberbürgermeisters Eberhard Klapproth hing. Dass dieses wirkungsvolle Gemälde von 1940 erhalten blieb und nun als Objekt des Monats im Stadtmuseum zu sehen ist, kann auch als Erinnerung an eine Zeit gelesen werden, in der viele Geschichten nicht erzählt werden durften. Künstler:innen wie Tell Geck haben durch Widerständigkeit und Mut ihrer Nachwelt ermöglicht, heute genau diese Geschichten wieder zu entdecken, zu erinnern und mitzudenken im Hier und Jetzt.
Für die Ausstellung „Surface Treatments – 150 Jahre Zeit“ begaben sich die Künstlerinnen Ann-Kathrin Müller, Julia Schäfer und Judith Engel auf die Spuren der Geschichte der Villa Merkel. Bei der Recherche stießen sie auf eine Reproduktion des Gemäldes, die schlussendlich als Vorlage für eine weitere Reproduktion diente, die noch bis zum 22. Oktober in der Villa Merkel im Rahmen der Ausstellung zu sehen ist: eine 460 x 650 cm große PVC-Plane, im ehemaligen Esszimmer der einstigen Fabrikantenvilla. Eine Erinnerung an die Landschaft, die mal da war und heute nicht mehr ist. Ein langsam verblassendes Bild in der kollektiven Erinnerung daran, wie unsere Stadtlandschaft entstand.
Die Ausstellung „Surface Treatments — 150 Jahre Zeit“ findet anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Villa Merkel statt. Das Projekt fokussiert die Geschichte des Hauses und die Entwicklung der Esslinger Gesellschaft in diesen 150 Jahren Zeit.
September 2023 - Gedenktafel "Hanns-Martin-Schleyer-Brücke"
September 2023 - Gedenktafel anlässlich der Umbenennung der "Mettinger Brücke" in "Hanns-Martin-Schleyer-Brücke"
Eisen
13. Juni 1978
(Städtische Museen Esslingen, STME 008224)

Am 13. Juni 1978 wurde bei einem Gedenkakt die 1963 erbaute „Mettinger Brücke“ in „Hanns-Martin-Schleyer-Brücke“ umbenannt. Dabei wurde am westlichen Brückenteil diese Gedenktafel aus Eisen (80 x 80 cm) enthüllt.
Die Umbenennung der Brücke in Anwesenheit von Vertretern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft sowie von Angehörigen Hanns Martin Schleyers und der bei seiner Entführung (5. September) in Köln durch Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF) erschossenen vier Begleiter war eine Reaktion der Stadt Esslingen auf die terroristische Bedrohung der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft. Entführung, Geiselhaft und Ermordung Schleyers im September und Oktober 1977 bildeten, mit der parallelen Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut und dem Selbstmord der inhaftierten Führungsgestalten der RAF, den Kulminationspunkt der seit 1968 eskalierenden terroristischen Bedrohung der Bundesrepublik Deutschland.
Nach ersten Diskussionen, die im November 1977 im Ältestenrat geführt wurden, entschied der Gemeinderat der Stadt Esslingen am 8. Mai 1978 beinahe einstimmig zugunsten der Umbenennung der „Mettinger Brücke“. Das Bauwerk sei wegen seiner Nähe zu den Werksanlagen der Daimler Benz AG und wegen des Charakters "als Brückenbauwerk" ausgewählt worden, um an Schleyer zu erinnern. Schleyer, der, so Oberbürgermeister Eberhard Klapproth, "als Beispiel eines Demokraten für einen jeden von uns stand und für uns alle gestorben ist", sei zudem "mit der Stadt Esslingen am Neckar auf bleibende Weise in mehrfacher Art verbunden".
Im von Entsetzen und Bedrohung geprägten Diskurs der Jahre 1977/78 wurden in Esslingen zwar die unbestreitbaren Verdienste des 1915 geborenen Schleyer hervorgehoben, nicht aber dessen Vergangenheit als ein aktiver Unterstützer und Profiteur des nationalsozialistischen Regimes. Schleyer war Mitglied der NSDAP, Offizier (Untersturmführer) der SS, höherer Funktionär der gleichgeschalteten Studentenschaft in Heidelberg, Innsbruck und Prag und schließlich Leiter des Präsidialbüros des „Zentralverbandes der Industrie in Böhmen und Mähren“ gewesen. Neben eindeutig antisemitischen Position bezeichnete er sich selbst 1942 als "alte[n] Nationalsozialist und SS-Führer".
Aufgrund von schweren konstruktiven Beschädigungen, wurde die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke im Januar 2021 zunächst gesperrt und anschließend weitgehend abgebrochen, um einem Neubau an derselben Stelle Platz zu machen. Der Ersatzneubau wird nach zweieinhalb Jahren Bauzeit nach den Sommerferien 2023 eingeweiht werden.
Der notwendige Neubau veranlasste die Fraktionen von Bündnis90 / Die Grünen und Die Linke, am 22. Mai 2023 gemeinsam den Antrag zu stellen, dass "die Brücke nicht weiterhin nach einer Person benannt sein [kann], deren NS-Vergangenheit mittlerweile sehr gut erforscht und öffentlich ist". Am 24. Juli 2023 hat der Gemeinderat eine entsprechende Vorlage der Verwaltung nach einer substanziellen Diskussion mit einer Mehrheit von 21 zu 16 Stimmen befürwortet und einer Benennung als "Mettinger Brücke" zugestimmt. Die im Verlauf von mehr als 40 Jahren durch Witterungsspuren deutlich gezeichnete Gedenktafel wird deshalb nicht mehr montiert werden. Sie wird in die Sammlung des Esslinger Stadtmuseums aufgenommen.
Die Frage der Benennung der Brücke spiegelt exemplarisch die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts und die Veränderung des Erinnerungsdiskurses wider. Schleyer gehörte zu den zahlreichen Vertretern der gesellschaftlichen Elite, die sowohl im NS-Staat systemstabilisierend agierten und den Unrechtsstaat beförderten als auch danach in der Bundesrepublik herausragende Positionen einnahmen. Sein furchtbares Schicksal als Entführungs- und Mordopfer der Terroristen ließ ihn auch zum Opfer werden. Beide Diskurse sind nachvollziehbar und legitim. Die komplexe Frage, ob Hanns Martin Schleyer unter diesen Voraussetzungen die besondere Würdigung der Benennung eines kommunalen Bauwerks nach ihm zu Teil werden soll, hat die Mehrheit des Gemeinderats verneint.
August 2023 - Karl Harm: Neckarlandschaft
August 2023 - Neckarlandschaft mit Pliensaubrücke, Pliensautor und Neckarwehr
Karl Harm (1891-1970)
Öl auf Leinwand
1931
(Städtische Museen Esslingen, STME 008158)

In der Fülle der Esslinger Stadtansichten finden sich viele Darstellungen der Pliensaubrücke mit dem Pliensautor. Die mittelalterliche Brücke war für das Stadtbild seit jeher prägend und für die Stadtgeschichte von zentraler Bedeutung. Im 13. Jahrhundert erbaut, gilt sie als zweitälteste Steinbrücke Deutschlands. Sie war Jahrhunderte lang die wichtigste Lebensader der Stadt und stellte bis in die späten 1960er Jahre den Haupteingang zu Esslingens Innenstadt dar. 1931, dem Entstehungsjahr des Gemäldes, fuhr bereits die Straßenbahn der Linie Esslingen-Nellingen-Denkendorf über das altehrwürdige Bauwerk. Masten für die Oberleitungen und Straßenlaternen flankierten die Fahrbahnen.
Nichts von alledem teilt sich jedoch auf diesem Bild mit. Vom Standpunkt des Betrachters auf dem Pliensauwasen, der etwa dort zu verorten ist, wo heute die Vogelsangbrücke das linksseitige Neckarufer gewinnt, müsste hinter der Pliensaubrücke das Industrieareal der Weststadt mit dem hohen Schlot der Firma Dick deutlich zu erkennen sein. Auf alle erwartbaren Details, die das Motiv seiner Gegenwart zuordnen ließen, hat der Künstler verzichtet. Bereits mit der Wahl des Standorts und des Bildausschnitts lenkt er den Blick flussabwärts gezielt an möglichen Anhaltspunkten der Stadtsilhouette vorbei und fokussiert ihn ganz auf die Brücke und das Pliensautor sowie auf den Neckar und die sich hinter der Brücke auftuende Landschaft. Die Schwelle des Neckarwehrs erzeugt räumliche Tiefe und gliedert den Vordergrund des Bildes. Das Bauwerk selbst bildet den Bildmittelgrund, wobei die architektonische Mitte der Brücke auch das Zentrum des Bildes markiert. Der Turm des Pliensautors kommt mit seinem Dachfirst mit der Horizontlinie des Schenkenbergs im Hintergrund in Deckung, wodurch sich der Turm der Landschaft unterordnet. Allein der kleine Dachreiter überragt das Weichbild des Höhenrückens westlich der Stadt. Weitere Hinweise gibt der Künstler nicht auf Esslingen als Stadt. Mehr idealisierendes Landschaftsbild als Stadtansicht, besticht das Gemälde durch die luft- und farbperspektivische Akzentuierung, die mit einfachen malerischen Mitteln überzeugend eine sommerliche, in der Ferne noch leicht dunstige Morgenstimmung evoziert.
Geschaffen hat das Bild der damals knapp vierzigjährige Esslinger Malermeister Karl Harm. Harm wurde 1891 in Esslingen geboren. Nach seiner Schulzeit hatte er zunächst eine Malerlehre absolviert, seinen Wehrdienst geleistet und schließlich die Kunstgewerbeschule in Stuttgart besucht. Seinen Plan, in Hamburg auf einem Passagierschiff nach Chile anzuheuern und sich als Schiffsmaler zu verdingen, wurde 1914 durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zunichte gemacht. Harm wurde zum Militär eingezogen, verwundet und abermals in den Krieg geschickt. Zwar zierten Aquarelle aus dieser Zeit Feldpostkarten, der angestrebten Karriere als Kunstmaler folgten nach Kriegsende jedoch notgedrungen realistischere Pläne. Harm machte seinen Meister als Dekorationsmaler und gründete einen kleinen Malerbetrieb, der zunächst in der Oberen Metzgerbachstraße, später in der Kiesstraße und schließlich in der Fabrikstraße angesiedelt war. In den 1920er Jahren heiratete Karl Harm, die Familie hatte zwei Söhne und eine Tochter. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Herstellung von Sternnägeln, Fensterstiften und Blechecken hinzu. Dieser Geschäftszweig entwickelte sich in den 1960er Jahren weiter und firmierte zuletzt 1970, im Todesjahr von Karl Harm, als Karl Harm KG Werkzeugbau, Stanzerei und Spritzguß am angestammten Ort in der Fabrikstraße. Karl Harm hat sich zeitlebens nur in seiner Freizeit und im Urlaub künstlerisch betätigt, seine Bilder wurden nie öffentlich gezeigt. Sie blieben in Familienbesitz oder wurden verschenkt. Die gezeigte Neckarlandschaft zierte lange Zeit die Wohnung des letzten noch lebenden Sohnes von Karl Harm und wurde den Städtischen Museen kürzlich geschenkt.
Juli 2023 - Rechnung des Tierpräparators Gustav Schmid
Juli 2023 - Rechnung des Tierpräparators Gustav Schmid
Papier, Tinte
1904
(Stadtarchiv Esslingen, Bestand THG Nr. 40)

Im Stadtarchiv Esslingen befindet sich im Bestand „Theodor-Heuss-Gymnasium“ – der Nachfolgeschule der Höheren Mädchenschule – eine Rechnung mit Briefkopf aus dem Jahr 1904. Es handelt sich dabei um ein Schreiben des Präparators Gustav Schmid für einen „ausgestopften“ Eichelhäher. Ein solcher befindet sich noch heute im Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) und es ist anzunehmen, dass es sich um das hier in Rechnung gestellte Exemplar handelt.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus, war es in den Schulen durchaus üblich, für Unterrichtszwecke in Biologie präparierte Tiere anzuschaffen. Bekannt sind in Esslingen unter anderem Sammlungen in der ehemaligen Burgschule und im Georgii-Gymnasium.
Der Esslinger Präparator Gustav Schmid hatte sein Gewerbe am 10. September 1902 angemeldet und fand erstmals im Esslinger Adressbuch von 1903 Erwähnung. Weitere Einträge stammen aus den Jahren 1904 und 1905. Als seine „Spezialität“ wird im gezeigten Briefkopf die „Anfertigung von Wildköpfen aller Art“ genannt. Folgerichtig ist hier ein Hirschkopf abgebildet. Entgegen der allgemeinen Meinung, die Tiere würden „ausgestopft“, verhält es sich dabei so, dass ein:e Präparator:in das Fell oder Federkleid abzieht und gerbt, um es haltbar zu machen. Das tote Tier wird vermessen und eine Nachbildung aus Kunststoff oder Holz hergestellt, auf die dann das Fell aufgezogen und mit (unsichtbaren) Drähten befestigt wird. Dieser Vorgang wird zwar als „Ausstopfen“ bezeichnet, hat aber mit realem Ausstopfen wenig zu tun. Den Beruf der Präparation kann man auch heute noch an der Höheren Berufsschule für Präparationstechnik des Walter-Gropius-Kollegs in Bochum erlernen.
Auf der vorliegenden Rechnung quittierte Gustav Schmid den Erhalt des Betrags über 2 Mark 20 Pfennige durch seine Unterschrift. Der Rektor Wilhelm Frey bestätigte die Übernahme in die Lehrmittelsammlung und die Vorstreckung der Kosten durch den Auftraggeber, den Oberlehrer Hermann Bäuchlen.
Nach 1904 verschwindet Gustav Schmid aus den Esslinger Adressbüchern, stattdessen werden in den folgenden Jahren bis 1912 andere Präparatoren aufgelistet. Erst ab 1913 bis 1920 war Gustav Schmid erneut als Präparator tätig. In den 1930er Jahren kaufte er das Gebäude Rossmarkt 24, führte dort einige Jahre sein Geschäft und vermietete die Wohnungen. Er war außerdem Eigentümer des Hauses Martinstraße 23, in das er später auch seine Werkstatt verlegte.
Die Geschäfte liefen nicht immer gut, weshalb Schmid zeitweise auch eine Pelz- oder Fellhandlung betrieb. Zudem hatte er kurzfristig eine Architektur-Modell-Werkstatt und bot elektrische Schweißarbeiten an. In den 1940er Jahren besaß er in seinem Anwesen in der Martinstraße 23 eine Schießbude. Nach seinem Tod Anfang der 1960er Jahre ging das Gebäude in den Besitz der Stadt Esslingen über und wurde später abgerissen.
Juni 2023 - Versilberte Metallmontur mit Glaseinsatz
Juni 2023 - Versilberte Metallmontur mit Glaseinsatz
Dupper & Bernhold Esslingen
Messing, Silber, Glas
Anfang 20. Jahrhundert
(Städtische Museen Esslingen, STME 008066)

„DBE“: So lautet die eingeschlagene Marke am Griff jener Schale, die jüngst in die Sammlung des Stadtmuseums einging. Die Abkürzung steht für die renommierte Metallwarenfirma Dupper & Bernhold Esslingen. 1890 war das Unternehmen vom in der Küferstraße 24 ansässigen Kaufmann Wilhelm Dupper und seinem Kompagnon Max Bechtle jr. unter dem Namen „Dupper & Bechtle“ gegründet worden. 1896 stieg Ernst Bernhold als Teilhaber in das Unternehmen ein; es firmierte nun unter dem Namen „Dupper & Bernhold“. Der Firmensitz
befand sich in der Neckarstraße 65A.
Das Unternehmen fertigte eine „reiche Auswahl in gut versilberten und vergoldeten Gebrauchs- und Luxusgegenständen“, wie es in einer Anzeige um die Jahrhundertwende seine Erzeugnisse bewirbt. Zur Produktpalette zählten insbesondere versilberte Tafelgeräte wie Tafelaufsätze, Vasen, Schalen und Bowlen, häufig mit überbordenden Pflanzenranken und verspielten Details. Diese im Jugendstil gefertigten Arbeiten sind bis heute in Sammlerkreisen sehr begehrt. Im Vergleich zu jenen verschlungenen Formen kommt diese Schale hier direkt „aufgeräumt“ und schlicht, jedoch nicht weniger anmutig daher. Die Metallmontur zeigt auf vier identischen Bildfeldern jeweils zentral ein mit Voluten verziertes Trapez, behängt mit einem Lorbeergebinde. Links und rechts davon laufen Zweige mit je sieben Blättchen zu den benachbarten Bildfeldern.
Die erhabenen Elemente schimmern leicht golden – hier wurde das Silber in der Vergangenheit wohl so energisch poliert, dass sich die Versilberung löste und das darunter befindliche Metall zum Vorschein kam. Dadurch wird deutlich, dass es sich bei Produkten dieser Art nicht um „Silberwaren“ im eigentlichen Sinne handelte, wie sie gerne umgangssprachlich bezeichnet werden, sondern um versilberte Metallwaren. Den Kern solcher Monturen bildet ein unedles Metall – in diesem Fall wahrscheinlich Messing –, welches dann entweder durch Plattierung oder durch Galvanisierung versilbert wurde. Die Glasschale, die in die Montur eingesetzt ist, wurde nicht von Dupper & Bernhold selbst gefertigt, sondern zugekauft.
Die metallverarbeitenden Betriebe nahmen zusammen mit der Textilindustrie im 19. Jahrhundert eine Schlüsselrolle bei der Industrialisierung Esslingens ein. Im Gegensatz zu manch anderem örtlichen Hersteller versilberter Metallwaren stechen die Erzeugnisse von Dupper & Bernhold durch eine hohe Qualität und Sorgfalt in der Verarbeitung hervor. Dennoch handelt es sich bei den Produkten um Massenware und nicht um Einzelstücke.
In der vorindustriellen Zeit musste ein:e Metallhandwerker:in das Blech noch mühsam von Hand in Form treiben – eine Arbeit, die pro Stück mehrere Tage in Anspruch nehmen konnte. Durch den Einsatz einer mechanischen Drückbank oder eines Fallhammers konnten Hohlkörper deutlich schneller gefertigt werden. Arbeitsteilig erfolgten dann die weiteren Schritte wie Ziehen, Gießen, Drehen, Plattieren, Galvanisieren, Löten, Schleifen und Polieren, um am Ende eine blitzblank schimmernde Schale, Vase etc. zu erhalten.
1929 wurde „Dupper & Bernhold“ von Hanns Knäbel übernommen. Ab spätestens 1949 firmierte das Unternehmen auch unter seinem Namen: Der Stempel zeigt nun die Spitze des Dicken Turms mit den Initialen H.K.E. (= Hanns Knäbel Esslingen). Das Unternehmen hatte bis 1976 Bestand, dann wurde es aufgelöst.
Mai 2023 - Reisetruhe des Missionars Thomas Digel
Mai 2023 - Reisetruhe des Missionars Thomas Digel
Holz, Eisen, Zinnblech, Papier
1898
(Städtische Museen Esslingen, STME 008060)

Im März 1898 endete die Zeit von Thomas Digel und seiner Familie in Indien. Als evangelischer Missionar lebte und arbeitete er dort 32 Jahre. Nun trat das Ehepaar Digel die Heimreise an. Mit an Bord war diese Truhe, die einen Blick auf die Reiseroute ermöglicht: Von der westindischen Hafenstadt Mangalore (heute Mangaluru) ging es zunächst bis Bombay, dem heutigen Mumbai. Hier betraten die Digels den Dampfsegler „Imperator“, auf welchem sie bis Triest fuhren. Von dort ging es weiter zu ihrem Zielort Esslingen. Was sich in der Reisetruhe befand, ist nicht bekannt. Wer Thomas Digel war, hingegen schon.
Thomas Digel wurde am 28. Juli 1840 in Neuffen geboren und entschied sich im Alter von 17 Jahren in die Basler Mission einzutreten. Diese 1815 gegründete Institution bildete Missionare aus, vermittelte sie weiter oder sandte sie ab 1828 direkt aus der Schweiz nach Indien, Afrika und China. Nach einer siebenjährigen Lehrzeit in Basel wurde Digel im Jahr 1864 nach Indien geschickt, wo er in Mangalore seinen Dienst verrichtete. Hier sollte er mit der heimischen Bevölkerung eine Dorfkultur nach süddeutschem, christlich-pietistischem Vorbild aufbauen. Die Basler Mission legte dabei Wert auf einen respektvollen Umgang mit der indischen Kultur. So wurde etwa in den erbauten Missionarsschulen in der Sprache der Einheimischen, nicht etwa in der Kolonialsprache unterrichtet. Zudem machten sich einige Missionare wie etwa der Stuttgarter Hermann Gundert in der Erforschung der indischen Sprachfamilien verdient.
Missionare der Basler Mission reisten unverheiratet in ihr Zielland und durften erst nach zwei Jahren, wenn sie sich bewährt hatten, um eine Heiratserlaubnis bitten. Hierbei konnten sie entweder selbst eine Frau aus dem Heimatland vorschlagen oder sie schickten ein Telegramm an das Komitee in der Schweiz, mit der Bitte eine geeignete Partnerin für sie zu suchen. Die Bräute reisten anschließend nach Übersee, wo die Hochzeit stattfand. Ihren zukünftigen Ehemann kannten sie zuvor nur durch ein Bild und ein paar Briefe. Thomas Digel wurde auf diese Weise dreimal verheiratet. Mit Marie-Emilie Digel-Herrmann, der dritten Ehefrau, verbrachte er laut dem Tagebuch seiner Tochter eine glückliche Ehe, die von Leid und Freud gleichermaßen geprägt war. Das Paar hatte sieben gemeinsame Kinder, die jedoch fern von den Eltern aufwuchsen. Der Tradition der Basler Mission entsprechend, wurden die Kinder im Alter von sechs Jahren in das Heimatland ihrer Eltern geschickt, um sie vor dem „heidnischen Einfluss zu bewahren“ und christlich-europäisch erzogen zu werden. Fortan wohnten sie im Basler Missionshaus und bei Verwandten im Elsass. Zu den Eltern in Indien bestand lediglich ein unregelmäßiger Briefkontakt. Kurz nachdem das Ehepaar Digel im Frühjahr 1898 in Esslingen ankam, reisten sie nach Basel auf ein Fest der Mission. Die 17jährige Tochter Maria begleitete ihre Eltern im Anschluss nach Esslingen. Bezeichnend für das distanzierte Verhältnis ist ein Tagebucheintrag Marias kurz nach der Ankunft in Esslingen: „Aber wie undankbar bin ich doch, dass ich Heimweh habe wo ich doch meine Eltern jetzt habe.“
Thomas Digel war in Esslingen weiterhin als Prediger tätig und hielt des Öfteren Gottesdienste in Sulzgries. Die indische Kultur brachte er mit nach Esslingen. So war etwa Curry und Reis ständig auf dem Speiseplan der Familie. Auch Auftritte Digels in indischer Tracht zeugen von der Verbundenheit des Missionars zu dem Land, in dem er einen Großteil seines Lebens verbrachte. 1909 verließ das Ehepaar Digel Esslingen erneut und zog in die Nähe von Zürich, wo Thomas als Kurgeistlicher eine Anstellung fand. Dort starb er am 14. Februar 1913.
Die Reisetruhe gelangte in den Besitz des Schwiegersohns Fritz Spellig. Nach dessen Tod 1969 wurde die Truhe vom Urgroßenkel Thomas Digels, auf dem Dachboden gefunden. Dieser schenkte sie einem Freund, der die Truhe jahrelang als Sideboard benutzte, bis er sie im Jahr 2023 an die Städtischen Museen Esslingen übergab.
April 2023 - Hausmodell der Schimpf´schen Villa
April 2023 - Hausmodell der Schimpf´schen Villa
Albert Benz
Holz, Metall, Glas
1905
(Städtische Museen Esslingen, STME 008014)

Das Architekturmodell aus Holz zeigt die prachtvolle Villa, die der Architekt Albert Benz (1877-1944) zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Mettinger Straße 17 für seinen Freund, den Esslinger Handschuhfabrikanten Ernst Schimpf (1862-1942), plante.
Ernst Schimpf hatte bereits 1895 Rosa Helene Fink (1870-1949) geheiratet. Sie war die Tochter des Musikers Christian Fink und Enkelin des Verlegers Jakob Ferdinand Schreiber. Das frisch vermählte Paar lebte zunächst in der Schelztorstraße und dann am Hafenmarkt 7 (dem heutigen Stadtmuseum). Der Wunsch nach einem eigenen Heim war jedoch groß. Das passende Grundstück fanden sie im Familienbesitz des Handschuhfabrikanten in der Mettinger Straße 17. Dieses war allerdings schon mit einem Fachwerkhaus aus dem Jahr 1578 bebaut. Um Platz für den Neubau von Ernst und Rosa zu schaffen, ließ der Stuttgarter Ingenieur Erasmus Rückgauer in einer aufsehenerregenden Aktion im Jahr 1905 das 300 Jahre alte Gebäude von seinem Fundament trennen, auf eine Schiene setzen und innerhalb einer Woche um 17 Meter auf das Nachbargrundstück, die Mettinger Straße 19, schieben. Durch diese so genannte Translozierung konnte das historische Gebäude erhalten werden und existiert noch immer – heute steht es unter Denkmalschutz.
Das Ehepaar Schimpf wünschte sich ein „altdeutsches“ Haus, das wie eine Burg anmuten sollte. Auf Reisen im In- und Ausland hatte es sich Anregungen von Schlössern, Burgen und Klöstern geholt und plante gemeinsam mit Albert Benz die Schimpf´sche Villa. 1907 war das Haus mit seinen 24 Zimmern schließlich bezugsfertig. Die sehr kreative Rosa hatte schon als Kind Porzellan- und Glasmalerei erlernt und stickte meisterlich. Die Porzellankacheln des Ofens und des Wandbrunnens bemalte und brannte sie selber; für die einzelnen Zimmer bestickte sie riesige Wandbehänge. Zudem bemalte sie ein Glasfenster über zwei Etagen mit den Wappen aller Esslinger Bürgermeister.
Das mehrstöckige Haus hatte im Untergeschoss eine Kapelle mit drei Spitzbogenfenstern, die mit bunten Glasscheiben versehen waren. Blickte man durch sie, sah man hinaus in den wunderschönen Garten auf eine alte Madonnenfigur. In dieser Kapelle befand sich Rosas Andachtsraum, in den sie sich immer wieder zurückzog. Im Erdgeschoss gab es ein riesiges Spielzimmer für die beiden Kinder, voll mit Kinderbüchern vom J. F. Schreiber-Verlag, Kaufladen, Puppenstube (vgl. „Objekt des Monats“ vom Dezember 2022) und vielen anderen Dingen. In weiteren Räumen nahm Rosa junge Mädchen von der Schwäbischen Alb auf und bildete sie in Hauswirtschaft aus. Zum Haushalt des Ehepaars Schimpf gehörten außerdem eine Kinderfrau, eine Waschfrau, drei Bügelfrauen und ein Weingärtnerehepaar, das sich um den Garten und den hauseigenen Weinberg kümmerte. Stimmungsvolle Feste wurden gefeiert; das Haus war stets voller Leben.
Bei der Gemeinderatswahl 1919 kandidierte Rosa für die Frauengruppe der Deutschen Demokratischen Partei. Sie wurde jedoch nicht gewählt. Ab 1920 engagierte sie sich im Esslinger Hausfrauenverband und übernahm zwischen 1924 und 1930 den Vorsitz. Ernst starb 1942 im Alter von 80 Jahren. Da die Handschuhfabrik inzwischen kaum noch etwas abwarf, gab es im Haus keine Dienstboten mehr; Rosa, ihre Tochter und ihre Enkelin mussten alle Arbeiten in Haus und Garten selbst verrichten. 1949 starb auch Rosa. Drei Jahre später musste das Haus im Zuge der Nachlassteilung an die Firma G. Boley verkauft werden. 1956 wurde es abgebrochen. Nur noch das Hausmodell und einige historische Fotografien erinnern an die prächtige Villa, die mit viel Liebe und Phantasie für Jahrhunderte gebaut worden war, aber lediglich 50 Jahre überdauern sollte.
März 2023 - Fahnen des Mettinger Liederkranzes
März 2023 - Zwei Fahnen des Mettinger Liederkranzes
Seide, bemalt bzw. bestickt
1841 und 1891
(Städtische Museen Esslingen, STME 008058 und STME 008059)

Die beiden Fahnen markieren wesentliche Stationen in der langen Vereinsgeschichte des Mettinger Liederkranzes und weisen diesen Verein als den ältesten des ehemaligen Filialorts und heutigen Stadtteils Esslingens aus: Bereits 1839 trafen sich junge Weingärtner aus Mettingen in der sogenannten Welschkornbühne beim Alten Rathaus in Esslingen und übten sich im vierstimmigen Gesang. Als Mettinger Singverein mit bereits 24 Mitgliedern werden sie 1840 erwähnt. Im selben Jahr hatten die Sänger ihren ersten öffentlichen Auftritt im Gasthaus zur Krone in der Pliensau. Eine ansehnliche Geldspende aus dem Publikum ermöglichte in der Folge die Anschaffung der ersten Vereinsfahne. Beim großen Festumzug der Württemberger zum 25-jährigen Thronjubiläum von König Wilhelm I. marschierten auch 28 Sänger des Mettinger Liederkranzes mit und präsentierten ihre Fahne. Dieses Großereignis war der erste Höhepunkt in der Geschichte des jungen Vereins, der offensichtlich großen Wert darauf legte, dass die Jahreszahl dieser patriotischen Huldigungsveranstaltung auch als Gründungsjahr auf seiner Fahne stand und solchermaßen in die Annalen der Vereinsgeschichte einging. Zum 50jährigen Vereinsjubiläum wurde 1891 eine neue Fahne in Auftrag gegeben. Ganz offensichtlich zu einem späteren Zeitpunkt wurde diese noch mit dem gestickten Schriftzug „gegr. 1841“ ergänzt, der sich deutlich abhebt vom Rest der Stickerei. Es ist gut möglich, dass diese Angabe im Jahr 1951 angebracht wurde. Während im Kriegsjahr 1941 keine Feierlichkeiten stattgefunden hatten, wurde das 110jährige Vereinsjubiläum 1951 groß gefeiert.
Die ältere der beiden Fahnen wurde aus Seide gefertigt und besteht aus zwei Fahnenblättern Auf einer Seite ist der Schriftzug „Gesangverein von Mettingen 1841“ und auf der anderen Seite ein Landschaftsbild mit im Vordergrund stehendem Weinstock aufgemalt – letzteres eine Arbeit, des Kunstmalers Louis Häbe aus Esslingen, die, wie eine Vereinschronik berichtet, „im Waldhäuser, im Weinberg des Georg Adam Clauß, Kirchstraße“ ins Werk gesetzt wurde. Die Seitenränder der Fahne sind von zwei Metallkordeln geziert an deren Ende jeweils eine Quaste sitzt. Unter- und Oberkante sind durch Borten aus Metallbouillonfransen verziert. Über die Seite und die obere Kante verläuft zudem eine Kordel aus Metallfäden. Eine eingenähte Stange mit eichelförmigen Abschlüssen und einer mittigen Ringöse dient der Äufhängung.
Die jüngere der beiden Fahnen wurde von der Fahnenfabrik Neef in Biberach gefertigt. Dieses 1848 gegründete Unternehmen spezialisierte sich früh auf kunsthandwerklich gefertigte Vereinsfahnen von hoher Qualität und blieb dieser Tradition bis heute treu. Die für den Liederkranz Mettingen hergestellte Fahne ist ebenfalls zweiseitig mit einem roten und weißen Fahnenblatt aus Seidensamt. Sie weist drei Spitzbögen auf, die jeweils mit einer Quaste abschließen. Das rote Fahnenblatt aus dunkelrotem Seidensamt ist mit einer Metallstickerei in Anlegetechnik verziert. Auf ihr ist der Schriftzug „Liederkranz 1891. Gegr. 1841 Mettingen“ zu lesen. Das weiße Fahnenblatt ist mehrfarbig mit Plattstich- und Kurbelstickerei bestickt und zeigt die Darstellung eines Weinstocks. Die Kanten ziert eine Fransenborte aus Metallbouillonfransen. Die Aufhängung der Fahne erfolgt durch eine eingenähte Stange mit knaufförmigen Abschlüssen und angeschraubten Metallbügel.
Im Laufe der Zeit haben die Fahnen stark gelitten. Beide wurden bereits in früherer Zeit überarbeitet. Die Fahnenblätter der älteren Fahne wurden doubliert. Bei diesem Verfahren wurde die fragile Seidentextur auf ein stabiles Trägergewebe aufgebracht.
Die aktuelle Restaurierung der Fahnen beschränkte sich auf wenige behutsame Maßnahmen: Die ältere Fahne wurde im Wesentlichen mit einer ganzflächigen Abdeckung aus einem farblich passend eingefärbten Nylontüll versehen. Die Fahne von 1891 wurde vorsichtig gereinigt und die Hängung der Quasten gesichert.
Februar 2023 - Mathematischer Atlas
Februar 2023 - Mathematischer Atlas
Papier, Leder
Tobias Mayer, Augsburg
1745
(Leihgabe aus Privatbesitz)

Im Jahr 1745 wird beim Kaiserlichen Hof- und Kupferstecher, dem Pfeffel-Verlag in Augsburg, der „Mathematische Atlas“ von Tobias Mayer gedruckt. Der Verfasser ist zu diesem Zeitpunkt erst 22 Jahre alt. Er hat zuvor, im Alter von 16 Jahren, den nachweislich ersten Stadtplan von Esslingen erstellt, der bei Gabriel Bodenehr, ebenfalls in Augsburg, für den Esslinger Magistrat mit 50 Exemplaren gedruckt wird. Wer ist dieser Tobias Mayer, Vermesser des Meeres, der Erde und des Himmels?
Tobias Mayer wird am 17. Februar 1723 in Marbach am Neckar geboren. Sein Vater, Wagner und Brunnenmeister in Marbach, baut 1723 die Wasserleitung mit Aquädukt von Obertal zum Schloss Hohenkreuz, das die Familie von Palm 1722 erworben hat. Anfang 1724 zieht die Familie nach Esslingen, wo sie zwei Jahre darauf das Esslinger Bürgerrecht erhält. Dank der Hilfe des Vaters und der Mutter kann der fünfjährige Tobias lesen, schreiben und zeichnen. Er gilt in der Stadt als Wunderkind.
Nach dem Tod des Vaters 1730 gewährt der Esslinger Magistrat Tobias Unterkunft, Verpflegung und Kleidung im Waisenhaus. 1737, inzwischen zur Vollwaise geworden, liest Tobias mathematische Bücher, die ihm der Schuhmacher Kandler und der Rektor der Lateinschule Salzmann ausleihen. Ein Jahr später schickt ihn der Esslinger Rat in die Lateinschule, wo Tobias Latein, Griechisch, Religion, Rhetorik/Logik und Geographie/Geschichte lernt und in seiner Freizeit tief in das Gebiet der Algebra und Geometrie eindringt. Bis 1741 ist Mayer in der Lateinschule. Danach bereitet er, vermutlich in Esslinger und Stuttgarter Bibliotheken, seinen Mathematischen Atlas vor.
Volljährig aus den Verpflichtungen des Collegium Alumnorum entlassen, begibt sich Mayer nach Augsburg. Hier arbeitete er wohl als Zeichner oder Entwerfer, gelegentlich auch Kupferstiche ausführend, bis 1745 in der Pfeffel‘schen Verlagsanstalt sein Mathematischer Atlas als Kupferstich gedruckt wird. Der Atlas besteht aus 60 Blättern, in denen alle Bereiche der Mathematik vorgestellt und mit umfangreichen Erläuterungen und Grafiken versehen sind. 42 Seiten sind handkoloriert. Das Buch behandelt nicht nur die Mathematik im engeren Sinne, sondern alles, was man als „angewandte Mathematik“ bezeichnen könnte, so auch die Astronomie, die Kartographie (auf einer Seite ist handkoloriert der Plan „Die Gegend um Esslingen“ von 1743 gedruckt), die Kriegs- oder die Baukunst. Besonders beachtenswert ist die Darstellung. Jeweils in der Mitte einer Seite finden sich umfangreiche Illustrationen, die von einem leicht verständlichen Text umrahmt werden. Es handelt sich somit um ein Lehrbuch, in dem die Kenntnisse der Zeit allgemeinverständlich aufbereitet werden. Das Buch war so erfolgreich, dass Tobias Mayer nachträglich ein Supplement mit acht Seiten zur höheren Mathematik ergänzte.
Der Ruhm eröffnet Tobias Mayer eine leitende Stelle im Landkartenverlag Homann-Erben in Nürnberg. Nach der Veröffentlichung mehrerer größerer Abhandlungen zu astronomischen Beobachtungen nimmt er eine Professur in Göttingen an. Weitere bedeutende Veröffentlichungen folgen, bevor Tobias Mayer 1762 im Alter von 39 Jahren in Göttingen stirbt. Eine herausragende Leistung Mayers ist die Lösung des Längengradproblems. Eine Positionsbestimmung auf dem Ozean, vor allem der geographischen Länge, war zu Beginn des 18. Jahrhundert noch sehr ungenau. Tobias Mayer konnte das Problem nach jahrelanger Forschung mathematisch lösen, wodurch er einen wichtigen Beitrag zur Schifffahrt leistete. Den hierfür vom englischen Board of Longitude über 3000 Pfund ausgelobten Preis, kann nach jahrelangen Streitigkeiten nur noch seine Witwe im Jahr 1765 entgegennehmen. Das Tobias-Mayer-Museum in Marbach präsentiert heute im Geburtshaus Mayers sein Leben und Wirken.
Januar 2023 - Bierkrug mit Stadtansicht
Januar 2023 - Bierkrug mit Stadtansicht
Bierkrug mit Stadtansicht
Steingut, Zinn
Reinhold Merkelbach, Grenzhausen
Um 1890
(Städtische Museen Esslingen, STME 005720)

Eine Stadtansicht von der Esslinger Neckarhalde auf die Weststadt: Auf den ersten Blick wirkt der Bierkrug wie ein klassisches Souvenir, das von Tourist:innen als Andenken gekauft werden sollte. Auf den zweiten Blick ermöglicht er jedoch spannende Einblicke in das Esslinger Stadtbild Ende des 19. Jahrhunderts.
Der Betrachter schaut von der Neckarhalde aus nach Südosten. Im Mittelpunkt steht das noch recht spärlich bebaute Areal zwischen Roßneckarkanal und Mettinger Straße. Gut zu erkennen ist die Mitte der 1880er Jahre errichtete Uhrmacherwerkzeugfabrik von Gustav Boley mit ihren beiden Schornsteinen und leuchtend roten Dächern. Hinter dem südlichen Gebäudeteil erhebt sich das dreistöckige Gebäude der evangelischen Präparandenanstalt (im Bereich der heutigen Agnespromenade 4). Von 1845 bis ins frühe 20. Jahrhundert wurden hier angehende Volksschullehrer zwei Jahre lang auf ihre Ausbildung in den Lehrerseminaren vorbereitet. Links davon ist ein U-förmiges Gebäude mit schwarz gedeckten Dächern auszumachen. Hierbei handelt es sich um die ehemalige Gemeinschaftskelter der Weingärtnergesellschaft Esslingen. Dieses Gebäude wurde 1862 mit Unterstützung der Stadt auf dem Grundstück des Stierlen’schen Garten gebaut, musste aber Ende der 1960er Jahre dem Bau der Ringstraße ebenso wie viele weitere Gebäude der Innenstadt weichen.
Der Roßneckarkanal wird in dieser Ansicht von zwei Brücken überspannt. Bei der vorderen handelt es sich um den 1745 aus Sandstein erbauten Agnessteg. Der Neubau – die Sankt-Agnes-Brücke – mit seiner Stahlkonstruktion ist noch nicht abgebildet: Dieser Kanalübergang wurde erst 1893 und somit einige Jahre nach der Anfertigung des Bierkrugs errichtet. Die hintere Brücke ist der Übergang zum Kesselwasen; nur angedeutet ist dahinter ein Abschnitt der Inneren Brücke.
An der rechten Uferseite des Kanals ist die grüne Wiesenfläche des Lohwasens zu erkennen. Von der dichten industriellen Bebauung der späteren Weststadt ist noch nichts zu sehen – auch wenn deren Planung und infrastrukturelle Erschließung damals schon im Gange war. Einzig die Gebäude des Holzspaltgeschäfts von Adolf Jahn und der Holzwarenmanufaktur Schöllmann existieren bereits. Diese wurden 1910 durch einen anderen Bau am Roßneckarkanal ersetzt: dem Georgii-Gymnasium. Bei dem schräg hinter den Holzfabriken angrenzenden, länglichen Fachwerkbau handelt es sich um eine Turnhalle. Dieser Vorgängerbau der Schelztorhalle stammte aus dem Jahr 1869, hatte einen weitläufigen Vorplatz in Richtung Innenstadt und diente der benachbarten Realschule, dem späteren Schelztorgymnasium, als Sportstätte.
Die vielen grünen Wiesen, Büsche und Bäume, der hellblaue Neckarkanal, die Weinberge sowie die idyllische Hügellandschaft des Neckartals im Hintergrund erwecken ein romantisches Bild Esslingens. Dass die Stadt im ausgehenden 19. Jahrhundert eine hochentwickelte Industriestadt mit zahlreichen Fabriken war, spielt auf dem Bierkrug jedoch kaum eine Rolle. Lediglich die Boley’sche Firma sowie im rechten Hintergrund die Schornsteine der Wollgarnspinnerei Merkel & Kienlin geben hiervon einen Eindruck. Dass gerade dieser an die Bildtradition romantischer Stadtansichten Esslingens anknüpfende Ausschnitt gewählt wurde, unterstreicht, dass es sich bei diesem Bierkrug um einen Souvenirartikel handelt.
Laut einer Gravur auf dem Klappzinndeckel war der Bierkrug ein Geburtstagsgeschenk. Gefertigt wurde er von der Firma Reinhold Merkelbach aus Grenzhausen im Westerwald. Dieses Unternehmen zählte von 1845 bis 2007 zu den bedeutendsten Unternehmen der Steinzeug-Industrie in Deutschland. Herausragend war dabei die hohe künstlerische Qualität der Bemalungen. Reinhold Merkelbach arbeitete hierfür ab der Jahrhundertwende mit berühmten Künstlern und Architekten des Jugendstils, wie etwa Richard Riemenschmid, Paul Wyland oder Albin Müller zusammen.
Dezember 2022 - Puppenstube der Familien Schreiber und Schimpf
Dezember 2022 - Puppenstube der Familien Schreiber und Schimpf
Puppenstube der Familien Schreiber und Schimpf
Holz, Papier, Blech, Stoff, Kupfer, Steingut, Ton, Keramik, Glas, Plastik, Porzellan, Stroh
Ca. 1880-1940
(Städtische Museen Esslingen, STME 008004 – STME 008008)

Puppenstuben sind in Museumssammlungen keine Seltenheit. Nur wenige sind allerdings stadtgeschichtlich bedeutsam und zudem so umfangreich wie der Neuzugang im Stadtmuseum. Mit Einrichtungsgegenständen aus Küche und Salon bzw. Wohnstube, zahlreichen Püppchen und vielem mehr umfasst sie 688 Einzelteile. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts waren vier Generationen der Familien Schreiber und Schimpf am Sammeln und Zusammenstellen beteiligt. 1987 erwarb der Geschichts- und Altertumsverein Esslingen (GAV) die Puppenstube von Rosemarie Merz. Nach ihrem Tod 2021 ging das Ensemble schließlich in die Sammlung der Städtischen Museen über.
Rosemarie Merz war die Enkelin von Rosa Helene Schimpf, deren Ehegatte Ernst Schimpf Inhaber der Esslinger Handschuhfabrik Bodmer war. Rosa Helene Schimpf wurde im Gebäude Hafenmarkt 7, dem heutigen Stadtmuseum geboren. Ihre Eltern waren der Komponist Christian Fink und Rosa Fink, die älteste Tochter vom Verlagsgründer Jakob Ferdinand Schreiber. Als solche erbte sie 1867 das Gelbe Haus von ihrem Vater und wohnte dort mit ihrer Familie bis zu ihrem Tod 1912. Die Puppenstube erhielt Rosa Fink vermutlich schon als kleines Mädchen und spielte damit bereits in den 1840er Jahren im Gebäude des heutigen Stadtmuseums.
Im Laufe der Jahrzehnte wuchs das Inventar immer weiter an, sodass das Ensemble eine unglaubliche Vielfalt aufweist. Von der winzigen Stricknadel bis hin zum stattlichen Backofen ist alles dabei, was Kinderherzen einst höherschlagen ließ. Dabei waren Puppenstuben ursprünglich gar nicht als Spielzeug gedacht. Seit dem 16. Jahrhundert stellten wohlhabende Patrizierfamilien ihren Reichtum zur Schau, indem sie ihre Wohnhäuser im Miniaturformat nachbauen ließen. Spielen war allein aufgrund der kostbaren und meist sehr fragilen Ausstattung natürlich nicht erwünscht. Ende des 18. Jahrhunderts kam eine neue pädagogische Sicht auf das Spielverhalten der Kinder auf. Ging man zuvor noch davon aus, dass Spielen ein unnötiger Zeitvertreib war, erkannte man nun den damit verbundenen Lerneffekt. In der Folge bestanden Puppenstuben nicht mehr aus kompletten Gebäuden, sondern wurden kindlichen Maßen angepasst und begrenzten sich auf einzelne Räume, die nach oben hin geöffnet waren. Besonders beliebt waren dabei Küchen und Salons bzw. Wohnstuben.
Die möglichst wirklichkeitsnahe Gestaltung der Puppenstuben liefert heute ein Spiegelbild der einstigen bürgerlichen Wohnkultur und deren Wandel im Laufe der Jahrzehnte. Dies lässt sich auch in der Puppenstube der Familien Schreiber und Schimpf erkennen. Große Holzmöbel, Kamine, goldene Tischuhren oder Vogelkäfige zeigen das Bild einer typischen bürgerlichen Wohnstube im ausgehenden 19. Jahrhundert. An der Puppenküche lässt sich wiederrum ein Wandel erkennen. So steht der eiserne Herd mit integrierten Backröhren für eine neue Art des Kochens, die erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts aufkam. Zuvor wurde in Küchen noch über offenem Feuer mit Rauchfang gekocht.
Auf den ersten Blick wirkt das Ensemble mit seinen liebevoll gestalteten und teilweise überaus filigranen Teilen besonders hochwertig. Tatsächlich handelt es sich aber zum Großteil um industriell hergestellte Massenware. So wurden beispielsweise die Blechmöbel der Wohnstube in den 1880er Jahren von der Biberacher Firma Rock & Graner gefertigt. Diese war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts der größte Hersteller von Blechspielzeugen in Deutschland. Dementsprechend sind die Produkte der Firma auch heute noch relativ häufig zu finden. In der Puppenstube der Familien Schreiber und Schimpf dürften sie zu den ältesten Teilen zählen. Als eindeutig der ersten Generation zugehörig, also den Kindheitstagen von Rosa Fink, geb. Schreiber, ist bei der hier vorgestellten Puppenstube nichts mehr zu identifizieren. Gleichwohl ist die Puppenstube ein Abbild bürgerlicher Wohnkultur des 19. Jahrhunderts und zeigt, dass diese auch im Gelben Haus in Esslingen besonders wertgeschätzt wurde.
November 2022 - Notgeld
9 Geldscheine im Wert von 500.000 bis 20 Milliarden Mark
August-September 1923
Papier, Offsetdruck
F. Schreiber-Verlag, Esslingen
(Städtische Museen Esslingen, STME 007892.1-9)

„Haben Sie Interesse an einer Zigarrenkiste voller Geldscheine? Ungefähr 20 Milliarden Mark.“ – Wer einen solchen Anruf erhält, wird wohl erst einmal misstrauisch. In diesem Fall handelte es sich jedoch um keinen Telefonbetrug, sondern um ein Angebot an die Städtischen Museen über Esslinger Papiernotgeld aus der Zeit der Hyperinflation im Jahr 1923. Als die Scheine im August und September 1923 im Verlag J. F. Schreiber gedruckt wurden, kostete ein Zentner Mehl bereits mehrere Millionen Mark.
Millionen und Milliarden Mark – und dennoch kaum das Papier wert, auf dem die Geldscheine gedruckt wurden. Seit 1914 hatte sich mit Beginn des Ersten Weltkriegs der Wert der Mark stetig verschlechtert. Kostete ein Dollar 1914 noch 4,20 Mark, so waren es im Juli 1922 bereits 500 Mark; im November 1923 stattliche 4,2 Billionen Mark. Die Staatsverschuldung des Deutschen Reichs war ab Kriegsbeginn 1914 durch die Kosten der Kriegsführung und verschiedene Anleihen in ungeahnte Höhen gestiegen. Warenmangel begünstige Preissteigerungen, Münzen wurden schrittweise aus dem Verkehr gezogen und durch Papiernotgeld ersetzt. 1918 mit Ende des Ersten Weltkriegs stand das Deutsche Reich vor einem riesigen Schuldenberg und gleichzeitig vor der Herausforderung des Wiederaufbaus, der Versorgung der Kriegsversehrten und der immensen Reparationsforderungen der Siegermächte. Letztere wurden mit 132 Milliarden Goldmark beziffert. Die Zahlungen galten als unerfüllbar, und die Einnahmen des Staats konnten die Ausgaben bei Weitem nicht decken. Die Währung verfiel weiter. Das Deutsche Reich stand wirtschaftlich gesehen bereits mit dem Rücken zur Wand, als im Januar 1923 belgische und französische Truppen ins Ruhrgebiet einmarschierten, um sich „Pfänder“ für die nicht gezahlten Reparationen zu holen. Die Bevölkerung trat daraufhin in den Streik, um passiven Widerstand zu leisten. Die Regierung bezahlte sie dafür mit Banknoten, die in immer größerer Zahl gedruckt werden mussten – die Hyperinflation nahm ihren Lauf. In 133 Privatdruckereien wurde Tag und Nacht Geld gedruckt auf Papier, das in 30 Papierfabriken produziert wurde. Innerhalb von 9 Monaten wurden 10 Milliarden Geldscheine in einem Wert von 3 877 000 000 000 000 000 000 (=3,8 Trilliarden) Mark gedruckt und ausgegeben. Weil selbst diese Papiergeldmasse nicht ausreichte, um im Deutschen Reich die Löhne auszubezahlen, gaben Kommunen und Betriebe aller Art schließlich eigenes Notgeld heraus – so auch die Stadt Esslingen.
Im Gemeinderatsprotokoll vom 27. August 1923 ist nachzulesen, dass der Esslinger Verlag J. F. Schreiber mit dem Druck beauftragt wurde und dafür mit 260 Goldmark (!) entlohnt wurde. Für die Nummerierung der Scheine erhielt der Verlag weitere 125 Millionen Mark. Das Notgeld wurde im Offset-Verfahren auf Wasserzeichenpapier gedruckt und zeigt auf der Vorderseite im rechten Bildfeld den Reichsadler mit den auf der Brust prangenden Buchstaben CE (Civitas Esslingensis). Das linke Bildfeld ziert die Frauenkirche mit der Burg im Hintergrund. Außer dem Nennwert wird auch die Herausgeberin der Scheine, die Stadtgemeinde Esslingen genannt, sowie das Datum der Ausgabe. Aufgedruckte sechsstellige Kontrollziffern sollten die Scheine zusätzlich vor Fälschung schützen. Die Rückseiten blieben unbedruckt. Der Gemeinderatsbeschluss legte fest, dass 30.000 Scheine à 500.000 Mark und 70.000 Scheine à 1 Million Mark gedruckt werden sollten – also insgesamt 85 Milliarden Mark. Dass das nahezu wertlose Papiergeld auch als Schmierpapier oder für Notizen herhalten musste, zeigt einer der Millionen-Scheine. Die Inflation kannte indes kein Halten; schon Mitte September gab die Stadt weiteres Notgeld heraus. Die Scheine, die Ende September mit Milliardenwerten in Umlauf kamen, hatten nicht einmal mehr Kontrollziffern aufgedruckt. Statt der Frauenkirche zeigen sie nun die Stadtkirche St. Dionys. Wie die Eßlinger Zeitung aus diesen Wochen belegt, hatte ein Laib Brot am 1. September noch 160.000 Mark gekostet, am 6. Oktober waren es schon 10 Milliarden Mark. Im November schließlich druckte die Stadt Scheine mit dem Nennwert einer Billion – nun allerdings nicht mehr bei J. F. Schreiber, sondern der Kunst- und Werbedruck GmbH. Erst mit der Gründung der Deutschen Rentenbank im Oktober und der Einführung der Rentenmark Mitte November 1923 kam es nach und nach zu einem Preisrückgang und zu einer Stabilisierung. Reichsbanknoten bleiben übergangsweise noch im Umlauf, doch Notgeld wurde nicht mehr akzeptiert.
Oktober 2022 - Trinkglas "Esslinger Hofbräu"
Oktober 2022 - Trinkglas "Esslinger Hofbräu"
Bierglas „Esslinger Hofbräu“
Glas
1909-1918
(Städtische Museen Esslingen, STME 007870)

Die Brauereien Stuttgarter Hofbräu und Hofbräu München dürften wohl allseits bekannt sein. Schließlich existieren sie heute noch und haben sich zu Großbrauereien in Deutschland entwickelt. Dass es aber auch einmal ein Esslinger Hofbräu gab, ist wohl eher unbekannt. Diesen Titel erhielt die Esslinger Brauereigesellschaft am 25. Februar 1909 vom Württembergischen Königshaus.
Bereits seit dem 18. Jahrhundert verlieh der württembergische Monarch wichtigen Handwerkern den Titel eines Hofhandwerkers. Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert kam die Mode auf, dass der König auch externe Firmen und Geschäfte als Hoflieferanten auszeichnete. Der Titel war sehr begehrt, konnte er doch als wichtige Werbemaßnahme der Unternehmen eingesetzt werden. Ihn zu erlangen setzte jedoch einiges voraus. So mussten die entsprechenden Firmen eine solide wirtschaftliche Position und einen guten Ruf haben sowie regelmäßig Waren an den Hof liefern. Als Hoflieferant durfte die Esslinger Brauereigesellschaft auch eine minimal abgewandelte Form des königlichen Wappens führen. So sind etwa die Eichenblätter im offiziellen Wappen Gold, beim Esslinger Hofbräu jedoch Grün. Auch ist das rote Band, in welchem die Inschrift „Furchtlos und Treu“ steht, im königlichen Wappen länger und an den Enden zweigeteilt. Titel und Wappen wurde von der Brauerei auf Biergläser und Firmenschilder gedruckt sowie im Briefpapier geführt. Neben der Brauereigesellschaft erhielten im Laufe der Zeit auch andere Esslinger Firmen das Privileg eines königlichen Hoflieferanten, etwa die Sektkellerei Kessler (seit 1881), die Fotografie- und Lichtdruckanstalt von Karl Liebhardt (seit 1894) oder die Dekorationsmaler Hermann Roller und Karl Häuser (seit 1903).
Spätestens zum Zeitpunkt der Verleihung dieses Titels durch den württembergischen König hatte es die Esslinger Brauereigesellschaft geschafft, sich unter den großen Brauereien Württembergs zu etablieren. Die Gründung des Unternehmens geht auf das Jahr 1888 zurück, in welchem sich die beiden Brauereien Kugel und Brodbeck zusammenschlossen. Martin Kugel errichtete bereits 1868 eine Dampfbrauerei in der Bahnhofstraße 11 und machte sich schnell einen Namen als Produzent von Weißbier nach Berliner Art, das sogenannte „Kühle Blonde“. Nach der Gründung der Brauereigesellschaft wurde diese Brautradition fortgesetzt, jedoch aus dem Unternehmen ausgegliedert. Als Tochtergesellschaft wurde hierfür 1899 die Erste Württembergische Weißbierbrauerei gegründet. Die Braustätte befand sich weiterhin in der Bahnhofstraße, wo auch eine Brauereigaststätte samt Saal betrieben wurde. Als Kugel’s Festsaal erlangte dieser in der ganzen Stadt große Bekanntheit und galt in den nächsten Jahrzehnten als zentraler Veranstaltungsort Esslingens.
Die Esslinger Brauereigesellschaft hatte ihre Produktionsstätte in den Gebäuden Zollbergstraße 1, 3 und 5. Der jährliche Bierabsatz von bis zu 40.000 Hektoliter setzte sich aus drei Biersorten zusammen: helles Lagerbier, helles Märzenbier sowie das besonders erfolgreiche dunkle Burgbräu. Ob es sich beim Esslinger Hofbräu lediglich um eine bestimmte Biersorte handelte oder die Brauerei sich für die Jahre, in denen sie Hoflieferant war, offiziell umbenannte, ist nicht eindeutig festzustellen.
1932 wurde die Brauereigesellschaft durch die Stuttgarter Brauerei Robert Leicht AG, später als Schwaben-Bräu bekannt, übernommen und der Betrieb eingestellt. Das große Brauereiareal in der Zollbergstraße sollte eigentlich ihren ursprünglichen Zweck beibehalten und als weitere Produktionsstätte für den neuen Besitzer dienen, wurde jedoch 1937 zur Fliegerschule des Nationalsozialistischen Fliegerkorps umfunktioniert.
September 2022 - Gotischer Wohnturm
September 2022 - Gotischer Wohnturm
Gotischer Wohnturm
13. Jahrhundert
Stein, Holz, Eisen, Ton
(Hafenmarkt 7, 73728 Esslingen)

Der massive Wohnturm wurde um 1269 errichtet und bildet somit den ältesten Teil des Gelben Hauses am Hafenmarkt, in dem sich heute das Stadtmuseum befindet. Er ist der letzte noch vollständig erhaltene Geschlechterturm in Esslingen. Mit seiner beinahe 800jährigen Geschichte und vier Geschossen ist er das größte „Ausstellungsstück“ des Stadtmuseums.
Wirtschaftlicher Aufschwung und Bevölkerungswachstum führten im 13. Jahrhundert zu einer erhöhten Bautätigkeit in Esslingen. Die Mehrheit der Wohnhäuser in dieser Zeit waren Fachwerkbauten, doch dürfte es außer dem steinernen Wohnturm am Hafenmarkt noch zahlreiche vergleichbare Turmhäuser in Esslingen gegeben haben. Von ihnen sind heute nur noch wenige Reste wie etwa Spuren in Kellern nachweisbar (z.B. in der Landolinsgasse 16). Alle heute bekannten Wohntürme befanden sich nicht im Bereich der Stadtmauer, sind also nicht als Teil der Befestigungsanlage bzw. Wehrtürme zu verstehen. Durch ihre massive Bauweise – das Mauerwerk am Fuße unseres Turms ist bis zu 1,60m stark – hatten sie jedoch einen „passiven Wehrcharakter“, d.h. bei Bedarf konnte man sich darin verschanzen und verteidigen.
Als der Turm am Hafenmarkt im 13. Jahrhundert errichtet wurde, war er von Osten her über zwei Türen im Keller und im Erdgeschoss zugänglich. Die Obergeschosse waren innerhalb des Turmes über schmale Stiegen miteinander verbunden. Das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss sind bis heute jeweils mit einer Holzdecke versehen, während das zweite Obergeschoss von einem Tonnengewölbe überspannt wird. Die hölzernen Balken der Erdgeschossdecke konnten mithilfe der Jahrringe auf die Zeit zwischen 1259 und 1269 datiert werden. Spätestens in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde an der Ostseite ein Fachwerkbau mit massivem Erdgeschoss an den Turm angebaut, worauf der Kellerabgang mit zwei Wappenfeldern hinweist. Dieser Anbau fiel dem Brand von 1654 zum Opfer und wurde anschließend neu errichtet, bis er 1701 wiederum abbrannte.
Noch heute sind an der Westseite die frühgotischen, zweiteiligen Fensteröffnungen vorhanden. Auch an der Südseite konnten 1977–1979 bei der Sanierung vergleichbare Fensteröffnungen nachgewiesen werden. Im Inneren befinden sich an der Westseite hinter den Fenstern Sitznischen, so genannte Estraden. Sie sind jeweils von einem Rundbogen überspannt; links und rechts laden Bänke zum Sitzen ein. Eiserne Scharnierhaken und Riegellöcher belegen, dass ursprünglich alle Fenster mit Klappläden verschlossen oder – wie im Falle des Erdgeschosses – mithilfe von Querbalken sogar verbarrikadiert werden konnten. Im zweiten Obergeschoss befindet sich in die Wand eingelassen ein Tresor mit eisenbeschlagener Tür.
Der Erker im ersten Obergeschoss wurde erst in der Renaissancezeit ergänzt. Er ist nicht aus Stein, sondern als Fachwerk gearbeitet. Nur die so genannte Kragplatte, die den Boden des Erkers bildet, sowie die drei Stützen unterhalb der Platte sind aus Sandstein gefertigt. Bei der Renovierung 1979 ersetzte man die fein gearbeitete Schieferdeckung des Dachs.
Die östliche Außenwand des Turms weist starke Brandschäden auf: Der Stein ist rötlich bis schwarz verfärbt und die Oberfläche zeigt zahleiche Abplatzungen. Die Spuren zeugen von den verheerenden Bränden 1654 und 1701, denen der steinerne Turm widerstand. Im Ratsprotokoll vom November 1701 heißt es, der Turm „schölt sich überall ab und dörfte nechtens gar einfallen.“ 1702 entstand der nördliche, repräsentative Anbau; der bereits erwähnte östliche Anbau wurde ab 1739 erneut errichtet und zog sich nun bis zur Südseite vor den Turm. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war der Steinturm über den Anbau und nicht mehr über Stiegen im Inneren begehbar. Seine barocke Farbfassung wurde bei der Renovierung 1979 wiederhergestellt: Gelb mit aufgemalter Eckquaderung und aufgemaltem Schlussstein.
August 2022 - Fotomappe der Familie Deffner
August 2022 - Fotomappe der Familie Deffner
Fotomappe der Familie Deffner
Um 1890
Leder, Seide, Gold, Silber, Papier
(Städtische Museen Esslingen, STME 007857)

„Die Metallbeschläge wiesen eine ungleichmäßige goldgelbe bis dunkle Färbung auf, weshalb auf Buntmetall (Messing o.ä) geschlossen wurde. Bei der tatsächlichen Betrachtung zeigte sich, dass alle vier Beschläge womöglich aus Silber gearbeitet sind und fein vergoldete Binnenflächen aufweisen.“ (Joachim Lang, Restaurator)
Dass es sich bei der Mappe nicht nur um ein Zeugnis der Esslinger Industriegeschichte, sondern auch um eine kunsthandwerkliche Kostbarkeit handelt, war nach der Übergabe durch die Vorbesitzerin an die Städtischen Museen rasch klar. Dass eine Behandlung durch einen Restaurator nötig war, um das Kleinod bestmöglich zu erhalten, ebenfalls. Bevor die oben genannten Metallbeschläge der ledergebundenen Fotomappe im Februar 2022 von Joachim Lang unter die Lupe genommen wurden, sprang vor allem das kunstvoll gestaltete Lederemblem auf dem Buchdeckel ins Auge: In einem mit Bändern und Schleifen verzierten Lorbeerkranz prangt ein Wappenschild mit Schlingen und Ranken. Erst auf den zweiten Blick offenbart sich, dass es sich bei den Ornamenten im Inneren um ein prächtig geschwungenes D handelt. Dieses steht für „Deffner“ – Familienname und Name der berühmten Esslinger Metallwarenfabrik C. Deffner.
Die Eckbeschläge dienten dem Schutz der Deckelecken und des Deckelüberzugs, waren aber auch Schmuck. Vier große Buckel sorgen für Abstand zur Tischplatte, wenn das Buch aufgeschlagen ist, damit das Lederemblem nicht auf der Tischfläche zu liegen und zu Schaden kommt. Der Hersteller der Beschläge ist unbekannt; eine Schlagmarke ist nicht vorhanden. Die fortschreitende Industrialisierung hatte im Buchbinderbereich dafür gesorgt, dass es eine Konzentration von wenigen Zuliefererbetrieben gab, die Buchbeschläge und -verschlüsse als Halbfabrikate auslieferten – zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es im deutschsprachigen Raum lediglich fünf Großhändler. Dass überhaupt derartige Eckbeschläge zum Einsatz kamen, liegt ebenfalls in der industriellen Entwicklung begründet: Der durch die Industrialisierung hervorgerufene gesellschaftliche Wandel sorgte im Bereich der Kunst auch für Gegenbewegungen und Strömungen wie den Historismus, bei welchem man sich auf vergangene Formen zurückbesann und diese wiederaufgriff. So ist es zu erklären, dass ein barock anmutender Beschlag ein Fotoalbum des späten 19. Jahrhunderts ziert.
Die anspruchsvolle und kostbare Gestaltung der Mappe setzt sich im Inneren fort: So ist die Innenseite mit dunkelblauer Seide ausgeschlagen. Links unten hat sich der Kunsthandwerker verewigt, aus dessen Werkstatt die Mappe stammt: A. Feucht. Der Stuttgarter Albert Feucht betrieb als Hoflieferant eine kunstgewerbliche Werkstatt für Lederarbeiten, die in Württemberg zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter anderem für die gehobene Stuttgarter Möbelindustrie und weitere Kunstgewerbe tätig war. Die beiden lose eingelegten Seiten mit 21 Fotografien zeigen jeweils in der Mitte Wilhelm Deffner (1829–1897), Enkel von Carl Christian Ulrich Deffner, auf den die Metallwarenfabrik
C. Deffner zurückgeht. Wilhelm übernahm die Firma in dritter Generation 1877. Er ließ den Betrieb 1887 erstmals ins Handelsregister eintragen. Im Gegensatz zu seinem Vater und Großvater hielt er die Geschäftsführung nicht bis zu seinem Tode inne, sondern übergab sie noch zu Lebzeiten an seine Söhne Carl und Otto Deffner. Die Fotografien in der Mappe wurden vom Esslinger Fotografen Karl Liebhardt angefertigt. Der gebürtige Stuttgarter und spätere königlich-württembergische Hoffotograf betrieb ab 1880 ein Fotoatelier in Esslingen. Besonders bekannt ist er heute für seine Ansichtskarten.
Juli 2022 - Kandelmarsch-Leiter
Juli 2022 - Kandelmarsch-Leiter
Kandelmarsch-Leiter
Holz
(Leihgabe T.V. Arminia Esslingen)

Leitern – einfach zu transportierende Geräte zum Hinauf- und Hinabsteigen – sind seit langer Zeit nützliche Gebrauchsgegenstände überall auf der Welt und damit ein, wenn auch unspektakuläres, Gut der Menschheit als Ganzes. Ob im Bergbau oder bei der Brandbekämpfung, ob bei der Erstürmung von Stadtmauern oder der nächtlichen Eroberung von Herzen, wenn es an Haus, Hof und Dach etwas zu reparieren gilt, oder schlicht bei der Obsternte – die einfache Fügung von hölzernen Sprossen mit zwei seitlichen Holmen ergibt ein höchst zweckmäßiges Gerät mit breitesten Einsatzmöglichkeiten. Waren die frühesten bekannten Steighilfen schräg gestellte eingekerbte Baumstämme, sind heutige Exemplare überwiegend aus Aluminium gefertigt. Ob kurz oder lang, breit oder schmal, sind sie stets mit Prüfzeichen versehen, die ihre Sicherheit und Standfestigkeit ausweisen, denn sie unterliegen im Besonderen den Gesetzen des Arbeitsschutzes und sind im Allgemeinen mit einiger Vorsicht zu gebrauchen.
Die Farbgebung und die Anzahl der Sprossen der ausgestellten Leiter lassen es schon erahnen: Der Zweck dieser besonderen Leiter war und ist ein anderer. Sie kommt beim Esslinger Kandelmarsch zum Einsatz. Damit ist sie das nicht ganz unwesentliche Requisit eines studentischen Brauchs, bei dem Studenten der Hochschule Esslingen mit geschulterten Leitern, immer einen Fuß auf den Bürgersteig und einen auf den Rinnstein – den Kandel – setzend, im Gleichschritt durch Esslingen ziehen, um diverse Kneipen und Gaststätten anzusteuern, wo ihnen ein Freibier winkt. In diesem Sommer feiert dieser fröhliche Brauch sein einhundertjähriges Bestehen. Er wurde rasch Bestandteil der „Kandidatenabfuhr“ – also der feierlichen Verabschiedung der Examenskandidaten der Württembergischen Maschinenbauschule Esslingen, der heutigen Hochschule Esslingen, nach bestandenem Studium.
Der Legende nach hatte alles mit einem feucht-fröhlichen Kneipenabend einiger Studenten in der Zollbergwirtschaft angefangen. Nach der Sperrstunde wanderten die Kneipengänger um 1 Uhr morgens noch den Zollberg hinauf, wo sie auf einem Baumgrundstück eine etwa 30-sprossige Leiter mitnahmen. Die Leiter wurde kurzerhand geschultert und im Gleichschritt ging es auf der Straße in Richtung Stadt. Die fröhliche Runde kam auf ihrem Weg zweimal mit Hütern des Gesetzes in Konflikt. Beim ersten Mal ermahnte sie ein Schutzpolizist bei der Pliensaubrücke, nicht mitten auf dem Weg sondern auf dem Bürgersteig zu gehen. Beim zweiten Mal auf der Höhe der Inneren Brücke war es wiederum ein Wachtmeister, der, um dem Ulk ein Ende zu bereiten, der Gruppe befahl, ihm auf die Wache zu folgen und dabei gefälligst nicht auf dem Bürgersteig zu gehen. Die angeheiterten Studenten reagierten auf die offensichtliche Widersprüchlichkeit in den Anordnungen der Obrigkeit auf ihre Weise, taten ganz wie befohlen und folgten dem Wachtmeister mit je einem Bein auf dem Bürgersteig und mit dem anderen auf dem Kandel gehend – der Kandelmarsch war geboren!
Juni 2022 - Städtepartnerschaftsurkunde Esslingen - Vienne
Juni 2022 - Städtepartnerschaftsurkunde Esslingen - Vienne
Städtepartnerschaftsurkunde Esslingen - Vienne
Pergament, Tusche
1969
(Stadtarchiv Esslingen, StAE, Ref. Städtep. Nr. 12)

Seit kurzem verwahrt das Stadtarchiv Esslingen die Städtepartnerschaftsurkunde, die Esslingen und die französische Stadt Vienne freundschaftlich miteinander verbindet. Das zweisprachige Dokument wurde - rund 25 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs - am 16. Oktober 1969 vom Esslinger Oberbürgermeister Eberhardt Klapproth (1966-1989) und dem Vienner Bürgermeister Maurice Chapuis (1959-1971) feierlich unterzeichnet. Die zuvor im Referat für Städtepartnerschaft verwahrte Urkunde wurde ungewöhnlicherweise - wohl dem besonderen Anlass geschuldet – auf Pergament ausgefertigt. Mit der Urkunde bekennen beide Partnerstädte, zu „einer friedlichen Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland […] und damit zur Sicherung einer glücklichen Zukunft in einem geeinten Europa“ beitragen zu wollen. Damit verpflichteten sich die beiden Städte ganz dem Geist des wenige Jahre zuvor zwischen Frankreich und Deutschland unterzeichneten Élysée-Vertrags.
Mit dem Élysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 hatten der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer die Aussöhnung der lange Zeit verfeindeten Länder Frankreich und Deutschland besiegelt und damit die Grundlage für einen dauerhaften Frieden zwischen den beiden Staaten und darüber hinaus für ganz Europa gelegt. Dem vorausgegangen war de Gaulles vielbeachtete „Rede an die deutsche Jugend“ im Jahr 1962 in Ludwigsburg, in der der französische Staatspräsident der Hoffnung Ausdruck verlieh, dass künftige Generationen von Franzosen und Deutschen in einem gemeinsamen Europa in Frieden miteinander leben könnten. In der Folge vereinbarten viele deutsche und französische Kommunen Partnerschaften und initiierten regelmäßige Austausch- und Besuchsprogramme insbesondere für Jugendliche. Damit leisteten sie einen wichtigen Beitrag dazu, die „Erbfeindschaft“ Deutschlands und Frankreichs zu überwinden, die innerhalb eines knappen Jahrhunderts dreimal Krieg mit Millionen Toten auf beiden Seiten gegeneinander geführt hatten.
In Esslingen bestanden bereits vor der offiziellen Aussöhnung Deutschlands und Frankreichs Kontakte zu der Stadt Vienne im Département Isère, die der Völkerverständigung dienten: Im Juli 1958 besuchte eine erste Esslinger Gruppe im Rahmen eines Jugendaustauschs die spätere Partnerstadt. Im Jahr 1969 beschlossen die Gemeinderäte beider Städte, die Freundschaft auch öffentlich zu besiegeln. Bürgermeister Chapuis reiste hierfür mit einer Delegation aus Vienne nach Esslingen. Die Verschwisterungsfeier fand um 20 Uhr in der Stadthalle statt. Der nächste Tag war für Stadtrundfahrten und Empfänge vorgesehen, bevor die französische Delegation am Sonntag wieder abreiste. Über die Jahre entstand ein ständiger gegenseitiger Austausch, dem sich viele Freundschaften und auch Ehen und Kinder verdanken.
Der Esslinger Gemeinderat nahm darüber hinaus 1968 Partnerschaftsverhandlungen mit der Walisischen Stadt Neath und Udine in Italien auf. Die schwedische Stadt Norrköping und Shiedam in den Niederlanden sollten später folgen. 1983 unterzeichneten die Oberbürgermeister dieser Städte sowie die neu dazu gekommene Stadt Velenje im heutigen Slowenien gemeinsam mit Vertretern der Stadt Esslingen neue Urkunden in Vienne, um „dauerhafte Bande aufrechtzuerhalten“. Anlass war das 25-jährige Jubiläum der ersten Partnerschaft zwischen Esslingen und Vienne.
Mai 2022 - Stickmustertuch der Arbeitsschule Esslingen
Mai 2022 - Stickmustertuch der Arbeitsschule Esslingen
Stickmustertuch der Arbeitsschule Esslingen
Leinen, Baumwolle
1880
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 007875)

Weit gereist ist dieses Esslinger Sticktuch aus dem späten 19. Jahrhundert: In den 1950er Jahren wurde es in rund 8300 km Entfernung auf dem Dachboden eines Hauses in Littleton im Bundesstaat Colorado in den USA entdeckt. Sorgfältig gerahmt hatte es daraufhin viele Jahrzehnte im Besitz der Familie verbracht, bis es schließlich im Jahr 2022 nach Esslingen zurückkehrte.
Das grob gewobene Tuch ist annährend quadratisch und an den Rändern mit einer eingewobenen farbigen Borte in Rot und Grün, den Esslinger Stadtfarben, verziert. Muster, Buchstaben und Zahlen in verschiedenen Farben wurden auf das Tuch gestickt, um unterschiedliche Garne und Sticktechniken zu erproben und zu üben. Die präzise Anordnung und die Ausführung der Geradstiche, Kreuzstiche und Kettenstiche zeigen, dass mit großem Geschick und Sorgfalt vorgegangen wurde. Gefertigt wurde das Werkstück von E. W. – wer sich dahinter verbirgt, ist leider ungewiss.
Bekannt hingegen ist der Ort, an dem die Handarbeit geübt wurde, nämlich die Arbeitsschule Esslingen. 1816 wurde das Kinderarbeits-Institut gegründet, als sich die ohnehin desolate finanzielle Lage der Bürger:innen und der Stadt durch eine Reihe von Missernten dramatisch verschlechterte. Die „klägliche Verwilderung so vieler Kinder in dem zunehmenden Gassen-Bettel“ führte zur Gründung des Esslinger Armenvereins, der Wolle, Stoff, Papier und andere Materialien sowie Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Dort wurden die Kinder beschäftigt und zur „“ angehalten, „da diese die einzige Quelle des Wohlstandes […] ist.“ Sie fertigten Papiertüten und Flechtarbeiten, verlasen Baumwolle, spannen, strickten, nähten und stickten. Die fertigen Erzeugnisse wurden verkauft. Weil die Zahl der teilnehmenden Kinder beständig wuchs, waren die Räume bald zu klein. Das Institut zog in den Waisenhof um; in den 1850er Jahren wurde sogar noch ein weiteres Institut eingerichtet, das aber rund zehn Jahre später wieder aufgelöst wurde. In den 1870er Jahren wurde das Arbeits-Institut hauptsächlich noch von Mädchen besucht. Die Ortsschulbehörde kam zu der Ansicht, die Kinder kämen nur noch wegen des Vesperbrots und das Institut sei somit keine Lernanstalt mehr, sondern eine Bewahranstalt. In der Folge wurde es 1883 seitens der Ortsarmenbehörde aufgelöst. Der bereits 1876 an der Mädchenvolksschule eingeführte Handarbeitsunterricht sollte diese Institution ersetzen, deren erstes Ziel eigentlich die Lohnarbeit gewesen war. Wie das Sticktuch seinen Weg in die Vereinigten Staaten gefunden hat, ist nicht bekannt. Genau wie das Tuch selbst könnte auch sein Fundort ein Beleg für Armut sein: Vielleicht erhoffte sich die Familie ein besseres Leben in Amerika und wanderte deshalb aus.
Stickmustertücher sind selbstverständlich keine Esslinger Erfindung. Ab dem 18. Jahrhundert wurden sie in Europa angefertigt; im islamischen Raum kennt man sie bereits seit dem 9. Jahrhundert. Ihr Zweck war zunächst vor allem das „Notieren“ von neuen Mustern, aber natürlich auch die Übung und Demonstration der eigenen Geschicklichkeit. Insbesondere die jüngeren Tücher waren jedoch einfach Bestandteil des Handarbeitsunterrichts an Schulen. Die Sammlung der Städtischen Museen umfasst bereits einige Stickmustertücher. Dass dennoch ein weiteres Tuch aufgenommen wurde, liegt daran, dass es durch seine Aufschrift „Arbeits=Schule Esslingen“ und die genaue Datierung in einen klaren Kontext gestellt werden kann. Es repräsentiert die soziale Wirklichkeit in Esslingen im späten 19. Jahrhundert, als die fortgeschrittene Industrialisierung mit ihren sozialen Fragen von der Gesellschaft Antworten erforderte. Die Gründung von Industrie- und Arbeits-Schulen im ganzen Königreich Württemberg war eine dieser Antworten.
April 2022 - Holzmodell der Stadtkirche
April 2022 - Holzmodell der Stadtkirche St. Dionys
Holzmodell der Stadtkirche St. Dionys
Holz, Karton
1910-1915
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 007871)

Die Esslinger Stadtkirche St. Dionys als Holzmodell im Maßstab 1:50: 1,39 Meter lang und 1,12 Meter hoch, aus tausenden kleinen Teilen zusammengebaut - allein das Dach ist mit 4.290 identischen Dachziegeln gedeckt. Nicht nur mit seinen Maßen und detailverliebter Kleinstarbeit beeindruckt das Modell (Hobby-)Handwerker:innen und Laien. Mindestens genauso spannend ist die Geschichte, die hinter dem neuesten Zugang der Sammlung des Stadtmuseum steckt.
Alles begann 2019 mit einer Recherche für eine Führung in der Stadtkirche St. Dionys. Der Kirchenführer Manfred Wörner suchte hierfür Informationen im Internet und stieß dabei auf eine Postkarte aus den 1910er Jahren, die eine schwarz-weiß Aufnahme eben jenes Modells zeigt. Erbaut wurde es laut Postkarte von Otto Gottlob Nord. Der leidenschaftliche Papiermodellkonstrukteur Wörner war sofort begeistert vom Detailreichtum des Modells und fragte sich, ob es noch existierte. Er startete einen Aufruf im Gemeindebrief der evangelischen Stadtkirchengemeinde, auf welchen er keine Rückmeldungen erhielt. Jedoch war nun das öffentliche Interesse geweckt und so erschienen 2019 zwei weitere Artikel über Wörners Suche in der Zeitschrift des Kirchenbezirks sowie in der Eßlinger Zeitung. Da Wörner auch auf diese beiden Berichte hin keine Hinweise erhielt, gab er die Suche zu diesem Zeitpunkt auf. Als Glücksfall entpuppte sich dann eine erneute Veröffentlichung des Artikels in der Eßlinger Zeitung am 20. April 2020. Am Tag darauf erhielt Wörner zahlreiche Anrufe und Emails von Esslinger:innen, die ihm Hinweise zur Familie Nord gaben. Mit dem letzten Anruf kam dann der Volltreffer: Der Enkel Otto Nords war am Apparat und berichtet, dass sich das Kirchenmodell noch bis Februar 2018 auf dem Dachboden seines ehemaligen Hauses in Aichwald-Scharnbach befand. Über einen alten Schulfreund suchte Manfred Wörner den Kontakt zu den aktuellen Hauseigentümer:innen. Tatsächlich besaßen diese noch das vollständige Modell, das in der Garage aufgebaut war. Der Fund dieses spektakulären Objekts kam gerade noch rechtzeitig. Die Hauseigentümer:innen planten Umbaumaßnahmen und das Modell hätte hierfür Platz machen sollen. Manfred Wörner war somit zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Einige Tage später wäre das Modell wohl entsorgt worden. Die Eigentümer:innen überließen Wörner daher das Kirchenmodell bereitwillig, welcher es Anfang des Jahres dem Stadtmuseum schenkte.
Auch die Geschichte des Erbauers des Modells ist eindrucksvoll. Otto Gottlob Nord wurde 1880 in Esslingen geboren und war von Beruf Schreiner. Er war der Onkel von Paul Nord, dessen Frau Luise 1953 ein Kaufhaus in der Pliensaustraße eröffnete, welches bis in die 1970er Jahre unter dem Namen „Nord, Haus der Mode“ bestand. Im Alter von 30 Jahren wurde bei Otto Gottlob Nord ein Hirntumor diagnostiziert. Nord überlebte diese Krankheit, war allerdings nach einer Operation stark sehbehindert. Eine Weiterführung seiner Arbeit als Schreiner war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Er suchte wohl nach einer Möglichkeit, trotzdem zum Lebensunterhalt für seine Familie beizutragen, und machte sich daran, das Modell der Stadtkirche St. Dionys zu konstruieren. Dass Nord trotz seiner Sehbehinderung ein solch detailgetreues und kleinteiliges Werk gelang, zeugt vom handwerklichen Können des Erschaffers. Der gelernte Schreiner musste über Monate eine enorme Konzentration aufbringen und konnte die Arbeit nur mit diversen Hilfsmitteln verrichten. So erinnert sich der Enkel daran, seinen Großvater des Öfteren mit einer großen Lupe bei der Arbeit gesehen zu haben.
Wie genau Nord beim Bau des Kirchenmodells vorging, ist spekulativ. Manfred Wörner sieht Hinweise darauf, dass verschiedene Pläne als Vorlagen dienten. So entspricht etwa der Grundriss des Modells nicht der Realität, sondern ist dargestellt wie auf einem alten Plan, den einst der württembergische König in Auftrag gegeben hatte. 1971 starb Otto Gottlob Nord in Esslingen. Sein Modell der Stadtkirche St. Dionys existiert jedoch dank der leidenschaftlichen Recherche Manfred Wörners weiter.
März 2022 - Heimatkunde von Annalise Kiemle
März 2022 - „Heimatkunde von Annalise Kiemle, Schülerin der Kl. IV“
„Heimatkunde von Annalise Kiemle, Schülerin der Kl. IV“
Papier, Tusche
Annalise Kiemle
1913
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 007856)

„Wir dürfen in der Heimatkundekl[asse] Aufsätze schreiben, die uns mal in späteren Jahren als l[iebe] Erinnerung an unsere Jugendheimat wert sein werden.“ Mit diesen rührseligen, einleitenden Worten beginnt die Viertklässlerin Annalise Kiemle ihre Aufzeichnungen über ihre Heimatstadt Esslingen im Jahr 1913. Auf 76 sorgfältig von Hand beschriebenen Seiten schildert sie in elf Kapiteln ihren Wohnort und dessen Geschichte, reich bebildert mit kleinen Zeichnungen, Fotografien, Postkarten und Zeitungsartikeln.
Annalise Kiemle, Jahrgang 1903, war die einzige Tochter des Esslinger Arzts Wilhelm Johannes Kiemle und seiner Frau Katharina Marie Elise. Seit 1907 wohnte die Familie in der Pliensaustraße 8, dem Paracelsusgebäude, auf der 2. Etage. Die Eltern legten großen Wert auf die Ausbildung ihrer Tochter und schickten sie auf die Höhere Mädchenschule. Nach ihrem Abitur 1922 studierte sie in Tübingen Germanistik, Anglistik und Romanistik. Nachdem sie für einige Jahre an verschiedenen Schulen in Süddeutschland tätig gewesen war, unterrichtete sie von 1933 bis 1936 an der Deutschen Schule in Istanbul. 1938 zog es sie zurück nach Esslingen und wieder an die Höhere Mädchenschule (inzwischen Mädchenoberschule genannt) – nun stand sie allerdings nicht mehr vor, sondern hinter dem Lehrerpult. Zunächst als Studienrätin tätig, übernahm sie 1955 die Schulleitung, die sie bis zu ihrer Pensionierung 1969 innehatte. In dieser Zeit war sie unter anderem auch für den Schulhausneubau in Oberesslingen verantwortlich, das heutige Theodor-Heuss-Gymnasium.
Annalise Kiemle beginnt ihre Aufzeichnungen mit Schilderungen aus dem privaten Bereich. Sie beschreibt ihr Wohnzimmer: „Wir haben die Möbel, die wir brauchen, u. die Bilder, die uns gefallen, schmücken unsere Wände. [...] Ich habe auch für unser Wohnzimmer schon Körbchen geflochten u. Abstaubtücher gestrickt u. Blumen gesucht.“ Sie legt sogar einen kleinen Plan bei, in dem neben dem Mobiliar auch das Klavier und ein Vogelkäfig eingezeichnet sind. Im Kapitel „Unser Haus“ beschreibt sie das Gebäude und die Nachbarschaft, gefolgt von einer Beschreibung der Pliensaustraße („Unsere Straße“). Annalise verfasst die Texte in einem sehr nüchternen, sachlichen Stil, doch immer wieder gibt sie auch kurze persönliche Eindrücke preis. Über „Unsere Schule“ schreibt sie: „Mein liebstes Fach ist mir das Turnen, weil wir da oft Spiele machen, das Rechnen macht mir viel Kopfzerbrechen. Bei meinen Hausaufgaben hilft mir meine Mutter, u. ich freue mich, daß sie noch so gut französisch kann.“ Über einen Schulausflug nach Ludwigsburg berichtet sie begeistert über das Mittagessen im König-Wilhelms-Haus, „für 70 [Pfennig] Suppe, Rahmbraten mit Spätzle u. Salat, zum Nachtisch ein Stück Kuchen“ gegessen zu haben.
Die nachfolgenden Kapitel handeln u.a. von den Esslinger Kirchen, dem Markt, dem Rathaus, der Eisenbahn oder der Post. Die Beschreibungen sind von einem kindlichen Stolz geprägt, der stets das Schöne und Besondere hervorheben möchte. Die Kirchen sind „die größten Meisterwerke der Baukunst, die wir besitzen“. Über das Rathaus weiß sie zu berichten: „Wenn ich auch noch jung bin, so habe ich doch schon so manche Verbesserung u. Verschönerung Eßlingens, die auf dem Rathaus beschlossen wurde, gesehen. Z.B. die Straßenbahn, das Gymnasium, die Mittelschule, die Eingemeindung Obereßlingens.“ Das Büchlein schließt mit einem Kapitel über das Wolfstor und dem Satz: „Wenn wir älter sind, dürfen wir vielleicht einmal alle miteinander auf einen Schulspaziergang den Hohenstaufen u. Burg besuchen.“ Ob dieser erhoffte Ausflug stattfand, ist nicht bekannt.
Die erwachsene Annalise Kiemle legte in ihrem pädagogischen Wirken als Lehrerin und Schulleiterin einen Schwerpunkt auf die Gleichberechtigung der Frau. Wie verschiedene Artikel in der Esslinger Zeitung aus den 1960er und 1970er Jahren schildern, ging es ihr bei der Ausbildung insbesondere um ein partnerschaftliches Miteinander von Mann und Frau. 1975 verstarb sie unerwartet auf einer Norwegenreise.
Februar 2022 - Stadtansicht von Esslingen (Karl Fuchs)
Februar 2022 - Stadtansicht von Esslingen (Karl Fuchs)
Karl Fuchs (1872-1968)
Stadtansicht von Esslingen
um 1920
Radierung
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 007459)

Das ungerahmte Blatt zeigt Esslingen vom linken Neckarufer aus. Die Blickrichtung geht nach Nordwesten, wobei der Künstler in etwa auf der Höhe des Alicenstegs gestanden haben muss. Im Vordergrund am unteren Bildrand fallen fünf Villen auf, die sich in der heutigen Berkheimer Straße direkt am Neckar befinden. Der Blick folgt dem Fluss bis zum Wehr, an dessen Ende die Pliensaubrücke mit Pliensautor und dahinter die Fabrikgelände der Weststadt mit Quist und Dick zu sehen sind. Im rechten unteren Eck des Bildes lässt sich das Gärtnerhaus des Merkelschen Fabrikanten-Anwesens ausmachen. Dahinter sind Teile eines Fabrikgebäudes von Merkel & Kienlin erkennbar. Das direkte rechte Neckarufer ist als dichtes Baum- und Buschwerk dargestellt und trennt ausgehend vom rechten unteren Eck des Bildes den Bildmittelgrund vom Vordergrund. Dahinter liegen dicht gedrängt die Giebel der Esslinger Altstadt. Markant stechen die Stadtkirche St. Dionys, die Frauenkirche und die Burg heraus. Als letztes Gebäude am rechten Bildrand ist noch der Turm der ehemaligen Franziskanerkirche auszumachen. Links neben der Frauenkirche ist deutlich der Neckarhaldenweg mit Neckarhaldentor erkennbar. Den Hintergrund bilden auf der linken Bildseite die Neckarhalde und auf der rechten Bildseite Hügel des Schurwaldes.
Diese Stadtansicht kam vor wenigen Monaten als private Schenkung in die Museumssammlung. Sie entspricht in Perspektive und Bildausschnitt genau einem großformatigen Ölbild von der Hand des Künstlers, das im Treppenhaus des Stadtmuseum zu besichtigen ist.
Esslingen hat Karl Fuchs in vielen Bildern porträtiert und die Altstadt mit ihren Gassen, Plätzen und Winkeln in zahlreichen Motiven zeichnerisch wie malerisch festgehalten. Seine Ansichten von der Burg, der Pliensaubrücke mit dem Pliensauturm oder vom Alten Rathaus sind bis heute populär und zieren als Radierungen und Lithographien vervielfältigt so manche Wohnzimmerwand. Das Stadtmuseum im Gelben Haus besitzt einen umfangreichen Bestand an Graphiken des Künstlers.
Karl Fuchs wurde vor 150 Jahren, am 2. Februar 1872, in Stuttgart geboren und stammte aus einer Handwerkerfamilie. Fuchs absolvierte in Stuttgart eine Lehre zum Lithograph im Atelier von Friedrich Federer und besuchte zudem Kurse bei Friedrich von Keller und Hermann Plauer an der Stuttgarter Akademie der Künste. Danach machte sich Fuchs als Lithograph selbständig. Er erledigte Auftragsarbeiten für Verlage, für die er etwa Buchdeckel und Widmungsblätter entwarf, er zeichnete Karikaturen für den Stuttgarter Generalanzeiger und nahm Aufträge aus der Industrie an.
Ein Haupterwerbszweig von Karl Fuchs war das Zeichnen und Lithographieren von Ansichtspostkarten, wofür Fuchs umfangreiche Reisen unternahm. Auch der Auftrag des Statistischen Landesamts, Illustrationen zur „Oberamtsbeschreibung für das Königreich Württemberg“ anzufertigen, führte zu einer regen Reisetätigkeit, während der er in Buoch seine spätere Frau kennenlernte und sich dort für mehrere Jahre niederließ. 1907 zog er mit seiner jungen Familie nach Esslingen, wo er bis zu seinem Tod im Jahre 1968 lebte und wirkte. 1952 erhielt Fuchs das Bundesverdienstkreuz und wurde zum Ehrenbürger der Stadt Esslingen ernannt.
Januar 2022 - Repassiergerät
Repassiergerät „Desmo Type B2“
Metall, Kunststoff, Gummi
Firma Vitos, Troyes (Frankreich)
1950er - 1960er Jahre
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 007855)

Ein Stückchen Nachhaltigkeit – davon zeugt diese leuchtend rot lackierte Maschine. Perlon- und Nylonstrümpfe waren vor einigen Jahrzehnten noch kostbare, wohlgehütete Stücke, heute sind sie billige Wegwerfprodukte: Haben sie ein Loch oder eine Laufmasche, wandern sie in den Restmüll. Noch in den 1960er Jahren hingegen wurden Feinstrümpfe mit Laufmaschen zur Reparatur zum so genannten Repassieren gebracht. Mithilfe des Repassiergeräts konnten die Laufmaschen rasch und sorgfältig geflickt werden.
Die Firma Vitos in Troyes, Frankreich, war eigentlich auf die Textilherstellung spezialisiert, als Marcel Vitoux, der Sohn des Firmengründers Léon Vitoux, 1925 das erste elektro-pneumatische Repassiergerät erfand. Zunächst war die Maschine bei Verkäufer:innen von Strick- und Wirkwaren professionell im Einsatz. In den Wirtschaftswunderjahren wurden die Geräte verstärkt auch von Frauen in Heimarbeit genutzt, die sich mit dem Reparieren von Strümpfen ein bisschen Geld hinzu verdienten.
Unser Repassiergerät kam in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren in Esslingen zum Einsatz. Die Repassiererin Anna Lampart war in der Oberen Beutau 6 direkt neben der Burgstaffel ansässig und hatte eine junge Angestellte, Inge Linnemann. Gemeinsam richteten sie die feinen Strumpfwaren der Esslinger Damenwelt.
Die Repassiermaschine besteht aus einem Motorteil mit leuchtend rotem Gehäuse und metallenem Drehschalter, der vier Regulierungsstufen aufweist. An einen Auslass wurde ein Gummischlauch angeschlossen. Mittels des schwarzen Fußpedals konnte die Maschine in Gang gesetzt werden und erzeugte einen regulierbaren Luftdruck. Dieser veränderte sich je nach Einstellung des Drehschalters. Am losen Ende des dünnen Gummischlauchs wurde eine Repassiernadel angeschlossen. Im Gegensatz zu einer normalen Nähnadel ist sie am oberen Ende wie eine Häkelnadel gebogen und hat ein kleines, bewegliches Häkchen. Zusammen bilden diese Teile eine offene Öse. Um eine Laufmasche zu richten, spannten Frau Lampart und Frau Linnemann den Strumpf mit der beschädigten Stelle über den trichterförmigen Halter. Rechts und links des Lochs oder der Laufmasche fixierten sie das noch intakte Gestrick mit einem Faden, um zu verhindern, dass sich weitere Maschen lösten. Eine intakte Masche am unteren Ende der Laufmasche wurde im nächsten Schritt mit einer Nadel aufgefangen und in den Haken der Repassiernadel eingehängt. Mit der Betätigung des Fußpedals erzeugten die Repassiererinnen einen Luftstrom, der durch den Schlauch in die Nadel strömte und diese in Bewegung setzte. Mit der Hand führten sie die Nadel am Maschenverlauf entlang, während die Nadel neue Maschen erzeugte. Die letzte Masche vernähten sie abschließend von Hand – das Loch war geflickt, der Strumpf wieder einsatzbereit.
Die Repassiermaschine hat ihren Weg ins Stadtmuseum mit einer ganzen Reihe von Zubehör gefunden. Dazu zählen mehrere Repassiernadeln in verschiedenen Stärken, Garne in verschiedenen (Haut-)Farben und kleinere Ersatzteile, um die Maschine bei Bedarf selber zu reparieren. Wie viele Laufmaschen die beiden Repassiererinnen richten mussten, um den Anschaffungspreis für das Gerät wieder hereinzuholen, ist in diesem Fall nicht übermittelt. Vergleichbare Zahlen aus Frankreich zeigen jedoch, dass dort mindestens 1000 Laufmaschen geflickt werden mussten, damit der Kaufpreis für die Maschine erreicht war.
Anna Lampart und Inge Linnemann waren bei weitem nicht die einzigen Repassiererinnen in Esslingen in dieser Zeit. Das Adressbuch von 1958 weist zwölf Repassierbetriebe aus, 1960 sind es noch acht - und alle in Frauenhand.
Das Repassiergerät ist nur wenige Jahrzehnte alt und dennoch den meisten Menschen heute kein Begriff mehr. Vielleicht erlebt es aber eine Renaissance, sobald das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil mit einem achtsamen Umgang mit Kleidung auch Wegwerfprodukte wie Feinstrumpfhosen erreicht hat.
Dezember 2021 - Adventskalender aus dem Verlag J. F. Schreiber
Adventskalender (Verlags Nr. 265)
Arno Drescher (1881-1971)
Verlag J .F. Schreiber, Esslingen
1934
(Städtische Museen Esslingen, JFS 700028)

Der Adventskalender zeigt ein spitzgiebeliges Haus dessen Fenster und Eingangstür als Klapptürchen gestaltet sind. Den Giebel ziert ein Ausschnitt in Form eines sechszackigen Sterns, der mit blauem Transparentpapier hinterlegt ist. Ausgehend vom obersten Fenster, lassen sich 24 Türchen öffnen.
Das Kalendermotiv arrangiert zentrale Elemente der Weihnachtsgeschichte wie sie auch in Krippendarstellungen zu finden sind. Die Bildflächen zu beiden Seiten des Hausgiebels sind in zwei Ebenen gegliedert. Die erste zeigt die Hirten auf dem Feld und den Engel, der ihnen die Geburt Christi verkündet. Die Liedzeile „Kommet, Ihr Hirten, Ihr Männer und Frauen“ des gleichnamigen Weihnachtslieds untertitelt diese Ebene und gibt dem Adventskalender sein Motto. In der darunterliegenden Ebene ist die Ankunft der Sterndeuter aus dem Morgenland, die als Könige dargestellt sind, thematisiert. Elefanten und ein Kamel weisen die Figuren als Weitgereiste aus. Die Heilige Familie, also das Jesuskind in der Krippe, umgeben von Maria und Josef, verbirgt sich hinter dem 25. Türchen, der Eingangstür des Hauses über der ein Band mit der Inschrift „Ehre sei Gott in der Höhe“ prangt.
Gestaltet hat den Kalender der Maler, Grafiker und Typograph Arno Drescher, der zu dieser Zeit eine Professur für Freie, Künstlerische und Gebrauchs-Grafik an der Staatlichen Akademie für Kunst und Gewerbe und Dresden innehatte und heute vor allem als Gestalter einer Reihe von Zierschriften sowie von Logos für die Firmen Audi-Autounion und den Schokoladenhersteller Hachez bekannt ist. Von 1942 bis 1945 war Drescher Leiter der Leipziger Akademie für grafische Künste und Buchgewerbe. Danach arbeitete er als freier Grafiker und übersiedelte 1960 nach Braunschweig. In Auerbach im Vogtland aufgewachsen, kam Drescher früh in Berührung mit der erzgebirgischen Volkskunst, deren Räuchermännchen, Nussknacker, Schwibbögen und Weihnachtspyramiden auch heute noch ihren Platz im Repertoire weihnachtlichen Hausschmucks haben. Das mag erklären, dass sich entsprechende stilistische Anklänge – insbesondere in der Gestaltung einzelner Figuren - auch auf dem von ihm gestalteten Adventskalender finden lassen.
Erste gedruckte Adventskalender erschienen bereits kurz nach der Jahrhundertwende. Richtig populär wurden sie ab den 1920er Jahren als sich der bis heute beliebte Typus mit Klapptürchen am Markt durchsetzte. Ab 1928 stieg auch der J. F. Schreiber Verlag in das Geschäft mit Adventskalendern ein, wenngleich diese immer Nischenprodukte blieben. Der vorliegende Adventskalender von 1934, war der fünfte im Verlagsprogramm. Er erschien in einer Auflage von rund 10.000 Stück und war noch 1937 lieferbar. Weitaus erfolgreicher war hingegen das von Gertrud Caspari gestaltete Motiv „Die Himmelstreppe“ (Verlags-Nr. 263), die zwischen 1932 und 1935 in drei Auflagen mit insgesamt 25.000 Stück erschien und bis 1940 lieferbar blieb. Bis zum kriegsbedingten Produktionsstopp für Adventskalender hatte Schreiber 12 verschiedene Nummern produziert, wovon die letzten Exemplare noch bis ins Kriegsjahr 1941 lieferbar waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden bei Schreiber in Esslingen bis 1960 noch drei weitere Nummern. Heute sind Adventskalender aus Esslingen rare und gesuchte Sammlerobjekte. Der gezeigte Adventskalender Nr. 265 ist eine aktuelle Neuerwerbung für das J. F. Schreiber-Museum und das bisher einzige Exemplar in der umfangreichen Sammlung des Museums.
November 2021 - Bibel der Eva Christiana Wager
Bibel der Eva Christiana Wager
Leder, Papier
Gedruckt von Emanuel Thurneisen
Basel 1823
(Stadtarchiv Esslingen, Bibliothek 12614)

Nur auf den ersten Blick schlicht gestaltet ist diese in Leder gebundene Bibel mit angefügtem Gesangbuch. Auf den braunen Ledereinband sind in Gold die Initialen der Eigentümerin „E. C. W.“ sowie die Jahreszahl 1830 gedruckt. In jenem Jahr heiratete am 10. August Eva Christiana Fuchslocher aus Serach den Weingärtner Johann Georg Caspar Wager. Im Beibringensinventar - also einer Auflistung des Vermögens, welches beide Partner in die Ehe mitbrachten - wird dann auch eben diese Bibel erwähnt. Auf einen zweiten, genaueren Blick erkennt man, dass der Ledereinband an den Rändern mit weiteren geprägten Mustern, teilweise auch farbig in Gold belegt, verziert ist. Darüberhinaus wurden die Kanten der Buchseiten mit einem feinen Rankenmustern versehen, indem man mit einer Nadel oder feinem Messerchen das Papier vorsichtig entfernte.
Sorgfältig von Hand gestaltet ist die Vorsatzseite. Ein mit Tusche gezeichneter Blattkranz mit kleinen Früchten flankiert eine wappenförmige Rahmung mit einer Krone an der Spitze. Innerhalb des Rahmens sind der Name der Eigentümerin mit ihrem Mädchennamen sowie ein Datum wenige Tage vor der Hochzeit genannt.
Gedruckt wurde die Bibel 1823 in der traditionsreichen Druckerei Emanuel Thurneisen, Basel. Diese wurde zunächst gemeinsam von Emanuel (1687-1739) und seinem Bruder Johann Rudolf Thurneisen (1688-1755) bis zum Tod von Emanuel geführt. Die eine Hälfte übernahm dann seine Witwe Elisabeth zusammen mit ihrem Sohn Johann Jakob, dessen Sohn Emanuel (1749-1806) wiederum die Druckerei führte. Wer der Leiter der Druckerei zur Entstehungszeit der vorliegenden Bibel war, ist nicht bekannt.
Das beigebundene Gesangbuch hingegen wurde nicht bei Emanuel Thurneisen gedruckt, sondern 1826 in der Cotta´schen Verlagsbuchhandlung. Diese wurde 1659 in Tübingen gegründet und war bis 1889 in Familienbesitz. Der Verlag fusionierte 1977 mit dem Ernst Klett Verlag und ist bis heute unter dem Namen Klett-Cotta bekannt. Das Gesangbuch ist nach Sachthemen geordnet (z. B. „Von Gott“, „Von der Schöpfung“) und enthält lediglich Texte, keine Noten. Es konnte gebunden wie ungebunden erworben werden. Für die ungebundene Fassung ohne Anhang fielen 24 Kreuzer an.
Während der Ledereinband Einheitlichkeit suggeriert, offenbart ein Blick ins Buch, dass Papier und Druck der beiden Buchbestandteile sehr unterschiedlich sind. So wurde die Bibel auf feinem, hellen Papier gedruckt. Das Papier des Gesangbuchs ist hingegen deutlich gröber und einzelne Buchstaben weisen immer wieder Fehlstellen aufgrund von zu wenig Tinte auf. Andere Buchstaben wiederum verschwimmen, weil zu viel Tinte verwendet wurde.
Eva Christiana gebar in den folgenden beiden Jahrzehnten nach der Hochzeit sieben Kinder: Eva Catharina, Sibille Margarethe, Anna Katharina, Johannes, Christian Friedrich, Georg Caspar und Caroline Louise. Am 6. August 1854 starb sie - die Jüngste war zu diesem Zeitpunkt gerade vier Jahre alt. Eva Christiana hinterließ kein Testament. Gesetzliche Erben waren der 51jährige Witwer und die Kinder. Pfleger der ledigen Kinder war Christian Gottlieb Fuchslocher, Weingärtner in Serach. Auf eine Eventualteilung - das heißt eine anteilige Berechnung des Erbes, der aber keine Realteilung, sprich: Auszahlung, folgte - wurde vorerst verzichtet. Das Vermögen belief sich auf 8.000 Gulden, gleichwohl bestanden Schulden in Höhe von 700 Gulden.
Im Jahr 1877 erfolgte eine teilweise Vermögensübergabe durch Johann Georg Caspar Wager an seine Kinder. Dabei blieb seine älteste Tochter Eva Catharina, Ehefrau des Johann Friedrich Kenner, außen vor, weshalb Kenner am 6. August 1877 die Eventualteilung des Vermögens seiner Schwiegermutter beantragte. Wager stimmte dem zu. Er war zu diesem Zeitpunkt 74 Jahre alt. Die Eventualteilung wurde letztendlich doch nicht durchgeführt.
Johann Georg Caspar Wager verstarb 1880. Der Nachlass wurde unter den Kindern aufgeteilt; die Aufteilung erfolgte durch Verlosung.
Oktober 2021 - Handsirene HSM 7
Handsirene HSM 7
Metall, Holz, Kunststoff
Fa. Elektror K.W. Müller, Esslingen
Mitte 20. Jahrhundert
(Städtische Museen Esslingen, STME 003760)

Mit unvorstellbarer Wucht traf vergangenen Sommer eine Katastrophe die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Dort führten Starkregenereignisse zu extremen Hochwassern, die eine hohe Zahl an Menschenleben forderten. Viele hätten sich in Sicherheit bringen können, wenn die Warnungen des Katastrophenschutzes sie rechtzeitig erreicht hätten. Das Potenzial digitaler vernetzter Warnsysteme kommt nicht zum Tragen, wenn das Funknetz ausfällt, weil die Flut die technische Infrastruktur zerstört hat. Auch in Esslingen existiert heute kein mechanisches, elektrisches oder pneumatisches Sirenennetz mehr. Im Katastrophenfall wird die Bevölkerung durch mobile Lautsprecher-Fahrzeuge der Feuerwehr, Polizei oder des Technischen Hilfswerks sowie durch Rundfunksender informiert. Bekannt ist das Fehlen der Warnsirenen spätestens seit dem bundesweiten Warntag 2020, an welchem ein Großteil der Bevölkerung das Aufheulen der Sirenen vergebens erwartet hatte. Dieser vom Bundesinnenministerium als „fehlgeschlagen“ titulierte deutschlandweite Probealarm zeigte bereits auf, dass eine bloße Warnung über digitale Wege und Lautsprecheransagen nicht genüge. Diskutiert wird nun eine Rückkehr zu Alarmsirenen, die seit dem Ende des Kalten Krieges nach und nach stillgelegt, abgebaut und verschrottet wurden. Die einst bewährten Frühwarnsysteme gerieten in Vergessenheit und waren nur noch für Sammler oder Museen von Interesse. Eine solche Rarität ist unser Objekt des Monats – eine Handsirene der Esslinger Firma Elektror K. W. Müller.
Im Gegensatz zu am Dach angebrachten Warnsirenen, war die auf einem Dreibeinstativ befestigte Sirenen vom Typ HSM 7 (die Abkürzung steht für Hand-Sirene-Mobil), für den mobilen Gebrauch bestimmt. Durch die Betätigung der Kurbel, wird die rote schaufelradähnliche Trommel aus Kunststoff im Inneren der Sirene in Bewegung gesetzt. Diese ist von einem unterbrochenen Gehäuse aus Metall, dem sogenannten Stator, umschlossen. Durch die Rotation der Trommel wird der entstehende Luftstrom immer wieder unterbrochen und erzeugt so einen Ton. Je nachdem wie schnell an der Kurbel gedreht wird, verändert der Ton seine Höhe und Lautstärke. Die HSM 7 von Elektror verfügt zudem am oberen Holzgriff über eine Mechanik, mit welcher die Klappen an der Frontseite der Sirene geschlossen und so die Lautstärken geregelt werden können. Durch diese Mechanik ist es möglich, Morsezeichen zu senden.
1923 gründet Karl W. Müller in Esslingen die Elektror-Motoren und Handelsgesellschaft. Schon früh spezialisierte sich die Firma auf Lufttechnik und die Herstellung elektrischer Einzelantriebe. Nach und nach wurde auch die Produktion von Sirenen aufgenommen. Während des Zweiten Weltkriegs bestand ein großer Bedarf an Luftschutz-Sirenen und Bunker-Belüftungen von Elektror. Sirenen vom Typ HSM 7 wurden verstärkt von der Wehrmacht genutzt. Neben diesem Modell existierten noch zwei weitere mobile Handsirenen der Firma, die sich lediglich in der Größe unterschieden, wobei die HSM 7 der mittlere Typus war. Die hohe Nachfrage an den Sirenen bestand nach dem Krieg weiter, sodass sie noch lange Jahre produziert wurde. Der Stammsitz der Firma, die mittlerweile unter dem Name „Elektror airsystems“ firmiert, befindet sich seit 2008 in Ostfildern. Heute zählt sie zu einem der international führenden Hersteller von Industrieventilatoren und Seitenkanalverdichter. Die Produktion von Sirenen wurde jedoch eingestellt.
September 2021 - Deichel
Deichel
Eichenholz, Metall, Ton, Birkenpech
Anfang 19. Jahrhundert
(Städtische Museen Esslingen, STME 007829)

Bis das Trinkwasser in Esslingen aus dem Wasserhahn kommt, legt es eine weite Entfernung zurück. Aus dem Bodensee und dem Donauried, einer Landschaft zwischen Ulm und Donauwörth, wird es kilometerweit in metallenen Rohren hierher geleitet. Dass Esslingen auch früher schon auf gute Wasserleitungen angewiesen war, zeigt unser Objekt des Monats. Jahrhundertelang waren diese Leitungen nicht aus Metall, sondern aus Holz gefertigt. Diese als Deicheln bezeichneten Holzstämme wurden der Länge nach durchbohrt. An den Stirnseiten eingeschlagene Metallringe, die sogenannten Prunnbüchsen, dienten als Steckverbindungen für die anschließenden Deicheln.
Deicheln wurde in Esslingen bereits im Mittelalter verwendet. Die Anfänge gehen vermutlich auf den Bau der städtischen Rohrbrunnen zurück, welche bereits in einer Urkunde von 1267 belegt sind. Bei dieser Art der Brunnen lief das Wasser kontinuierlich durch, weshalb sie auch als Laufbrunnen bezeichnet wurden. Dieser konstante Ausfluss war besonders für die Qualität des Trinkwassers wichtig. Hätten die Rohrbrunnen ähnlich eines Wasserhahns abgestellt werden können, wäre das Wasser in der Holzdeichel gestanden. Die Folge wäre ein leicht fauliger Geschmack des Wassers gewesen. Da die Deicheln jedoch unterirdisch verlegt wurden (u.a. um beginnender Fäulnis des Holzes vorzubeugen), war das Wasser sehr gut vor Verunreinigungen geschützt. Die Rohrbrunnen konnten somit ein qualitativ höherwertiges Wasser liefern als die im 17. Jahrhundert aufkommenden Zieh- und Pumpbrunnen. Das frische Quellwasser wurde nicht wie heute aus weiter Ferne nach Esslingen geleitet, sondern kam aus der näheren Umgebung, etwa aus Krummenacker oder Wäldenbronn. Diese Frischwasserquellen reichten damals noch aus, die Grundversorgung der Reichsstadt sicherzustellen.
Für die optimale Nutzung des Wassers wurden große Anstrengungen unternommen. Dies zeigt sich etwa in der Anstellung eines städtischen Brunnenmeisters im Jahr 1616. Er war u.a. für die regelmäßige Wartung der Deicheln zuständig, denn jährlich mussten etwa 200 Stück ersetzt werden – bei einer möglichen Lebensdauer der Deicheln von bis zu hundert Jahren lässt sich erahnen, wie groß das Leitungsnetz der Stadt war. Für die Finanzierung neuer Deicheln war die Stadt verantwortlich. So wurden laut Ratsprotokoll von 1739 3.000 Stück eingekauft. Um einer Austrocknung und damit verbundenen Rissbildung entgegenzuwirken, mussten die Holzstämme bis zu ihrer Verwendung unter Wasser gelagert werden. In anderen Städten gab es dafür extra vorgesehene Teiche oder Kanalabschnitte. Wo dies in Esslingen geschah, ist nicht bekannt. Bei Bedarf wurden die Deicheln aus dem Wasser geholt und mit einem Löffelbohrer der Länge nach durchbohrt. Hierbei gab es zwei Herangehensweisen: Entweder die Bohrung erfolgte durch den gesamten Stamm oder – wie im Fall unserer Deichel – das Holz wurde in kleine Abschnitte unterteilt, durchbohrt und anschließend wieder zusammengesetzt. Die Gefahr der Leckage war bei dieser zweiten Herstellungsmethode ständig gegeben. Vor allem die Verbindungen zwischen den einzelnen Deicheln stellten hierbei Sollbruchstellen dar, die regelmäßig überprüft werden mussten. Birkenpechtropfen auf der Oberfläche des Objekts des Monats legen die Vermutung nahe, dass diese Deichel undichte Stellen hatte, die nachträglich ausgebessert werden mussten.
Zwei Löcher in der Seite machen die Deichel zu einem ganz besonderen Objekt. Diese wurden bis in das längs verlaufende Rohr gebohrt, wodurch klar wird, dass es sich hierbei um eine Abzweigung handelt. Durch die intensive Nutzung der Deichel wurde an einer Stirnseite das Holz innerhalb des Rings ausgespült und abgetragen Eine Ausbesserung dieser Stelle erfolgte durch ein eingesetztes Tonrohr. Im 19. Jahrhundert wurde Ton immer mehr zum bevorzugten Material für Wasserleitungen in Esslingen. Holzdeicheln verloren in dieser Zeit ihre Bedeutung, woraufhin 1838 alle Holzdeicheln der Stadt durch Tonrohre ersetzt wurden.
August 2021 - Jugendstil-Vase
Jugendstil-Vase
Messing, Uranglas
Metallwaren-Fabrik C. Deffner, Esslingen
um 1900
(Städtische Museen Esslingen, STME 007442)

Die kürzlich für die Städtischen Museen Esslingen erworbene Vase aus der Produktion der Metallwaren-Fabbrik C. Deffner in Esslingen ist eine strahlende Schönheit – im wörtlichen Sinn! Sie besteht aus einem schlanken, leicht konisch zulaufenden Glaskörper, der von einer Messingmontierung mit zwei Henkeln mit Zierelementen gefasst ist. Sofort ins Auge sticht der geheimnisvolle gelblich-grüne Schimmer des Glases. Ein Test mit langwelligem UV-Licht bringt schnell Gewissheit: Uranglas! Unter Beimischung geringer Mengen radioaktiven Uranoxids können bei der Glasherstellung einzigartige gelbe und grüne Farbeffekte erzielt werden. Die von Uranglas ausgehende Strahlung liegt dabei im Bereich der natürlichen radioaktiven Umgebungsstrahlung und stellt keine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar.
Während das früheste Beispiel für uranhaltiges Glas aus einer römischen Villa in der Nähe von Neapel und somit bereits aus dem ersten Jahrhundert nach Christus stammt, geht die Entdeckung des Urans durch die moderne Naturwissenschaft auf den böhmischen Naturforscher und Apotheker Martin Heinrich Klapproth (1743-1817) zurück. Bei Versuchen mit Pechblende, einem unscheinbaren schwarzgrauen Erz, isolierte er 1789 ein metallisches Pulver, das er für ein neues Element hielt. Er bezeichnete es nach dem 1781 entdeckten Planeten Uranus als Uranium. Angeregt von der Farbkraft des gewonnenen Oxids, stellte Klapproth Untersuchungen zur Färbung von Glasuren und Glas an.
Der erste Hersteller von Uranglas war ab 1830 der böhmische Glashüttenbesitzer Franz Xaver Anton Riedel. Seinen Farbkreationen gab er die Namen seiner Töchter – „Annagrün“ und „Eleonorengelb“. Uranfarben als handelsfähiges Produkt entwickelte der Montantechniker Adolf Patera im Auftrag der k. k. Montanverwaltung um 1850 in Joachimsthal (dem heutigen Jáchymov in Tschechien). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der dortige Uranabbau zur Farbherstellung weltweit führend. Mit Uranfarben gestaltete Gebrauchsgegenstände wie Geschirr, Ziergläser, Bijouteriewaren und Kacheln erfreuten sich überall auf der Welt großer Beliebtheit. Im 20. Jahrhundert spielten die reichen Uranvorkommen von Joachimsthal/Jáchimov vor allem bei der Entwicklung der sowjetischen Atombombe eine entscheidende Rolle und verhalfen der Sowjetunion zum Aufstieg zur nuklearen Weltmacht.
Eine größere Menge des bei der Farbherstellung anfallenden Aufbereitungsabfalls aus Joachimsthal diente der Physikerin und Chemikerin Marie Curie als Grundlage für ihre bahnbrechenden Recherchen zur Radioaktivität und führte sie zur Entdeckung der Elemente Polonium und Radon. Für ihre Forschungen zur radioaktiven Strahlung erhielt sie 1903 zusammen mit ihrem Mann Pierre sowie Henri Becquerel den Nobelpreis für Physik. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde in der Metallwaren-Fabrik C. Deffner in Esslingen die Jugendstilvase mit Uranglas hergestellt.
Leider geben weder die drei heute noch bekannten Musterbücher noch die nur lückenhaft überlieferten Firmenkataloge Auskunft über die Vase, so dass offenbleibt, wann genau sie in das Sortiment aufgenommen und zu welchem Preis sie verkauft wurde.
Juli 2021 - Ansicht von der Maille zur Inneren Brücke
Ansicht von der Maille zur Inneren Brücke mit Rossneckar und Amtsgericht
Öl auf Leinwand
Unbekannter Künstler
um 1850
(Städtische Museen Esslingen)

Im Juni 2021 konnte der Geschichts- und Altertumsverein Esslingen eine Vedute erwerben, die nun die Sammlung historischer Stadtansichten der Städtischen Museen Esslingen bereichert und ergänzt. Bei einer Vedute handelt es sich um die wirklichkeitsgetreue Ansicht einer Landschaft oder Stadt. Der Begriff leidet sich vom italienischen „veduta“ ab.
Das Gemälde zeigt eine der bekanntesten Ansichten Esslingens: Gerahmt von Linden und Kastanien auf der linken und vom Amtsgericht auf der rechten Bildseite, leitet der Rossneckar den Blick des Betrachters zur Inneren Brücke mit ihren charakteristischen Brückenhäusern. Über die Dachfirste ragen im Hintergrund die markanten Türme von St. Dionys sowie der Frauenkirche. Als Staffage sind Spaziergänger und eine kleine Bootsgesellschaft eingefügt, die die Szene beleben.
Die Maille ist bis heute die zentrale Grünfläche im Herzen Esslingens. Als Naherholungsgebiet erfreut sie sich großer Beliebtheit. Die 1596 als „baumbestandender Wasen“ erstmals erwähnte Anlage liegt auf einer vom Wehr- und Rossneckar umflossenen Insel zwischen der Pliensauvorstadt und der Innenstadt. Über Jahrhunderte diente die Fläche als Stadtanger, der von den Bürgern gemeinsam genutzt wurde. Vermutet wird allerdings, dass sie auch schon sehr lange als Vergnügungsort diente. Ein erster Plan mit einem Wegenetz und einer Allee stammt von 1739. Eine Bepflanzung mit Kastanien, Linden und Nussbäumen ist für 1751/52 erstmals nachgewiesen. Der Name „Maille“ wird mit einem Ballspiel in Verbindung gebracht, das im 16. und 17. Jahrhundert beliebt war. Ob in Esslingen tatsächlich jemals Paille Maille - ein Vorläufer des auch heute noch geläufigen Krocket - gespielt wurde, ist nicht nachweisbar. Gesichert ist, dass die Maille im 19. Jahrhundert für Sängerfeste und später auch für Turnerfeste genutzt wurde.
Das Ölgemälde hat auffällige Gemeinsamkeiten mit einer Zeichnung, die Josef Nagel „nach der Natur“, also basierend auf eigener, direkt vor Ort gewonnener Anschauung geschaffen hat, und die als lithografischer Druck überliefert ist. A. Kappis hat die Zeichnung auf Stein übertragen, G. Küster hat den Druck besorgt. Das Blatt wurde von dem Esslinger Verleger Weychand veröffentlicht. Es zeigt genau das gleiche Motiv und war sowohl als koloriertes als auch als nicht koloriertes Blatt zu haben.
Mit dem Aufkommen graphischer Drucktechniken wurden auch Reproduktionen gemalter Motive möglich. Während Gemälde in der Regel teure Unikate waren, konnten Druckgraphiken in größerer Auflage hergestellt werden. Damit wurden exklusive, von Künstlerhand geschaffene Bildmotive für breitere Käuferschichten erschwinglich. So fanden auch viele ursprünglich gemalte oder gezeichnete Stadtansichten weitere Verbreitung.
Vermutlich hat der namentlich nicht bekannte Schöpfer des Gemäldes die Nagelsche Ansicht gekannt. Neben den Gemeinsamkeiten fallen aber auch Unterschiede ins Auge: So sind dem Künstler die Türme von St. Dionys zu lang geraten. Die Etagen des Glockenturms mit den charakteristischen Schallarkaden sind zu hoch, ihre Proportionen weichen von der Wirklichkeit ab. Gleiches gilt auch für das Amtsgerichtsgebäude, dessen Obergeschoß im Vergleich zur Wirklichkeit und zur Graphik etwas zu hoch geraten ist.
Die besonderen Qualitäten der Vedute liegen weniger in der technischen Genauigkeit der Abbildung. Das fein gearbeitete Gemälde legt vielmehr einen besonderen Akzent auf die Wirkung von Licht und Farbe. Dem Betrachter bietet sich ein durchaus glaubwürdiges Bild, wie es auf der Esslinger Maille an einem sommerlichen Sonntagnachmittag um die Mitte des 19. Jahrhunderts ausgesehen haben mag.
Juni 2021 - Reisetagebuch „Schwäbische Reise“
Reisetagebuch „Schwäbische Reise“
Papier, Tusche, Aquarell
1947
(Städtische Museen Esslingen, STME 006850)

Spätsommer 1947: Ein junger Mann reist mit dem D-Zug 108 von Aachen nach Esslingen, um zwölf Tage mit seiner dort ansässigen Herzensdame zu verbringen. Von dieser „Schwäbischen Reise“ geblieben ist ein reich illustriertes Tagebuch, welches einen lebhaften Eindruck der verschiedenen Unternehmungen des Paares zwischen dem 28. August und 9. September 1947 vermittelt. Die acht gelochten Blätter sind mit einer Kordel in eine graue Halbleinen-Kladde gebunden und beidseitig aufwändig gestaltet. Auf ihnen werden in zahlreichen aquarellierten Bildern und kurzen Texten der Reiseverlauf und der Aufenthalt geschildert; ergänzt von eingeklebten Fahr- und Eintrittskarten, Programmblättern und Zeitungsartikeln.Der reisende Verfasser und Künstler, 1947 wohl wohnhaft in oder bei Aachen, gibt sich namentlich nicht zu erkennen. Lediglich unter einer der Zeichnungen finden sich die Initialen W.T. Der aus einer Zeitung ausgeschnittene Name „Walter“, eingeklebt an Tag 9 im Tagebuch, gibt möglicherweise den Vornamen preis. Eine lose beigelegte Bleistiftskizze der Teck ist auf der Rückseite als Ausschnitt einer technischen Zeichnung zu identifizieren – könnte es sich bei W.T. um einen (ehemaligen) Studenten der Technischen Hochschule Esslingen handeln?Wer sich hinter der schlanken, brünetten Herzensdame verbirgt, ist hingegen aufgrund der Provenienz des Objekts bekannt: Ursula Warsteit, Jahrgang 1919. Nach dem Krieg gelangte sie mit ihren Eltern aus dem ostpreußischen Königsberg nach Esslingen, wo Pfarrer Geiger die Familie im Dekanatsgebäude am Rathausplatz 4 aufnahm. Der gemalte Blick aus dem Fenster über den Kleinen Markt auf die Frauenkirche am Abend des dritten Reisetags spricht dafür, dass sich das Paar dort aufgehalten hat.Der geschilderte Reiseverlauf beginnt am Donnerstag, den 28. August 1947, mit der Abfahrt in Aachen und – nach einem Zwischenstopp in Köln – der Ankunft in Esslingen am 29. August. Gemeinsam unternehmen W.T. und Ursula Warsteit in den kommenden zehn Tagen zahlreiche Ausflüge innerhalb Esslingens, aber auch in die nähere Umgebung: Die Teck, der Hohenneuffen und Stuttgart – das „Herz des Ländles“ – werden aufgesucht. Ein Besuch im Schauspielhaus in Stuttgart („Das Lied der Taube“) und je ein Kinobesuch im Central-Theater in Esslingen („Die gefundenen Jahre“) und im Lichtspielhaus Esslingen („Das Mädchen von Fanö“) zeugen von einem lebendigen Interesse an kulturellen Veranstaltungen der beiden. Alle Ausflugsziele, Unternehmungen und erinnerungswürdigen Momente sind liebevoll in kleinen Aquarellen festgehalten. Das Reisen und der Aufenthalt im Esslingen der Nachkriegszeit stellen sich daher im Tagebuch auf den ersten Blick sehr idyllisch und harmlos dar. Herausforderungen wie mangelnder Wohnraum, Hunger, Besatzung und andere Themen werden nicht explizit angesprochen, schimmern jedoch immer wieder durch. So wird am 6. September das Flüchtlingslager „Schwertmühle“ mit einem Besuch bedacht. Der Anlass dieses Besuchs geht aus den Aufzeichnungen nicht hervor, doch der Hintergrund, dass Warsteits aus Königsberg stammten, legt nahe, dass im Lager Bekannte oder Verwandte untergekommen waren. Einen weiteren Einblick in die Lage vermittelt auch die Zeichnung vom Ende des letzten Tages, als W.T. am 9. September den D-Zug 107 um 0.27 Uhr besteigt. Beide Waggons sind völlig überfüllt dargestellt, Passagiere scheinen sogar im Bereich des Wagenübergangs eng gedrängt zu stehen. Das ungehinderte Reisen zwischen Esslingen und Aachen, also der amerikanischen und der britischen Besatzungszone, war seit Jahresbeginn aufgrund des Zusammenschlusses zur sogenannten Bizone möglich. Wie es mit dem Paar nach W.T.s Abreise weiterging und warum die Beziehung nicht in eine Heirat mündete, ist nicht bekannt. Ursula Warsteit blieb ledig und arbeitete als Säuglingsschwester im Städtischen Kinderheim in der Entengrabenstraße. 2017 verstarb sie im Alter von 97 Jahren in Sulzgries.
Mai 2021 - Blätter des Schwäbischen Albvereins
Blätter des Schwäbischen Albvereins
Papier
1909 und 1913
(Stadtarchiv Esslingen, Bibliothek, B 25/79)

Am 23. Mai 2021 jährt sich zum 200. Mal der Geburtstag von Dr. Karl Ludwig Valentin Salzmann. Er gründete 1863 den Verschönerungsverein, dessen Vorstand er 10 Jahre war. Der Schwäbische Albverein entstand aus seiner Idee heraus, dass die bestehenden Verschönerungsvereine von der Alb bis Esslingen enger zusammenarbeiten sollten, um gemeinschaftliche Anliegen wie das Anbringen von Schildern, den Bau von Aussichtstürmen und Schutzhütten sowie das Aufstellen von Ruhebänken umzusetzen. So kam es im „Waldheim“ in Plochingen 1889 zur Gründung des Schwäbischen Albvereins, dessen Vorstand Valentin Salzmann wurde. Bereits im Zuge der Gründung wurden die „Blätter des Schwäbischen Albvereins“ ins Leben gerufen. Die große Wertschätzung, die Salzmann noch Jahre nach seinem Tod wiederfuhr, zeigen die beiden vorliegenden Ausgaben der „Blätter des Schwäbischen Albvereins“. „Eine Erinnerung an Dr Val. Salzmann“ erschien im Februar 1901 und zeigt einen „Albausflug unter Dr V. Salzmann 4. u. 5. Juni 1864“ nach einem Aquarell von W. Timm. Die Ausgabe vom September 1913 „Zum Gedächtnis Salzmanns“ zeigt die Portraitbüste, die Salzmanns Großnichte Franziska Freiin von Seeger geschaffen hat.
Karl Ludwig Valentin Salzmann wurde am 23. Mai 1821 als Sohn des Apothekers Karl Friedrich in Esslingen geboren. Er besuchte die seinerzeit sehr renommierte Erziehungsanstalt Stetten im Remstal. Nach dem Studium in Tübingen – er promovierte zum Thema „Über den Bau und die Krankheiten der Gelenkknorpel“ - reiste er nach Wien und Paris. 1847 ließ er sich als praktischer Arzt in Esslingen nieder. Wohnung und Praxis befanden sich im Haus Oberer Metzgerbach 30. Am 5. März 1848 heiratete er Bertha Emilie aus der angesehenen Familie Stierlen. Mit ihr hatte er fünf Kinder, von denen zwei im Kleinkindalter und eines als Jugendliche verstarben. Es blieben der Sohn Max und die Tochter Lina. Bertha Emilie starb 1881 im Alter von 54 Jahren.
Salzmann war längere Zeit Vorstand des ärztlichen Landesvereins und Ausschussmitglied der ärztlichen Unterstützungskasse. Er machte sich durch zahlreiche Veröffentlichungen einen Namen, beispielsweise zur Nikolauskapelle, zu den Hexenprozessen in der Reichsstadt Esslingen oder zum Esslinger Sanitätswesen. In seiner Freizeit begab er sich gerne auf Wanderungen, vorzugsweise mit seinem Freund Carl Deffner, dem in Esslingen der Deffnerstein gewidmet wurde. Außerdem liebte er die Musik, er spielte Generalbass und Klavier.
Bereits seit den 1850er Jahren war Salzmann durch ein Lungenleiden gesundheitlich angeschlagen. Hinzu kam 1874 eine schwere Erkrankung, die er sich in Ausübung seines Berufes zuzog. Er starb am 17. Januar 1890 an Influenza.
Dem Namen Salzmann begegnet man in Esslingen mehrfach: Im Salzmannweg in Hegensberg (seit 1956), auf Gedenktafeln im Oberen Metzgerbach 30 (seit 1988) und am ehemaligen Sporthaus Kern in der Ritterstraße 3 (seit 1988), die frühere Salzmann´sche Apotheke, heute Ratsapotheke, das Familiengrab Salzmann auf dem Ebershaldenfriedhof sowie das Salzmann-Camerer-Denkmal. Dieses Denkmal wurde 1921 von der Ortsgruppe Esslingen des Schwäbischen Albverein, dem Verschönerungsverein und der Stadt gestiftet und stand zunächst auf einer Verkehrsinsel an der Ecke Vogelsang-/Fabrikstraße. Wegen des Ringstraßenbaus musste es Anfang der 1970er Jahre versetzt werden und steht jetzt am Langen Weg in Wäldenbronn nahe der Katharinenlinde. Gewidmet ist es den beiden Gründern des Schwäbischen Albvereins, Dr. Valentin Salzmann (1821-1890) und Ernst Camerer (1836-1919). Letzterer wurde in Reutlingen geboren, studierte in Tübingen und Leipzig Rechtswissenschaft und kam 1862 als Referendar nach Esslingen, wo er ab 1863 als Rechtsanwalt tätig war. Er folgte 1890 Salzmann als Vorsitzender des Schwäbischen Albvereins nach.
April 2021 - Modell Kernkraftwerk SIEMENS-KWU »DWR 1300 MW Konvoi«
Modell Kernkraftwerk SIEMENS-KWU »DWR 1300 MW Konvoi«
Papier
Mitte 1980er-Jahre
(J. F. Schreiber-Museum, JFS 700027)

Während der Simulation eines totalen Stromausfalls kam es 1986 im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl zu einem unvorhergesehenen Leistungsanstieg. Kurz darauf explodierte der Reaktor-Block 4 und brannte in den folgenden Tagen aus. Eine enorme Menge an radioaktivem Material wurde in die Atmosphäre geschleudert und verseuchte das Umland Tschernobyls. Die nahe gelegene Stadt Prypjat, mit immerhin 49.000 Einwohnern, musste komplett evakuiert werden und ist auch heute noch unbewohnbar. Durch Windströme gelangten nukleare Partikel zudem weiter bis nach Mittel- und Nordeuropa. Diese Katastrophe jährt sich am 26. April 2021 zum 35. Mal.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Idee auf Atomenergie auch für friedliche Zwecke einzusetzen. Kostengünstiger Strom und neue Technologien sollten, so die damalige Auffassung, durch Atomenergie ermöglicht werden. Zur Stromversorgung der Bevölkerung entstanden in Deutschland zwischen 1970 und 1985 25 Reaktoren. Federführend war hierbei die Kraftwerk Union AG (KWU), einer gemeinsamen Tochtergesellschaft von Siemens und AEG, die 1969 gegründet wurde und lange Zeit eine Monopolstellung als Hersteller für Kernkraftwerke in Deutschland einnahm. Zu Beginn der 1980er-Jahre entwickelte die KWU die sogenannte „Konvoi-Reihe“. Wurde zuvor noch jedes Kraftwerk individuell geplant, gab es nun eine mehr oder weniger standardisierte Bauform, die letztendlich in drei Anlagen realisiert wurde.
Die Marketingabteilung der KWU suchte 1983 nach einer Möglichkeit die Konvoi-Reihe zu bewerben. Auf der Nürnberger Spielwarenmesse waren sie auf ein Kartonmodell gestoßen, bei welchem Dächer und Zwischenböden herausnehmbar waren. Dem Interessierten konnte so ein spielerischer Zugang zu den Informationen über die Kraftwerke ermöglicht werden. Für die Konzeption und Produktion wandten sie sich an den J.F. Schreiber-Verlag, für welchen ein Modell in dieser Größe und mit einem solchen Detailreichtum eine absolute Premiere war. Der Verlag beauftragte den Konstrukteur und Designer Thomas Pleiner mit der Erstellung eines geeigneten Kartonmodells. Dieser entwickelte innerhalb von acht Monaten einen Bausatz, der aus 18 Bogen mit 1.154 Teilen bestand. Das fertige Modell fasziniert besonders durch die abnehmbaren Dächer des runden Reaktorgebäudes und des Maschinenhauses, wodurch detaillierte Einblicke in das Innenleben und somit in die Funktionsweise eines Atomkraftwerks ermöglicht werden. Ein zentrales Element für das Marketing der KWU ist das dem Modell beiliegende Poster sowie eine Broschüre zur Beschreibung. Diese sollten „die prinzipielle Arbeitsweise eines solchen Kernkraftwerks vermitteln – damit der Bastler noch ein bisschen mehr von dem versteht, was er da gerade ausschneidet und zusammenklebt.“ Das weltweit beachtete Modell erschien in zwei Auflagen in deutscher und englischer Sprache. Die KWU stellte das Modell allen Energieversorgern – und somit potenziellen Kunden – der BRD zur Verfügung. Zudem wurden Informations- und Besucherzentren der bestehenden Kernkraftwerke, Schulen, Berufsschulen und andere Bildungseinrichtungen mit einem Exemplar versorgt.
Von der KWU wurde das Modell in großer Stückzahl verkauft, sodass es Mitte der 1990er-Jahre vergriffen war. Das eigentliche Ziel der Marketingkampagne, weitere Atomkraftwerke des Modells Konvoi zu errichten, wurde aber verfehlt. Der Baubeginn der drei realisierten Kernkraftwerke war bereits vor der Veröffentlichung des J.F. Schreiber-Modells. Die KWU plante zwar zusammen mit ihren Kunden sechs weitere Konvoi-Kernkraftwerke, jedoch wurden diese letztendlich nicht gebaut. Ein Hauptgrund war dabei das Reaktorunglück von Tschernobyl, durch welches die Probleme und Gefahren einer Energiegewinnung mittels Atomkraft stark ins öffentliche Interesse rückten. Spätestens seit 2011, als ein Erdbeben das japanische Atomkraftwerk Fukushima zerstörte, sind Neubauten von Atomkraftwerken in Deutschland nicht mehr gefragt.
März 2021 - „Spätzle-Max“
„Spätzle-Max“
Kunststoff, Metall
Firma Julius Glass KG, Esslingen-Berkheim
1970er Jahre
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 004895)

Auch wenn die Esslinger Firmenwelten des 20. Jahrhunderts nicht unbedingt für die Herstellung von Haushaltsgeräten bekannt waren, gab es in der Stadt nach 1945 doch einige Firmen auf diesem Gebiet, die seinerzeit wohl bekannt waren. Beispielsweise stellte die Firma Paul KG in Mettingen und später in Zell unter dem Markennamen „MIXI“ Küchenmaschinen für den Haushalt her. Auch einen Hersteller von elektrischen Kaffeemühlen gab es in der Stadt: die Metallwarenfabrik Brenner & Nähter KG in der Schelztorstraße 33 produzierte diese Haushaltshelfer unter dem Namen „Südstahl“.
Im zeitgemäßen, topmodernen Orange der 1970er Jahre präsentiert sich der vorgestellte Küchenhelfer zur Herstellung handgeschabter Spätzle des Berkheimer Herstellers Julius Glass. Mit seiner Hilfe konnten auch ungeübte Köche diese schwäbische Spezialität selbst herstellen. Denn nicht mehr mit Hilfe des Spätzlesbrettes und eines Messers, sondern dank eines ausgeklügelten Mechanismus wurden die Spätzle in das heiße Wasser befördert.
In ihrer beigelegten Gebrauchsanleitung richtete sich die Firma Glass ausdrücklich an Köchinnen und forderte darin die glücklichen Besitzerinnen auf, die Anleitung genau zu studieren, um die Besonderheiten des Gerätes kennen zu lernen.
So stand am Anfang ein Teigrezept. Da es sich allerdings beim „Spätzle-Max“ nicht um eine Presse, sondern um eine Maschine zum Schaben von Spätzle handele, wies man darauf hin, dass der Teig für diese Herstellungsmethode eine weniger feste Konsistenz benötige. Der (übrigens auch für handgeschabte Spätzle) in der Konsistenz etwas dünnere Teig war nämlich notwendig, weil er sich sonst nicht gut mit dem Gerät verarbeiten ließ.
War der Teig hergestellt, musste er in die Aufnahme des „Spätzle-Max“ gefüllt werden. Danach setzte ihn der Koch/die Köchin auf den Rand des Topfes auf und musste nur noch „den Handgriff vor- und zurückbewegen.“ Schon waren die Spätzle fast fertig!
Ebenso einfach war es, die Dicke der so geschabten Spätzle zu beeinflussen. Hielt man das Gerät waagrecht, entstanden dünne Exemplare, je steiler es gehalten wurde, desto dicker wurden die Spätzle, da mehr Teigmasse nachlaufen konnte. Um zu gewährleisten, dass dies alles gut funktionierte, musste die Schneidkante allerdings in das Wasser eingetaucht werden, da sich sonst der Teig nicht vom Schaber löste.
Die Firma Julius Glass KG existierte fast 70 Jahre. Ihr Geschäftsfeld war die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Haushalts- und Küchenmaschinen. Die Firmengeschichte begann laut dem Eintrag in das Handelsregister am 8. November 1919 in Cannstatt. Der Stuttgarter Kaufmann Julius Glass (1872-1946) hatte kurz zuvor in der Cannstatter Straße 68 in Obertürkheim mit fünf Mitarbeitern die Herstellung von Haushaltsmaschinen aufgenommen.
Während der Weltwirtschaftskrise der frühen 1930er Jahre stellte Julius Glass aufgrund fehlender Aufträge vorübergehend die Produktion ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg wechselte der Firmeninhaber, der Firmensitz befand sich nun bis 1955 in Stuttgart-Rohracker.
Am 31. März 1955 wurde die Firma in Stuttgart abgemeldet, da sie ihren Firmensitz nach Berkheim verlegt hatte. Dort wurde sie 1961 als „Fertigungsbetrieb“ verzeichnet. Neben dem Maschinenbau gehörte nun anscheinend auch die Herstellung von Gußformen zu ihrem Arbeitsbereich. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie abermals einen neuen Besitzer. In den Adressbüchern von 1969/70 wird sie als Hersteller von Großküchenbedarf geführt.
Spätestens jetzt war der Firmensitz in der Jakobstraße 50 in Berkheim. Im Heimatbuch „Berkheim“ von 1982 wird sie jedoch nicht mehr als aktive Firma geführt. Ende September 1987 stellte sie ihre Handelstätigkeit offiziell ein. Die Löschung aus dem Handelsregister erfolgte dann am 6. April 1988. Zuvor hatte sie ihren Firmensitz nach Backnang verlegt, wo es noch heute eine Maschinenbaufirma unter dem Namen des seinerzeitigen Inhabers gibt.
Februar 2021 - Werbeschild der Gasgemeinschaft Esslingen
Schild der Gasgemeinschaft Esslingen a.N.
Emailliertes Eisenblech
Zweite Hälfte 20. Jahrhundert
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 005209)

Gas als Beleuchtungsmittel wurde in Esslingen bereits seit 1827 verwendet. Das Fabrikgebäude Kessler, Hübler & Co war sogar die erste Fabrik in Württemberg, die mit Gas beleuchtet wurde. Gas zum Heizen und Kochen, auch in privaten Haushalten, kam jedoch erst Anfang des 20. Jahrhunderts auf. Gasherde, Gasheizungen, Gasbadeöfen und Gaswaschmaschinen konnten die Esslinger Bürger nun erwerben. Betrieben wurden die Geräte mit Stadtgas, das durch Kohlevergasung vom Gaswerk Esslingen hergestellt wurde. Ein allgemeines Interesse an der Nutzung der Gasgeräte im privaten Haushalt war zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Esslingen durchaus spürbar. Die Anschaffungspreise der Geräte sowie die Preise für das Gas waren jedoch lange Jahre auf einem sehr hohen Niveau. Es war also an der Zeit, mit verschiedenen Werbeaktionen auf die Verwendung von Gas in privaten Haushalten aufmerksam zu machen und so Kunden zu gewinnen.
Zu diesem Zweck wurde am 15. Mai 1934 die Gasgemeinschaft Esslingen a. N. gegründet. Sie war eine Arbeitsgemeinschaft der Stadtwerke, der Flaschner- und Installateur-Innung sowie freier Installateure. Das Hauptziel bestand in der Versorgung der Bevölkerung mit Gasgeräten zu günstigen Kauf- und Zahlungsbedingungen. Hierfür verfügte die Gasgemeinschaft über einen Schauraum, der bereits vor ihrer Gründung vom Gaswerk in der Bahnhofsstraße eingerichtet wurde. Zur weiteren Absatzsteigerung errichtete das Gaswerk eine städtische Lehrküche, die ebenfalls mit dem Start der Gasgemeinschaft in deren Obhut überging. In dieser Lehrküche wurde den potenziellen Kunden gezeigt, wie mit den gasbetriebenen Haushaltsgeräten gekocht, gebacken und eingedünstet werden konnte. Diese Strategie zeigte großen Erfolg, kauften doch die Esslinger Bürger ihre Geräte nicht beim Fachhändler, sondern bei der Gasgemeinschaft. Daneben wurden Werbeanzeigen geschalten, etwa im Adressbuch der Stadt Esslingen. Ab 1935 und somit kurz nach der Gründung der Gasgemeinschaft, tauchen hier Werbungen für die Nutzung von Gas im privaten Haushalt auf.
Auch während des Zweiten Weltkriegs bestand die Gasgemeinschaft. Durch den immer wiederkehrenden Kohlemangel in der Stadt, kam die Produktion in den Nachkriegsjahren zeitweise jedoch zum Erliegen. Werbung für Gasgeräte in privaten Haushalten, war daher in dieser Zeit nicht gefragt. Dies änderte sich erst wieder 1949. Mit der Reaktivierung der Gasgemeinschaft am 17. Januar durch den Stadtrat, sollte die jahrelang vernachlässigte Gaswerbung wieder stärker in den Mittelpunkt rücken und der Gasabsatz gesteigert werden. Um wieder Konkurrenzfähig gegenüber der Elektrizität zu werden, griff die Gasgemeinschaft 1957 auf das Erfolgsrezept aus den Anfangsjahren zurück. In der Oberen Metzgerstraße wurden daraufhin Ausstellungsräume mitsamt einer Gaslehrküche eingerichtet. Neben der Werbung und dem Absatz von Gasgeräten, bestand eine weitere Aufgabe der Gasgemeinschaft in der Weiterbildung ihrer Mitglieder in Kursen und Vorträgen. Mitglieder waren dabei nicht die Kunden, sondern die Installateure und Flaschner. Die „vorteilhaften Teilzahlungsbedingungen“ bekamen zunächst auch nur die Mitglieder der Gasgemeinschaft. Diese konnten mit einem attraktiven Kredit die Gasgeräte bei der Gasgemeinschaft erwerben, mussten sich jedoch dazu verpflichten, diese möglichst schnell anzuschließen. 1959 wurde dieses Prinzip auch auf die privaten Endverbraucher ausgeweitet. Bei einem Zinssatz von 0,5 %, konnten die Kosten für Gasgeräte innerhalb eines Jahres zurückgezahlt werden. Sollte der Kunde die Kosten für das Gerät bereits nach sechs Monaten abbezahlt haben, entfielen die Zinsen. Ob es sich bei dem Schild also für eine Werbeaktion für die Mitglieder der Gasgemeinschaft oder für die Kunden handelt, ist leider nicht klar. Das Finanzierungsmodell der Gasgemeinschaft etablierte sich jedoch in Esslingen und wurde zum vollen Erfolg. Waren 1960 gerade einmal 150 Wohnungen mit Gasheizungen ausgestattet, heizten zehn Jahre später schon 9.000 Haushalte mit Gas.
Januar 2021 - Johannes Braungart, Blick über die Champagne, 1825
Johannes Braungart: Blick über die Champagne ins Neckartal
Gouache, 27x44 cm
Um 1825
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006974)

Fährt man heute auf vierspurigen oder viergleisigen Verkehrssträngen von Esslingen nach Stuttgart, sieht man Industrieanlagen und andere Baulichkeiten, zwischen denen kaum ein wenig Grün bestehen kann. Das war vor der Industrialisierung anders. Ein von Esslingen aufbrechender Reisender berichtete 1781: „Die Gegend um die Stadt und bis hin nach Stuttgart ist von unbeschreiblicher Schönheit.“ Wie ein Beleg für diese Aussage wirkt die um 1825 entstandene Aussicht von der Gegend der heutigen Parksiedlung hinab über die Champagne, zwischen dem eleganten Schlösschen Weil (1820) und dem Weingärtnerdorf Mettingen hindurch über den in weiten Schleifen sich schlängelnden Neckar hinweg nach Obertürkheim mit der hochgelegenen Petruskirche, Untertürkheim und bis Cannstatt.
Im Vordergrund herrscht mit Rindvieh und Hütejungen die Stimmung einer Alm, unten im Tal tummeln sich die Araberpferde des Königlichen Gestüts, dahinter blitzt immer wieder der Fluss auf, der sich von einer Talseite zur anderen windet und in Mettingen bis zur Hauptstraße reicht, der heutigen Schenkenbergstraße. Rechts darüber sieht man am Bildrand eher schlecht den alten Ailenbergturm von 1574 und über diesem recht deutlich die bereits 1824 fertiggestellte Grabkapelle auf dem Rotenberg für die 1819 erst dreißigjährig verstorbene Königin Katharina.
Wiesen, Wälder, Weinberge und, wie dazwischen gestreut, den Fluss entlang einzelne Dörfer und die vom Königlichen Hofbaumeister Giovanni Salucci (1769-1845) neu erstellten klassizistischen Repräsentationsbauten machen den Reiz dieser vom jungen König Wilhelm I. (1781-1864) betriebenen Inszenierung des mittleren Neckartales aus. Es war ein in der Tradition englischer Gartenanlagen extrem weitläufig arrangiertes Landschaftsbild, das vom aufstrebenden Bad Cannstatt und dem gegenüber 1829 erbauten Schloss Rosenstein bis ans neuwürttembergische Esslingen heran reichte.
Die Gunst der Lage vor den Toren der Residenzstadt Stuttgart und die leichte Erreichbarkeit durch das hier gleichmäßig breite Tal erlaubten es der Hofgesellschaft, dem geregelten Hofleben zu entfliehen und hier das zu genießen, was als Mischung von einem realen württembergischen Landstrich und einer arkadisch anmutenden Landschaftsphantasie daherkommt.
Dabei waren die handfesten Initiativen etwa der Pferdezucht und Meierei in Weil, deren Baulichkeiten man ganz links mehr erahnen als sehen kann, durchaus staatspolitisch. Als Reaktion auf die große Hungersnot in seinem Krönungsjahr 1816 versuchte der junge Monarch die das Land prägende Landwirtschaft zu verbessern. Dazu gehörten systematische und bedarfsorientierte Viehzucht ebenso wie Landesschauen und andere Wettbewerbe.
Der Esslinger Maler Johannes Braungart (1803-1849) hat die Ideallandschaft mit realer Basis um oder kurz nach 1825 eingefangen. Er hat in seinem Werk in Malerei und Zeichnung vor allem das alte Esslingen seiner Zeit in vielen Ansichten dokumentiert, das damals Stück für Stück dem neuen, dem industriellen Esslingen zu weichen begann. Aber noch war die Landschaft um die Stadt herum offen und der Neckar so unbändig wie eh und je. Noch dominierten Acker-, speziell Weinbau und Viehzucht die Ökonomie des Neckartales, aber die Industrie war, zumindest in der Stadt Esslingen, bereits gestartet: Die Metallwarenfabrik von Carl Deffner, die mechanische Baumwollspinnerei von Christian Schöllkopf, die Handschuhfabrikation von Caspar Bodmer und, etwa zur Entstehungszeit des Bildes, die Sektproduktion von Georg Christian Kessler.
Nichts von diesen vorwärts strebenden Aktivitäten lässt dieses Bild ahnen. In diesem stillen Idyll mit realistischer Bodenhaftung herrscht jedoch neben dem Geist der guten alten Zeit auch die Prägung durch das damals noch ziemlich neue Königsreich mit seinen den Blick mitbestimmenden Neubauten. Der Anspruch der neuen deutschen Mittelmacht, direkt vor der stark wachsenden Hauptstadt Stuttgart mit landschaftsprägenden Bauten international mithalten zu können, ist offensichtlich. In diesem Sinne ist das Bild bei seiner Entstehung hochaktuell und spiegelt auch die Dynamik der ersten Herrschaftsjahre Wilhelms I.
Dezember 2020 - Funkturm für die Modellbahnanlage der Firma Eheim
Funkturm für die Modellbahnanlage
Kunststoff, Massstab 1:87, Höhe 69cm
Firma Eheim Elektrospielwaren Esslingen
1950er Jahre
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006044)

Ein Hingucker auf jeder Modellbahnanlage oder Herzenswunsch der Modelleisenbahner nicht nur zur Weihnachtszeit war er sicherlich: der Funkturm im Maßstab HO mit teilweise funktionsfähigem Aufzug des Esslinger Modellbahnzubehörherstellers Eheim.
Das „Turmcafe“, die Betriebsstation und der elektrische Aufzug sind beleuchtet, ein rotes „Flugzeug-Warnlicht“ unterhalb der Antenne blinkt nach allen vier Seiten. Technische Perfektion im Stil der Zeit vermittelt auch das „Stahlgittergerüst“ des Turmes. Dank der eleganten und luftigen „Linienführung wirkt er leicht und doch wieder durch seine Größe imposant, so recht als Krönung einer jeden Modellanlage“ (Firmenprospekt von 1958). Zusammenbauen musste es der Modellbauer aus einzelnen Plastikgußteilen selbst. Ein solcher Bausatz befindet sich ebenfalls in der Sammlung des Stadtmuseums - natürlich unbenutzt.
Der Öffentlichkeit vorgestellt wurde das Funkturm-Modell erstmals anlässlich der Nürnberger Spielwarenmesse 1955 in einer Fachzeitschrift. Darin hieß es: „ Nicht minder attraktiv ist ein Funkturm mit Blinklicht an der Spitze und einem beleuchteten und bewegten Aufzug im Inneren des Mastes. Dieser Funkturm kann sowohl mit als auch ohne Aufzug geliefert werden (der Aufzug lässt sich später noch einbauen).“
1956 kam eine verbesserte Version mit „ Blinklicht und Fernsehantenne“ zur noch naturgetreueren Anmutung des Turmes hinzu; als Fertigmodell (komplett mit Aufzug und Blinklicht wie das gezeigte Exemplar) war der Turm dann von 1958 zu haben. Er kostete damals den stolzen Preis von 45.50 DM. Ohne den Aufzug belief sich der Preis für das fertige Modell auf 25 DM, den Bausatz zum selber bauen gab es dagegen schon für 14,70 DM zu erwerben.
1949 gründete der Ingenieur Gunther Eheim (1919-2013) eine Firma zur „Reparatur und Herstellung technischer Spielwaren“ in der Mittleren Beutau 42. Zu ihrem Sortiment gehörten maßstabsgetreue Zubehörartikel für Modelleisenbahnen. Dies waren neben den berühmten „Seuthe-Dampferzeugern“ für einen realistischen „Dampfbetrieb“ von HO-Lokomotiven und einer Miniatur-Seilbahn vor allem der dem Esslinger Original nachempfundene Trolley-Bus mit Oberleitungssystem, aber auch der vorgestellte Funkturm. Mit ihrer Hilfe konnten Modellbahner ihre Anlagen multifunktional und wirklichkeitsgetreu einrichten. Dies machte sie seinerzeit sehr beliebt.
Zu den bei Eheim produzierten Zubehörteilen für Modellanlagen gehörte seit 1962 auch eine Kreiselpumpe. Mit ihrer Hilfe konnten Springbrunnen auf der Anlage mit echtem Wasser in Betrieb genommen werden. Aufgrund ihrer zuverlässigen Technik wurde die Pumpe bald aber auch in der Medizintechnik und für Laborgeräte eingesetzt.
Aus dieser Kreiselpumpe, ergänzt durch einen Reinigungsbehälter entstand 1963 der Eheim-Saugfilter für Aquarien, zur Reinigung des Wassers. Heute sind Aquarienpumpen der Firma Eheim ein weltweit verbreitetes Produkt. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurde 1956 der Firmensitz nach Deizisau verlegt.
Die Produktion von technischem Spielzeug wurde angesichts dieses Spartenwechsels weitgehend aufgegeben und 1970 ganz eingestellt. Allerdings übernahm die 1948 von Artur Braun in Waiblingen gegründete Firma BRAWA (heute in Remshalden) schon 1963 einen Teil der Modellbausparte. Sie stellte bis 2000 Trolley-Busse her; Seilbahnen finden sich bis heute in ihrem Modellbahnzubehörprogramm.
Auch die Herstellung des Funk- und Fernsehturms wurde seinerzeit von Brawa übernommen. Er war dort wohl bis Ende der 1970er Jahre im Programm. Im Brawa Katalog von 1976 wurde der Turm dann nur noch als Funkturm bezeichnet. Zuletzt verzichtete man auch auf den Einbau des Aufzugs.
November 2020 - Werbeaufsteller der Esslinger Wolle
Werbeaufsteller Esslinger Wolle
Lackierter Draht, bedruckte Hartfaserplatte
Mitte der 1950er Jahre
(Stadtmuseum im Gelben Haus Esslingen STME 006908)

Werbung im Einzelhandel ist in den 1950er Jahren noch großteils Schaufensterwerbung. Dazu wird neben der angebotenen Ware gerne ein Blickfang präsentiert. Das einfache lackierte Drahtgestell von etwa 50 cm Höhe mit dem großen geschwungenen und dem kleinen informierenden Schild ist für kleine Schaufenster gedacht und preist recht unspezifisch die Esslinger Wolle an. So kann dieses sparsame Werbemittel jedoch vielfältig und mehrfach eingesetzt werden. Außerdem kann man es wie eine Staffelei zusammenklappen und so leicht verstauen oder transportieren.
Der dünne, an den Enden spiralig aufgedrehte, weiß lackierte Draht, das in weichen Schwüngen ausgesägte asymmetrische Schild in Pastelltönen und die skizzenhafte graphische Gestaltung vermitteln zusammen ein Gefühl von unbeschwerter Leichtigkeit.
Das Motiv hat ein unbekannter Zeichner mit leichtem Strich gestaltet. Wir sehen eine in Rosa-Weiß gekleidete junge Frau mit einer hochmodernen hochgesteckten Frisur. Ihre überlangen Wimpern zeigt sie tief gesenkt, die rot gemalten Lippen hält sie fest geschlossen. Das weite Kleid mit Puffärmeln, Wespentaille und glockenförmig fallendem Rock lässt die schmalen Schultern frei – für die mittleren 1950er Jahre ist das schon recht gewagt. Sie trägt bis zu den Ellenbogen reichende weiße Lederhandschuhe, die damals einer eleganten Dame von Welt gut anstanden. Der üppige Blumenstrauß, den sie emporhält, besteht aus sechs kleinen roten Rosen und – erstaunlicherweise – acht farbkräftigen großen Wollknäueln. Davon sind fünf die traditionell aus einem Strang von Hand abgewickelten runden Knäuel und drei die damals neu entwickelten und bis heute üblichen, bereits in der Fabrik aufgewickelten und direkt zum Verstricken einsetzbaren ovalen Knäuel mit Banderole.
Unter dieses mit einem Kringelrand verzierte weißgrundige Motivschild ist ein zweites, kleines Schild auf den Drahtständer geklebt. Es wirkt wie ein nachträglich angebrachter Aufkleber: schräg angesetzt und ganz reduziert zeigt es auf gelbem Grund in Rot das traditionelle Signet und den Schriftzug der Esslinger Wolle. Dies ist nur der Hinweis auf die Firma, irgendwelche weitergehenden Informationen fehlen. Aber es ist ganz wichtig, denn so weiß man, wofür hier eigentlich Reklame gemacht wird. Das vertraute Zeichen der die Wolle vom Strang zu einem Knäuel aufwickelnden Frauen auf den Banderolen der Blumenstrauß-Knäuel ist dafür schlicht zu klein.
Es zeugt natürlich auch vom Understatement, mit dem die Esslinger Traditionsfirma Merkel & Kienlin hier auftritt. Diese national bedeutende Firma hatte es nicht nötig, mehr als ihr seit 1930 unverändertes Erscheinungsbild einzusetzen, da damals alle sofort wussten, wer hinter diesem Auftritt stand.
1929-32 hatte der später als Buchgestalter erfolgreiche Walter Brudi das Werbeatelier des Unternehmens geleitet, das sich im Bereich des heutigen Esslinger Merkelparkes zwischen Bahnlinie und Neckar erstreckte. Brudi hatte zum 100jährigen Jubiläum 1930, aber auch für lange Jahrzehnte danach das Logo sowie ein sachliches und meist Fotografie und Grafik kombinierendes Erscheinungsbild der bis in die frühen 1970er Jahre in Esslingen bestehenden Kammgarnspinnerei geprägt.
Bei diesem Blickfang wurde jedoch bewusst im scharfen Kontrast dazu in Stil, Motiv und Anmutung eine nicht reale Situation gewählt, die die informative Fotografie eben nicht verwendete, die jahrzehntelang die Esslinger Wollhefte geprägt hat, sondern eine traumhafte, stille, ein wenig absurde Stimmung in einem zeichnerischen Entwurf suchte. Präzise Information war bei diesem Hingucker auch deswegen entbehrlich, weil hinter dem Schaufenster das Wollgeschäft genau diese Information bot.
Oktober 2020 - Bierkrug der Weckerlinie Esslingen
Bierkrug der Weckerlinie Esslingen
Steinzeug mit Zinndeckel
um 1925
(Stadtmuseum im Gelben Haus STME 000098)

Die Feuerwehr will überall so schnell wie möglich am Brandherd sein, um früher und damit besser löschen zu können. Das hat das System der allgemeinen Löschpflicht aller Bürger im rasch wachsenden Esslingen des 19. Jahrhunderts völlig überfordert. Daher organisierten sich am 30. August 1852 im Gasthaus zum „Schwanen“ 80 Turner unter ihrem Hauptmann Theodor Georgii als „Steigerkompanie“. Sie widmeten sich ausdrücklich und ausschließlich der Brandbekämpfung in Esslingen. Diese demokratisch und straff organisierte Freiwillige Feuerwehr wuchs rasch, während die Pflichtfeuerwehr an Bedeutung verlor und 1887 aufgelöst wurde.
Um noch schneller und noch effektiver auf einen Alarm reagieren zu können, führte man 1895, also vor 125 Jahren, eine in den USA entwickelte und bereits seit 1893 in Heilbronn bestehende technische Neuerung ein: die Weckerlinie. Dabei wurden nur 24 Feuerwehrleute, alle selbständige Handwerker, die nahe am Spritzenhaus wohnten und arbeiteten, sowie zwei Fuhrleute mit einer elektrischen Klingel alarmiert. Die Alarmzentrale war in der Polizeiwache, welche von öffentlichen Feuermeldern alarmiert wurde und den Alarm weiterschickte.
Damals gab es in Esslingen noch keine elektrische Stromversorgung. Die Läutwerke in den Häusern der beteiligten Männer waren wie Glieder einer Kette hintereinander geschaltet, daher die Bezeichnung „Weckerlinie“. Diese störungsanfällige Konstruktion war damals aber ein enormer Fortschritt; entsprechend fühlten sich ihre Mitglieder als Elite der Esslinger Wehr. Ihre beiden Einsatzfahrzeuge waren ein Fuhrwerk mit einer modernen Drehleiter sowie ein Hydranten- und Gerätewagen. Im April 1895 wurde die Gründung beschlossen, im September eine erste Übung abgehalten, und schon am 28. Oktober 1895 wurde die Weckerlinie offiziell eingeweiht.
Mit dieser neuen Errungenschaft wiederholte sich, was eine Generation früher die Steigerkompanie bewirkt hatte: Das alte Feuerwehrcorps verlor an Bedeutung und wurde bei leichteren Brandfällen gar nicht erst alarmiert, während die Weckerlinie schon im ersten Jahr zweimal ausrückte und in den Folgejahren jeweils zwischen drei und elf Einsätzen hatte.
„Die Tätigkeit der Weckerlinie, welche nach erfolgter Alarmierung in kürzester Zeit zur Stelle ist, ist eine segensreiche. Durch ihr Eingreifen ist in einer großen Zahl von Fällen das Feuer in seinen Anfängen bewältigt und größerer Schaden verhütet worden“, lobte der Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten im Jahr 1906.
Aus der langen 24-er Linie wurden in den 1920er Jahren drei kleinere mit jeweils etwa einem Dutzend Melder und drei Alarmschleifen für je rund 12 Feuerwehrleute. Zusätzlich wurde die Esslinger Feuerwehr kurz nach dem Ersten Weltkrieg motorisiert: 1920 wurde eine Automobilspritze und 1922 eine Autodrehleiter angeschafft. Damit war man vielen anderen Städten voraus.
Damals wie heute wurde der Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr auch durch Geselligkeit gestärkt. Viele Jahre war der „Karmeliter“ das Lokal der Esslinger Weckerlinie, wo man sich traf und gemeinsam feierte. Der Angehörige der Alarmschleife 1, der Monteur Anton Öttinger, der in den 1920er Jahren in der Kiesstraße 32 wohnte, besaß seinen eigenen Halbliter-Bierkrug. Auf dem Zinn-Deckel ist sein Name eingraviert und ein Miniatur-Feuerwehrhelm aufgeschraubt. Vorne ist der Bierkrug auf der grauen Salzglasur-Oberfläche mit einem beeindruckenden Bildarrangement verziert: Vor Lorbeerzweigen sind Leitern, ein Helm und zwei vielfach gewundene Schläuche mit Strahlrohr zu einem verwirrenden Gebilde zusammengestellt, das ein Wappenschild umgibt, auf dem der alte Leitspruch aller Feuerwehren steht: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. Und darunter, ganz stolz und selbstbewusst „Weckerlinie Esslingen“. Da schmeckt das Bier doch gleich doppelt so gut!
September 2020 - Metallwarenfabrik Deffner: Figur einer Weingärtnerin
Figur einer Weingärtnerin
Metallwarenfabrik C. Deffner
Weißblech, lackiert
H 41cm; B 20cm; T 15cm; D 12,5cm
19. Jahrhundert
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006818)

Die stark idealisierte Figur einer Weingärtnerin mit aufgesetzter Bütte stammt aus Familienbesitz. Hergestellt wurde sie um die Mitte des 19. Jahrhunderts von der Metallwarenfabrik C. Deffner in Esslingen aus dünnem Weißblech, das zugeschnitten, geformt, gelötet und zum Schluss farbig lackiert wurde. Auf einer runden, abgetreppten und grün lackierten Standfläche ist die Figur befestigt. In leichter Schrittstellung, den rechten Arm neben dem Körper schwingend, erhält sie eine dynamische Gestalt. Der linke Arm ist nach hinten abgewinkelt und stützt die auf dem Rücken getragene Bütte. Der Kopf der Weingärtnerin wird von einem breitkrempigen Hut vor Wind und Wetter geschützt. Die Weingärtnerin ist zwar in einem ländlich anmutenden Stil gekleidet, doch dürfte sich keine Frau zur schweren Arbeit im Weinberg so herausgeputzt haben. Der weiße, grün gesäumte Rock wird teilweise von den strahlenförmigen und reich verzierten Ausläufern des Oberkleides überdeckt. Dieses hat aufwändig gestaltete Ärmel und über den Schultern trägt die Figur eine Art Stola. Auch die Form der Bütte ist eher dem Bereich der Phantasie entsprungen und hat kaum Ähnlichkeit mit den tatsächlich verwendeten Exemplaren. Benannt war die Firma nach Carl Christian Ulrich Deffner (1789-1846), der 1815 Teilhaber von Heinrich Rudy wurde, der seit 1809 lackierte Blechwaren herstellte. Deffner übernahm die Firma 1819. Von einer Englandreise hatte er die damals modernsten Herstellungsmethoden im Metallbereich mit nach Deutschland gebracht, was ihn zum Wegbereiter der Metallbearbeitung in Esslingen machte. 1825 verlegte die Firma ihren Standort in die Pulverwiesen (heute Landratsamt), wo die für den Betrieb des modernen Maschinenparks notwendige Wasserkraft vorhanden war. Carl Deffner setzte sich als liberaler Landtagsabgeordneter und Sprecher der Esslinger Fabrikanten für die Förderung der Industrie ein. Aber auch für seine Beschäftigten sorgte er vor, indem er bereits 1829 eine Krankenkasse gründete. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn Carl Ludwig Deffner (1817-1877), der 1844 in die Firma eingetreten war, die Leitung des Betriebes. Neben den deutschen Ländern waren vor allem die Schweiz und Nordamerika das Hauptabsatzgebiet der hergestellten Produkte. Die große Blütezeit der Firma endete allerdings schon um 1900, nicht zuletzt weil die örtliche Konkurrenz stark an Bedeutung gewonnen hatte und verstärkt auf neue Techniken setzte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Firma etwa 500 Mitarbeiter/innen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden immer noch viele Arbeitsschritte von Hand durchgeführt und die Firma war seit Ende der 1960er Jahre nicht mehr konkurrenzfähig sowie der Maschinenpark veraltet und die Gebäude renoveriungsbedürftig.Auch hatte sich der Geschmack der Käufer gewandelt. Daher wurde 1969 die Produktion eingestellt, bis 1972 blieb die Firma in Familienbesitz. Anfangs stellte die Metallwarenfabrik C. Deffner lackierte Blechwaren, wie Tabletts oder Vogelkäfige her. Diese waren zum Teil bedruckt, wurden aber vor allem mit Aufklebern verziert. Zu den bekanntesten Mitarbeitern gehörte der für seine detailreichen Abbildungen längst vergangener Bauwerke bekannte Esslinger Maler Johannes Braungart (1803-1849), der für die Firma zahlreiche Vorlagen erstellte. Dank der hohen Qualität ihrer Produkte erhielt die Firma bis 1900 Preise auf zahlreichen Industrieausstellungen im In- und Ausland und internationale Aufmerksamkeit. Bei der Weltausstellung 1855 in Paris war Carl Ludwig Deffner Mitglied des Preisgerichts. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts machte sich aber auch hier die innerstädtische Konkurrenz bemerkbar, so dass C. Deffner nicht mehr an internationalen Ausstellungen teilnahm. Im Lauf der Zeit kamen neben lackierten Blechwaren versilberte Metallwaren ins Sortiment. Berühmt war C. Deffner zudem für seine in Niello-Technik ausgeführten Produkte. Reine Jugendstilformen sind – im Gegensatz zu den anderen Esslinger Herstellern – allerdings wenig vertreten. Dafür finden sich zahlreiche Produkte im Stil der englischen Arts and Crafts-Bewegung.
August 2020 - Pieter Francis Peters: Schlösschen Serach vom Kirschenbuckel aus
Pieter Francis Peters: Schlösschen Serach vom Kirschenbuckel aus
Öl auf Leinwand
1845
(Stadtmuseum im Gelben Haus STME 000724)

Das heute von der Stadtentwicklung längst eingeholte, nördlich des einstigen Seracher Ortszentrums am oberen Ostrand des Geiselbachtales liegende Gebäude, war, als es 1820 erbaut wurde, allein auf weiter Flur. 1828 wurde es von Graf Alexander von Württemberg (1801-1844) als Landsitz erworben, der ansonsten standesgemäß im oberen Palmschen Palais, dem heutigen Neuen Rathaus in Esslingen, wohnte. Der Graf nahm bereits 1832 seinen Abschied als Oberstleutnant des in Esslingen stationierten 3. Württembergischen Reiterregiments. Danach war das eher an ein luxuriöses Landhaus erinnernde Schlösschen für ein Jahrzehnt bis zu Krankheit und frühem Tod des auffallenden, attraktiven, „tollen Grafen“ Alexander 1844 ein Treffpunkt der romantischen deutschen Literaten.
Frei von Konventionen und standesgemäßem Verhaltenskodex ging man zwanglos miteinander um, feierte, las sich wechselseitig neue Werke vor, musizierte oder ritt in wilder Jagd querfeldein und durch die Wälder des Schurwaldes. Der Freundschaftsbund des Seracher Dichterkreises umfasste um den ebenfalls literarisch aktiven Grafen Alexander herum neben anderen Ludwig Uhland, Gustav Schwab, Justinus Kerner, Karl Mayer, Emma Niendorf, Hermann Kurz und nicht zuletzt den Busenfreund Alexanders, den am Weltschmerz leidenden, wegen seiner ungarischen Herkunft „Miklos“ genannten Nikolaus Lenau.
Graf Alexander war schon tot, als der niederländische Maler Peters 1845 nach Stuttgart zog und mit diesem Bild den Ausblick aus dem romantischen Idyll auf die präzise wiedergegebene Silhouette der Schwäbischen Alb feierte. Dazu stellte sich Peters auf den nördlich gelegenen, heute ebenfalls ziemlich zugewachsenen Kirschenbuckel und konnte so das Schlösschen samt seiner Aussicht darstellen. Die beiden Damen und der Herr auf der Terrasse, mit denen wir den Ausblick genießen, stehen vor der efeubewachsenen hohen talseitigen Giebelwand des in den Hang hineingebauten Schlösschens, das man vom hangaufwärts verlaufenden Schlösslesweg ebenerdig direkt in der Beletage im ersten Stock betritt.
Das Gärtnerhaus mit vorgebautem Gewächshaus links wurde noch zu Lebzeiten von Graf Alexander 1843 erbaut und gehört nicht zu den erst in den 1850er Jahren nach dem Tod des Grafen im Schweizerhausstil errichteten Nebengebäuden. Man erkennt die überaus naturnah gestalteten Garten- und Parkanlagen des Schlösschens, auf dessen Terrasse es sich mit einem heute längst zugewachsenen Blick durch das Geiselbachtal und über die Beutau und Frauenkirche auf die blaue Wand der Schwäbischen Alb trefflich feiern, trinken und deklamieren ließ.
Der Maler Pieter Francis Peters (1818-1903) war zeitlebens bekannt für die dichte Atmosphäre seiner stimmungsvollen Landschaftsbilder, die er vor allem im württembergischen und alpenländischen Raum schuf. Auch hier sehen wir weniger eine Architekturdarstellung, obwohl das Schlösschen mit allen Details inklusive modernen Blitzableitern und rauchendem Kamin ausgeführt ist. Der dichte und schattige Wald links und im Vordergrund, lenkt unseren Blick unterstützt durch die Orientierung des Schlösschens auf seine Aussicht hin. Wir schauen vom Dunkel ins helle Sommerlicht und einen Schönwettertag, dessen warme und trockene Stimmung man körperlich zu spüren meint. Das Licht des herrlichen Himmels, der fast das halbe Bild einnimmt, zieht das Augenmerk magnetisch tief ins Bild und die Landschaft hinein. Der begeisternde Blick das im Schatten liegende Geiselbachtal hinab über die Auen des Neckartals und die Filderhöhen auf das in blauer Ferne daliegende Plateau der Schwäbischen Alb ist wie ein Loblied des romantischen Seracher Kreises auf die umgebende Natur.
„Singe, wem Gesang gegeben,
In dem deutschen Dichterwald!
Das ist Freude, das ist Leben,
wenns von allen Zweigen schallt.“
(Ludwig Uhland)
Juli 2020 - Lothar Meggendorfer: Lebendes Affentheater
Lothar Meggendorfer:
Lebendes Affentheater
Verlag J. F. Schreiber
1902
(J. F. Schreiber-Museum, JFS 001507)

Die Affenkapelle ist zweifelsohne einer der Höhepunkte des J.F. Schreiber-Museums im Salemer Pfleghof. Sie spielt jedem, der das Museum besucht, –sofern er den Aufzug benutzt – ein Begrüßungsständchen.
Dieses ungewöhnliche musikalische Trio kommt nicht von ungefähr. Es stammt aus einem Buch des Verlags J. F. Schreiber: „Lebendes Affentheater. Ziehbilderbuch von L. Meggendorfer“. Seit 1893 wurde das Buch mehrmals aufgelegt. Es erschien nicht nur auf Deutsch, sondern auch in englischer und französischer Sprache. In einfachen Paarreimen wird aus dem Alltagsleben einiger Zirkusaffen und weiterer Zirkustiere berichtet. Auf eine Textseite folgt eine Seite mit einer vielfarbigen Illustration.
Als Erzähler tritt der Zirkusdirektor auf, der über acht Szenen berichtet. Die liebevoll gestalteten Illustrationen verwandeln sich mit einen für die damalige Zeit besonderen Clou zum Leben. Mithilfe von Papierschiebern lassen sich die Tiere seitlich bewegen. Hinter den Illustrationen verbergen sich ausgeklügelte Papiermechaniken, welche die Bewegung bewerkstelligen. Den Auftakt der Geschichten bildet ein „Gastmahl“, bei dem die Affen in verschiedenen Kostümierungen auftreten. Dort geht es wild zu. Es wird um das Essen gestritten. Die Teller werden abgeleckt. Der Affenkoch genehmigt sich Wein direkt aus der Flasche. Die nachfolgende Szene zeigt zwei Affen als Herr und Dame verkleidet hoch zu Ross. Danach folgt eine dressierte Ziege mitsamt ihrem Dompteur. Das anschließende „Menuett“ zeigt zwei kostümierte Hunde, die aufrecht auf zwei Beinen miteinander tanzen. Begleitet werden sie von der Affenkapelle. Danach folgen ein Braunbär, ein Schaf und ein Schwein, die gemeinsam auf einer Wippe schaukeln. Im Anschluss spielen zwei Affen eine kämpferische Szene an einem Vorposten. Der Zirkuselefant Bimbambo hingegen hat Gefallen an Wein gefunden. Eine Zirkusdame schenkt ihm ein Glas nach dem anderen ein. Den Abschluss macht wiederum eine Affentruppe. Ein Affe als Madame Pompadour wird von zwei Dieneraffen in einer Sänfte chauffiert. Daneben bettelt ein weiterer Affe mit einem großen Zylinder um Geld.
Lothar Meggendorfer (1847-1925) galt als einer der witzigsten und einfallsreichsten Schöpfer von beweglichen Bilderbüchern. Bereits im Alter von 15 Jahren begann er sein Kunststudium an der Königlichen Akademie München. Erste Bekanntheit erlangte er als Mitarbeiter der „Fliegenden Blätter“ und „Münchner Bilderbogen“. Schon bald veröffentlichte er seine „Meggendorfer-Blätter“ – eine damals beliebte Satirezeitschrift.
Der Weg zu den Bilderbüchern wurde ihm durch seine Familie geebnet. Meggendorfer war sechsfacher Vater. Sein erstes bewegtes Bilderbuch bastelte er mit 31 Jahren für seinen Sohn. Es sollten noch einige weitere Bilderbücher folgen. Diese besondere Art von Bilderbüchern erschienen hauptsächlich beim Verlag J.F. Schreiber, der eine Zweigstelle in Meggendorfers Heimat München eröffnete. Die Zusammenarbeit, die 1884 begann, war sowohl für Meggendorfer als auch den Esslinger Verlag sehr fruchtbar.
Lothar Meggendorfer hinterließ mit seinem Werk Spuren, die heute noch erkennbar sind. Für die modernen „Papier-Ingenieure“ ist er ein großes Vorbild geblieben. Das liegt neben seiner prächtigen Illustrationen vor allem an seinen ausgefeilten Papiermechaniken. Auch heute sind bewegte Bilderbücher sehr beliebt. Neben den alten Klassikern, die gefragte Sammlerstücke sind, gibt es auch komplette Neuerscheinungen. Sie werden heute allerdings Pop-Up-Bücher genannt. Besonders beliebt sind die Bücher in den USA, wo jährlich mehrere hunderte neue Titel erscheinen. Dort wird von der Movable Book Society auch heute noch regelmäßig der Meggendorfer Prize für besonders gelungene Bücher verliehen.
Juni 2020 - Schild "Ausstellung Stadtrandsiedlung Sirnau"
Schild „Ausstellung Stadtrandsiedlung Sirnau“
Holz, Farbe
Masse 103,5x304cm
1932
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006949)

Krisensituationen begleiten die Menschen seit jeher. Naturkatastrophen vernichteten die Ernten, Kriege riefen Not und Elend hervor und aktuell bekämpfen die Menschen weltweit die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen. Am – auch als „Schwarzen Freitag“ bekannten – 25. Oktober 1929 kam es in den USA zu einem Börsencrash, der zu einer weltweiten Wirtschaftskrise führte. Sie traf Deutschland besonders hart, da man hier in den 1920er Jahren wirtschaftlich von amerikanischen Krediten abhängig war. Die Produktion brach ein und die Arbeitslosenzahlen stiegen von 1,3 Millionen (September 1929) auf mehr als 6 Millionen (Anfang 1933). Armut, Not und Obdachlosigkeit waren weit verbreitet, auch weil die kurz zuvor eingeführte Arbeitslosenversicherung die hohe Zahl der Bedürftigen nicht versorgen konnte.
1930 zerbrach die letzte demokratisch gewählte Regierung der Weimarer Republik, eine „Große Koalition“. Bei den anschließenden Reichstagswahlen wurde die NSDAP die zweitstärkste Partei. Da sich keine regierungsfähigen Koalitionen mehr bilden ließen, führte Reichspräsident Paul von Hindenburg mit Hilfe des Notverordnungsrechts Präsidialkabinette ein.
Im Zug der dritten Notverordnung, zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen, erließ Reichspräsident Hindenburg am 6. Oktober 1931 die „Verordnung zur vorstädtischen Kleinsiedlung und Bereitstellung von Kleingärten für Erwerbslose“. Mit Hilfe niedrig verzinster Darlehen sollten Erwerbslose dazu animiert werden, sich selbst ein Eigenheim zu errichten. Zusätzlich sollten sie durch Gartenbewirtschaftung und Kleintierhaltung schrittweise zu Selbstversorgern werden.
Damals zählte die Stadt Esslingen rund 8.000 Erwerbslose, auch die Wohnungsnot war groß. Daher beschlossen Gemeinderat und Stadtverwaltung unter dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Ingo Lang von Langen, eine Stadtrandsiedlung zu errichten. Anfangs sollten 24 Siedlerstellen entstehen, später kamen 26 weitere hinzu. Am 2. Dezember 1931 erschien eine Bekanntmachung in der Esslinger Zeitung, in der Interessenten dazu aufgefordert wurden, sich bis zum 15. Dezember zu melden. Es gingen insgesamt 56 Bewerbungen ein. Bereits ein Tag nach Ende dieser Frist wurden die Sirnauer Wiesen – einer von vier möglichen Orten – als Standort der neuen Siedlung ausgewählt. Gleichzeitig wurden die Rahmenbedingungen festgelegt: Eine Siedlerstelle sollte mindestens 600m² Land haben, die Kosten pro Gebäude durften maximal 3000 RM betragen und die Siedler verpflichteten sich, mindestens 500 Arbeitsstunden zu leisten. Die Häuser wurden im Holzfachwerkbau nach Plänen des Esslinger Architekten Otto Junge gebaut. Das Holz stellte die Stadt vergünstigt zur Verfügung, ebenso Werkzeug und Arbeitskleidung. Der Baubeginn der Siedlung war im Februar 1932.
Im Juli 1932 waren bereits 24 Häuser fertiggestellt. Da sowohl das Interesse als auch die Kritik an dem Projekt „Stadtrandsiedlung Sirnau“ groß war, luden die Verantwortlichen dazu ein, die neu errichtete Siedlung im Rahmen einer Ausstellung zu besuchen. Hierfür wurden einige Häuser beispielhaft eingerichtet. Vom 1. bis 15. Juli 1932 durfte die die Esslinger Bevölkerung die Häuser besichtigen. Der Eintritt kostete 20 Pfennig.
Das drei Meter lange und knapp ein Meter hohe Schild, auf dem die Ausstellung „Stadtrandsiedlung Sirnau“ und der Ausstellungszeitraum angegeben sind, hing über dem Eingang zur Ausstellung. Jahrzehnte später tauchte es 2013 bei Abbruch- und Renovierungsarbeiten wieder auf – verbaut als Dielenboden, der zunächst beim übrigen Bauschutt landete. Dem Bauherrn fiel jedoch die Beschriftung auf und er setzte das Schild wieder zusammen. Somit fand er ein Objekt, das die Entstehungsgeschichte des jüngsten Stadtteil Esslingens dokumentiert. Gleichzeitig zeigt das Schild, dass das Interesse an der neu entstandenen Siedlung außerordentlich hoch war. Der ursprünglich angedachte Ausstellungszeitraum bis 15. Juli wurde nämlich um zwei Tage verlängert, wie eine nachträgliche Datumsänderung auf dem Schild zeigt. Insgesamt besuchten damals rund 6.500 Esslinger die „Stadtrandsiedlung Sirnau“.
Mai 2020 - Stammbuch von Louise Helene Bonz
Freundschaftsalbum der Louise Helene Bonz
Pappschuber mit beschriebenen Blättern 8 x 12,5 cm
um 1805
(Stadtarchiv Esslingen HS 46))

Mit dem Reichsdeputationshauptschluss 1803, in dem die Entschädigung der Reichsfürsten für die Verluste von linksrheinischen Gebieten an Frankreich geregelt wurde, verlor Esslingen – zusammen mit 44 weiteren ehemaligen Reichsstädten - die Reichsunmittelbarkeit und wurde württembergische Oberamtsstadt. Für die einst so stolzen „Reichsstädter“, vor allem für die bürgerliche Oberschicht und die städtischen Beamten, bedeutete dies einen herben Schlag. So soll den Bürgermeister Erhard Göschel beim Antrittsbesuch im württembergischen Oberamt sogar der Schlag getroffen haben.
Handwerker und Handeltreibende sahen jedoch eher die Chance, einer handelspolitischen Isolation zu entkommen. 1810 gründeten in Esslingen Christian Gottlieb Steudel eine Tuchfabrik, Heinrich Rudy mit Carl Deffner eine Metallwarenfabrik und Caspar Bodmer eine Handschuhfabrik. Sie hatten zunächst nur zögerlichen Erfolg, in allen Branchen kam aber mit den 1820er Jahren die Industrialisierung richtig in Schwung. Baulich war die einschneidendste Veränderung in diesen Jahren der Abriss des Katharinenhospitals auf dem heutigen Marktplatz ab 1811.
Vor einem Jahr hat das Stadtarchiv Esslingen ein Freundschaftsalbum aus diesen Jahren erworben. Es besteht aus einer 54 Blatt umfassenden Loseblattsammlung von der Größe 8 x 12,5 cm. Diese befinden sich in einem grünen Umschlag, der zum Schutz in einem zweiteiligen Schuber mit der Aufschrift „Denkmal der Freundschaft“ untergebracht ist.
Freundschaftsalben oder Stammbücher haben eine lange Tradition. Die ersten entstehen im 16. Jahrhundert als Sammlungen von Schriftbelegen der Reformatoren. Vor allem bei Studenten sind Freundschaftsalben bis ins 19. Jahrhundert beliebt, in denen sie sich gegenseitig durch Einträge ihre Freundschaft und Treue versichern. Die Einträge bestehen aus – oft selbst verfassten – einem Gedicht oder Lebensmotto sowie einem Gruß. Sie werden datiert und unterschrieben und oft wird noch die Art der Beziehung vermerkt. Das lebt bis heute noch in Poesiealben fort, und so ist das auch hier. Die meisten Widmungen an Louise Helene Bonz stammen von Freundinnen und Freunden aus Esslingen und anderen Städten, wie zum Beispiel Rike Finckh aus Wildbad, Louise Beger aus Schwaigern, Carl Stoch aus Esslingen. Aber auch Verwandte haben sich eingetragen: die Großmutter Sophia Helene Godelmann, der Bruder Ernst Bonz, der Onkel Pfarrer Godelmann aus Böbingen. Man erkennt heute daraus das Netz der Beziehungen der jungen Dame.
Louise Helene Bonz gehörte zur angesehenen Esslinger Familie Bonz. Wie die Familien Salzmann, Williardts oder Steudel bekleideten die Bonzens hohe städtische oder württembergische Ämter oder waren Akademiker, wie der Vater von Louise Helene, der Esslinger Ratsapotheker und Chemiker Dr. Paul Johann Bonz. 1789 wurde sie von dessen zweiten Frau Karoline, der Tochter des Archidiakons (zweiten Pfarrers) Christian Friedrich Godelmann, geboren. Sie hatte drei Geschwister: Christine Pauline Friederike aus erster Ehe des Vaters, Eberhardine Karoline und Paul Ernst.
Louise Helene heiratete 1811 Christian Samson von Steudel, Hof-Domänenrat, Ober-Pupillenrat (Vormund) und Vize-Direktor des Strafanstaltenkollegiums in Stuttgart. Er war eines von zehn Kindern des Esslinger Registrators, Stadtkassierers, Bauverwalters, Senators und Obersteuereintreibers Johann Samson Steudel. Das Ehepaar Christian Samson und Louise Helene von Steudel bekam zwei Kinder: Julius und Pauline.
Die Laufzeit des Stammbuches ist 1806 bis 1810, liegt also vor ihrer Ehe. Der letzte Eintrag dürfte aus dem Jahr 1813 stammen: Louise Helenes Freund Karl Reinhard widmet ihn ihr „kurz vor dem Ausmarsch ins Feld“. Damit waren die deutschen Befreiungskriege gegen Napoleon im Anschluss an den katastrophalen Ausgang von dessen Russlandfeldzug 1812 gemeint.
April 2020 - Karte des Landkreises Esslingen, 1943
Karte des Landkreises Esslingen
Papier, 38 x 42cm
1943
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 005910)

Die unbenutzte Karte zeigt den Landkreis Esslingen in den Grenzen der Kreisreform von 1938. Allerdings schließt er in dieser Neuauflage von 1943 noch die 1942 nach Stuttgart eingemeindeten Ortschaften Plieningen und Birkach ein. Oberhalb des Kartenbildes finden sich zwei Stempel. Der linke runde Parteistempel weist in der Umschrift auf den „Marinesturm 3/18“ der „SA der N.S.D.A.P.“ in Esslingen hin. In der rechten Hälfte befindet sich ein Stempel „Deutscher Volkssturm/Batl. Hindenburg/3. Komp.“ Kompanieführer Emil Herdter hatte sie im Frühjahr 1945 an die Angehörigen seiner Einheit ausgegeben. Bataillonskommandeur war der Industrielle Eugen Wagner. Gerade Angehörige dieser Volkssturmeinheit spielten durch ihr besonnenes Handeln in den letzten Kriegstagen und bei der Übergabe der Stadt an die Amerikaner am 21./22. April 1945 eine wichtige Rolle.
Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. bzw. 9. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Doch nachdem die alliierten Truppen im Oktober 1944 in Ost und West erstmals die Reichsgrenze überschritten hatten, war je nach Verlauf der Kampfhandlungen der Krieg für die Bevölkerung nach und nach zu Ende gegangen. Dabei unterschieden sich die Erfahrungen der Menschen ganz erheblich, je nachdem ob sie im Osten oder Westen des Reiches lebten und wie die Kämpfe und Besatzung verliefen. Erstaunlich ist allerdings, dass die Strukturen des NS-Staates in der Regel bis kurz vor Ende der Kämpfe weitgehend reibungslos funktionierten. Das bedeutet aber auch, dass auch Terror und Morden vielerorts ebenfalls erst unmittelbar vor der Besetzung endeten.
Als „letztes Aufgebot“ zur Verteidigung gegen die anrückenden Gegner hatten die Machthaber im Herbst 1944 auf der Grundlage eines Führerlasses den „Deutschen Volkssturm“ aufgerufen. Dieser umfasste „alle waffenfähigen Männer zwischen 16 und 60 Jahren“. Allerdings war der militärische Wert dieser Einheiten angesichts ihrer mangelhaften Ausrüstung und Ausbildung nur gering und oft fanden ihre Angehörigen in aussichtslosen Kampfhandlungen einen sinnlosen Tod.
Im Herbst 1944 wurde auch in Württemberg der „Volkssturm“ aufgerufen. Im Kreis Esslingen gab es insgesamt 21 Volkssturmbataillone, davon mehrere in Esslingen selbst. Vermutlich gab es in jedem „Ortsgruppenbezirk“ eine. Die Volkssturmmänner sollten gemeinsam mit der Wehrmacht kämpfen, waren aber zunächst beim Bau von Verteidigungsstellungen und insgesamt 14 Panzersperren im Stadtgebiet eingesetzt. Jüngere Volkssturmmänner aus Esslingen kamen auch außerhalb der Stadt im Westen zwischen Schwarzwald und Stuttgart zum Einsatz.
Wie fast überall so war auch in Esslingen die NSDAP bis wenige Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner bestrebt, dass der Volkssturm seine ihm zugedachte Aufgabe erfüllte. In der Nacht zum 22. April 1945 bezog er daher auf Weisung der Kreisleitung seine Stellungen gegen die anrückenden feindlichen Truppen und suchte teilweise sogar Feindberührung. Beim anschließenden Rückzug gerieten die meisten Volkssturmmänner dann in Kriegsgefangenschaft. Um 2 Uhr morgens des 22. April 1945 ordnete Kreisleiter Wahler die Auflösung des Volkssturmes an. Allerdings hatten sich die meisten Einheiten schon zuvor aufgelöst.
Eugen Wagner vom „Hindenburg-Bataillon“ versuchte nach zeitgenössischen Berichten die Anordnungen der Kreisleitung zu umgehen und den Einfluss der Partei möglichst gering zu halten. Das Bataillon verfügte demnach über keine Waffen, errichtete keine Panzersperren und übte sich nicht in der Verteidigung. Bei seiner letzten Zusammenkunft am Abend des 21. April habe Wagner seine Leute ermahnt, dass man angesichts der sich auflösenden Ordnung zusammenhalten müsse und es wichtig sei, die Zwangsarbeiterlager ordnungsgemäß zu übergeben, da er Ausschreitungen der Befreiten befürchtete. Eine Verteidigung der Stadt hat er demnach bereits zuvor, ebenso wie die Zerstörung wichtiger Einrichtungen und Industrieanlagen abgelehnt. Damit ging er ein nicht unerhebliches Risiko ein, noch in letzter Minute mit Parteistellen in für ihn möglicherweise lebensgefährliche Konflikte zu geraten
März 2020 - Fotoalbum des Esslinger Turn- und Sportvereins von 1845
Fotoalbum des Esslinger Turn- und Sportvereins von 1845
Pappe, Fotografien
1935
(Pivatbesitz)

„Zum 90jährigen Bestehen des Esslinger Turn- und Sportvereins v. 1845 zur Pflege der Tradition und der Geschichte des Vereins gewidmet von W. Mayer Juni 1935.“ So lautet die handschriftliche Widmung für dieses opulente und repräsentative großformatige Album. 46 cm hoch und 38 cm breit, mit 20 dicken und mit Goldschnitt versehenen Papp-Blättern und 353 eingeklebten Fotografien und Drucken. Schon auf dem Einband sieht man, wo der „Esslinger Turn- und Sportverein von 1845“ im Jahr 1935 steht: Zwischen den Idealen des mit demokratischen Ansprüchen entstandenen Deutschen Turnens und der Deutschen Turnerschaft (DT). Sie hat sich im April 1933 als einer der ersten Verbände nationalsozialistisch neu aufgestellt und wollte bis zum 15. Deutschen Turnfest im Juli 1933 „judenfrei“ sein. 1936 löst sie sich selbst auf.
Vor bald 175 Jahren am 30. September 1845 als „Männerturnverein in Eßlingen“ gegründet, ist die Sportvereinigung 1845 Esslingen einer der ältesten Turnvereine in Württemberg. Der damals 19jährige Jurastudent Theodor Georgii hat die moderne und demokratische Idee von der Universität Tübingen mitgebracht. Seine Mitstreiter sind Männer des Bürgerturms, allen voran der Demokrat und Komponist Karl Pfaff und der Fabrikant Carl Deffner. Anfangs finden die Turnübungen auf dem Vorhof des Lehrerseminars, dem heutigen Blarerplatz, statt. Ab 1847 wird auf der Maille geturnt und im Winter im Alten Rathauses.
Beim 1. Schwäbischen Turntag wird am 1. Mai 1848 in Esslingen der Schwäbische Turnerbund gegründet, zu dessen erstem Vorsitzenden man Theodor Georgii wählt. Damals gehören auch militärische Übungen zum turnerischen Alltag. Die Turner schließen sich 1864 sogar mit dem hiesigen Wehrverein zusammen, da beide ihren Beitrag zu einem einigen Deutschland leisten wollen, die einen mit eher nationalen, die anderen mit eher demokratischen Intentionen.
Im Juli 1895 wird der XI. Deutsche Turntag in Esslingen abgehalten. Bei dieser Gelegenheit feiert man das 50jährige Bestehen und weiht das Denkmal für den 1892 verstorbenen Theodor Georgii auf der Maille ein. 1898 gründet sich eine Damen-Abteilung. Und 1902 errichtet der Vereine eine eigene Turnhalle in der Blumenstraße 42.
1920 schließt man sich mit einem Fußballverein zum „Eßlinger Turn- und Sportverein von 1845“ zusammen. Das ist gewagt, denn Turnen ist damals national und deutsch, der Fußballsport aber britisch und international. Prompt werden die Esslinger Turner von der Deutschen Turnerschaft gezwungen, sich 1924 wieder von ihrer Fußballabteilung zu trennen. Die Trennung dauert 40 Jahre: 1965 sind solche weltanschaulichen Probleme überwunden und man fusioniert erneut zu den „Turn- und Sportfreunden Esslingen von 1845“.
1935 hat man in Esslingen noch groß das 90jährige Jubiläum des ETSV gefeiert, zu dem auch dieses Album angelegt wird. Insgesamt sind für die Turner die Zeiten aber eher schwierig. Die für die Jugendlichen obligatorische Hitlerjugend fordert deren ganze Freizeit, und auch die Erwachsenen sind intensiv in NS-Parteiaktivitäten eingebunden. Zusätzlich verweigert die Stadtgemeinde im Mai 1939 die Verlängerung der Pacht für die Sirnauer Wiesen und das dort erstellte Jahn-Haus, womit der Verein buchstäblich im Regen steht. Im zweiten Weltkrieg wird 1944 auch noch die vereinseigene Turnhalle beschlagnahmt.
Im April 1945 löst die alliierte Militärregierung nach der Besetzung der Stadt alle Vereine auf, auch den ETSV. Erst mit einem Jahr Verspätung kann man am 7. September 1946 die 100-Jahrfeier feiern. Bilder davon werden als letzte in das Album eingeklebt.
Die Vereinsturnhalle nutzen amerikanische Besatzungssoldaten und ehemalige Zwangsarbeiter. Erst ab Oktober 1947 steht sie dem ETSV wieder ganz zur Verfügung. 1949 wird die neue Sportanlage mit Unterkunfts- und Bootshaus auf den Sirnauer Wiesen eingeweiht. Diese fällt bereits 1963 dem Ausbau des Neckars zur Schifffahrtsstraße zum Opfer. 1968 findet sich mit dem neu errichteten Eberhard-Bauer-Stadion eine glückliche Lösung, dem vier Jahre später 1972 die Großsporthalle folgt.
Februar 2020 - Reisekiste von Guiseppe Celani
Transportkiste
Holz, Textil, Blech
Mitte 20. Jahrhundert
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006801)

Die Transportkiste aus Holz mit Klappdeckel wirkt auf den ersten Blick völlig unscheinbar. Sie ist stark abgenutzt, das Segeltuch, das die Holzbretter umhüllt, ist eingerissen und die schwarzen Blechbeschläge sind beschädigt oder verrostet. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Kiste beim Ausräumen eines Hauses in der Rosenstraße in Esslingen-Mettingen im Sperrmüll landete. Beim genaueren Hinsehen fallen jedoch mehrere Aufkleber auf, die auf der Kiste kleben. Ein großes Etikett auf dem Deckel verrät Namen und Anschrift des mutmaßlichen Besitzers: „Signore Giuseppe Celani, Esslingen a.N. Mettingen, Schenkenbergstraße 71“. Laut einem weiteren Aufkleber wurde die Kiste am 27. August 1962 von Rom über den Brenner und München nach Esslingen geschickt. Das machte den Vorbesitzer der Transportkiste stutzig und er übergab sie den Städtischen Museen.
Wer war Giuseppe Celani? Warum kam er nach Esslingen? Lebt er heute noch hier? Und was können wir sonst noch über ihn herausfinden? Ein erster Hinweis auf ihn fand sich im Stadtarchiv. Dort ist in der Einwohnermeldekartei von 1946 bis 1979 sein Geburtstag, Geburtsort und Familienstand vermerkt. Ebenso die beiden Söhne, Domenico und Maurizio. Letzterer wohnte demnach zumindest bis in die 1990er Jahre in Esslingen. Heute lebt er in einer Kreisgemeinde und erzählte uns die Geschichte seines Vaters.
Giuseppe Celani wurde am 28. Oktober 1924 in Rom geboren. Als junger Mann ging er nach Österreich und arbeitete in Dornbirn. Dort lernte er seine spätere Ehefrau Palmira Angelina kennen. 1945 heiratete das Paar, im selben Jahr kam Tochter Anna Maria in Rom zur Welt. Celani fand eine Anstellung im Vatikan, die seiner jungen Familie eine Wohnung mitsamt Versorgung und ein kleines Gehalt sicherte. 1950 wurde der Sohn Domenico geboren, vier Jahre später erblickte der zweite Sohn Maurizio das Licht der Welt. Wegen der besseren Verdienstmöglichkeiten verfolgte Giuseppe Celani die Ausschreibungen der Anwerbestellen für sogenannte Gastarbeiter, die ab 1955 den Arbeitskräftemangel in Deutschland ausgleichen sollten. Schließlich bewarb er sich als Maurer, erhielt die Zusage und ging wie rund 630.000 Italiener nach Deutschland. Im Herbst 1957 brach er auf – mit dem Vorsatz, seine Familie schnellstmöglich nachzuholen.
Seine Reise führte ihn zunächst von Rom nach Mailand. Von hier aus wurden die angeworbenen Arbeiter nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz vermittelt. Celani kam nach Esslingen-Mettingen, wo er zunächst mit anderen italienischen Arbeitern in einem Wohnheim, dann in der Schenkenbergstraße 71 lebte. Ab 1958 war Celani in einem Bauunternehmen beschäftigt. 1960 erhielt er eine Anstellung in der Cellophanwarenfabrik der Gebrüder Berner. Dorthin vermittelte er auch seine Tochter, die ihm noch im gleichen Jahr nach Deutschland folgte. Giuseppe Celani hielt über Briefwechsel den Kontakt zu seiner Familie in Italien, ungefähr alle sechs Monate war ein Telefonat in den Süden möglich.
1962 kam die restliche Familie nach Esslingen-Mettingen. Palmira Celani arbeitete zunächst ebenfalls in der Firma der Gebrüder Berner. Die beiden Söhne Domenico und Maurizio besuchten die Grundschule in Mettingen, ab 1963 die Burgschule in der Innenstadt. Dort waren sie die ersten beiden Schüler ausländischer Herkunft, wurden jedoch von ihren Klassenkameraden gut aufgenommen. Auch das Ehepaar Celani fand schnell Anschluss und baute sich einen großen Freundeskreis auf. 1963 zog die Familie aus Mettingen in die Landolinsgasse, ab 1966 wohnte sie am Rossmarkt. 1974 kehrten sie nach Mettingen zurück und bezogen ein Haus in der Rosenstraße – wo man 45 Jahre später die Transportkiste fand. Nach über 25 Jahren Mitarbeit in der Firma der Gebrüder Berner ging Celani 1988 in den Ruhestand und kehrte mit seiner Frau nach Italien zurück, wo das Paar seinen Lebensabend verbrachte. Palmira Celani starb 2002, ihr Mann zwei Jahre später. Anna Maria Celani lebte bis zu ihrem Tod in Deutschland, Domenico Celani kehrte vor einigen Jahren ebenfalls nach Italien zurück.
Januar 2020 - Eduard August Schliecker: Marktplatz in Esslingen
Eduard August Schliecker:
Marktplatz in Esslingen
Öl auf Leinwand
1860er Jahre
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006853)

Bis heute gehören das Alte Rathaus in Esslingen und der Platz davor zu den attraktivsten Situationen in der Esslinger Altstadt. Als der Hamburger August Schliecker (1833-1911) in seinen dreißiger Jahren nach einem Kunststudium an den Akademien in Düsseldorf und München die Szenerie malte, war er mit seinem liebevollen Blick auf eine gute alte vorindustrielle Idylle ganz auf der Höhe des damaligen spätromantischen Lebensgefühls. Das 2019 vom Geschichts- und Altertumsverein aus österreichischem Privatbesitz erworbene Bild stellt insofern eine echte Neuigkeit dar, als es seit seiner Entstehung vor 150 Jahren nie öffentlich bemerkt oder beschrieben worden ist und in allen einschlägigen Verzeichnissen fehlt.
Die Blickrichtung, die Schliecker für den ehemaligen Marktplatz wählte, ist die bis heute beliebteste, nämlich der Blick auf das Alte Rathaus aus der Perspektive des Neuen Rathauses. So sieht man das hohe und freistehende Gebäude mit der Renaissancefassade von Heinrich Schickhardt aus dem späten 16. Jahrhundert als mächtigen und platzbeherrschenden Bau, dem sich die Häuserzeilen rechts und links deutlich unterordnen. Es ist eine morgendliche Stimmung, in der die Sonne dennoch bereits recht hoch von Osten her quer über den Platz auf die Häuser auf der Westseite scheint und sie regelrecht aufleuchten lässt. Die Rathausfassade bleibt dahingegen im graubraunen Dunkeln. Auch wenn ihre Farbe nicht klar erkennbar ist, sieht man dennoch, dass das Fachwerk der oberen Stockwerke bereits verputzt ist. Der Reichsadler und die astronomische Uhr darunter, die bis ins 19. Jahrhundert hinein die einzige öffentliche Esslinger Uhr gewesen ist, künden von einstigem reichsstädtischen Reichtum und Größe.
Das zierliche Giebeltürmchen ist nur mit den Stundenglocken ausgestattet und noch ohne das Glockenspiel, das erst ab 1926 dort eingerichtet worden ist und heute fünfmal am Tag erklingt.
Die lebendige Aktualität zeigt sich vor dem damaligen Marktbrunnen, einem Vier-Röhren-Brunnen mit abgetrepptem Brunnenstock, der von einer Amphore bekrönt ist. Hier spielt sich ein fast südländisch anmutendes Marktgeschehen ab, das von Schliecker durch Farbigkeit, intensive Sonneneinstrahlung und starken Kontrast ins rechte Licht gerückt wird. Diese fast biedermeierlich anmutende Situation hat er ganz minutiös und liebevoll mit feinstem Strich gemalt Sie lässt nichts davon ahnen, dass Esslingen eine boomende und rasch wachsende Industriestadt ist, in der die Schornsteine rauchen und nicht einmal einen Kilometer entfernt in der Maschinenfabrik Esslingen gleichzeitig im großen Stil Lokomotiven für Europa und darüber hinaus gebaut werden.
Farbigkeit und Lichtführung deuten an, dass es Schliecker nicht um die Dokumentation des Esslinger Baubestandes geht. Er leistet sich durchaus Freiheiten, die den Kennern des Platzes schnell auffallen. So sind etwa die Giebel der Apothekengebäude links frei barockisiert. Diese wirken dadurch fast wie hanseatische Kaufmannshäuser. Dahinter, Richtung Hafenmarkt, verliert sich die Bebauung vollständig in einer äußerst dunklen Unklarheit.
August Schliecker, der ab 1863 seine Heimatstadt Hamburg nur zu Studienreisen unter anderem nach Süddeutschland und die Schweiz verlassen hat, war in seinem Schaffen vor allem auf stimmungsvolle Nacht- und Winterbilder spezialisiert. Seine manchmal ein wenig an Carl Spitzwegs Idyllen erinnernden Szenerien beziehen gerne auch Architekturmotive mit ein.
Schlieckers eigentliches Thema des Gemäldes ist nicht die naturgetreue Abbildung der Gebäude des Esslinger Rathausplatzes in den 1860er Jahren, sondern das idyllische Markttreiben in dieser damals schon als altertümlich empfundenen Kulisse. Ihn interessieren die das Gemüse oder Obst beurteilenden, kritischen, feilschenden, fragenden Frauen, der Fuhrmannswagen und der ältere, schwarz gekleidete, auf den Betrachter zugehende Herr mit Zylinderhut. Diese provinzstädtische Szenerie ist umgeben von ganz vielen Details, die dazu verleiten, dass man mit den Augen über das Bild spazieren und immer Neues entdecken kann: etwa die weißen Tauben über dem Platz und ihren Taubenschlag rechts oben auf dem Dach. Oder auch den Blumenschmuck an den Fenstern rechts. Es ist ein verklärter Blick aus dem neuen Industriezeitalter auf eine gute alte Zeit.
Dezember 2019 - Weihnachtsgesang von Wilhelm Nagel
Walther Schulte v. Brühl (Text), Wilhelm Nagel (Musik):
Weihnachtsgesang für Frauen- oder Schülerchor, Op. 5.2
Verlag Sulze & Galler, Stuttgart
1899
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 005540)

Auf dem Titelblatt des Notenheftes betritt im dichten Schneegestöber der mit Geschenken beladene und einen geschmückten Weihnachtsbaum tragende Weihnachtsmann die Szene. Im Innern befinden sich die Einzelstimmen und eine Partitur des dreistimmigen Chorstückes. Sein Text befasst sich mit der besonderen Stimmung der Weihnachtszeit: es geht darin um den weihevollen Klang der Glocke in der Nacht, die den winterlichen Frieden auf Erden begleitet und die Geburt des Heilands und die damit verbundene Freude verkündet. Handelt es sich womöglich um die Antwort seiner Verfasser auf das weltbekannte „Stille Nacht, heilige Nacht“?
Komponiert und verfasst haben es der Esslinger Komponist Wilhelm Nagel (1871-1955) und der Journalist und Dichter Walther Schulte vom Brühl. Hinter diesem Pseudonym verbarg sich Walther Schulte-Heuthaus (1858-1921). Er war Hauslehrer in Zürich, beschäftigte sich mit kunsthistorischen und literarischen Studien und lebte von 1878 bis 1884 als Maler in Weimar. Danach arbeitete er als Redakteur in Bad Sulza, München und Zürich. Von 1886 bis 1889 war er Redakteur einer Unterhaltungsbeilage des Frankfurter Journals. Bis 1914 lebte Schulte vom Brühl in Wiesbaden, wo er ebenfalls als Journalist tätig war. Später wirkte er bis zu seinem Tod als freier Schriftsteller in Neckarsteinach. Sein Werk umfasst Romane, Erzählungen, Kinderbücher, Gedichte, Versepen und Theaterstücke. Wilhelm Nagel studierte zunächst im Esslinger Lehrerseminar bei dem Komponisten und Musiker Christian Fink (1831-1911), der von 1872 bis zu seinem Tod im heutigen Stadtmuseum im Gelben Haus lebte, wie eine Gedenkplakette an der Außenseite des Gebäudedteils Hafenmarkt 7 verrät. Seit 1894 war Wilhelm Nagel Seminarhilfsmusiklehrer und studierte parallel dazu am Konservatorium in Stuttgart, später auch in Berlin. Von 1905 bis 1945 war er Seminarmusiklehrer im Esslinger Lehrerseminar. Seit 1915 war er gleichzeitig Organist und Chordirektor an der Stadtkirche St. Dionys. Nagel war einer der führenden württembergischen Chorleiter, Bundes-Chormeister des Schwäbischen Sängerbundes und Komponist zahlreicher Lieder, weltlicher und geistlicher Chorwerke. Das ausgestellte Exemplar wurde im November 1899 an den Stiftsorganisten Heinrich Lang (1858-1911) gesandt, wie eine handschriftliche Widmung des Komponisten verrät. Lang hatte ebenfalls im Esslinger Lehrerseminar bei Christian Fink gelernt. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer studierte er am Stuttgarter Konservatorium. Von 1894 an war er Stiftsmusikdirektor an der Stuttgarter Stiftskirche, 1898 erhielt er einen Lehrauftrag am Konservatorium, wo er 1900 zum Professor ernannt wurde. Die Bekanntschaft entstand vermutlich durch die gemeinsame Ausbildung am Lehrerseminar und Konservatorium. Das Chorwerk ist „der Seminarübungsschule in Esslingen“ gewidmet. Das Lehrerseminar wurde am 20. Mai 1811 an der Stelle des heutigen Behördenzentrums als das erste „Schullehrerseminar“ in Württemberg gegründet. Damit war die Ausbildung der Lehrer im 1806 gegründeten Königreich auf ganz neue Grundlagen gestellt. Hier erhielten die Seminaristen ihre theoretische Ausbildung in 40 bis 50 Wochenstunden in den zu unterrichtenden Fächern, die sich von Religion über Deutsch, Mathematik, die „Realien“ (Naturkunde, Erdkunde, Geschichte), Pädagogik, Methodik, Zeichnen bis hin zu Katechetik und Musik erstreckten. Praktische Erfahrungen sammelten sie in der im Erdgeschoss des Seminars eingerichteten „Musterschule“, die 1868 zur „Seminarübungsschule“ umgewandelt wurde. Hier erhielten die Seminaristen jetzt nicht mehr nur Einblick in die Arbeit eines Lehrers, sondern unternahmen in der dreiklassigen Schule ihre ersten eigenen Unterrichtsversuche. Den Esslinger Bürgern war diese Einrichtung allerdings zunächst nicht ganz geheuer. Doch führte die Aussicht auf Unterricht durch besonders geeignete Pädagogen und die hochmotivierten Seminaristen nahm die Zahl der Anmeldungen so zu, dass sie bald eine Auswahl unter den sich Bewerbenden treffen konnte.
November 2019 - Tischfernrohr und Mikroskop
Tischfernrohr, Mikroskop
Carl Oechsle, Esslingen
Messing, Glas, Holz
Anfang bis Mitte 19. Jahrhundert
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006025; STME 006841)

Das Tischfernrohr entstand um 1820. Sein Messingtubus befindet sich am oberen Ende eines dreibeinigen Stativs, das sich in alle Richtungen drehen und neigen lässt. Auf ihm findet sich die Signatur „Oechsle Esslingen". Mit Hilfe einer Rändelschraube am Teleskopauszug lassen sich Gegenstände fokussieren. Im Auszug ist das Fernrohrokular mit den drei Linsen eingeschoben. Es ist zusammenlegbar und kann in einer passenden Holzkiste aufbewahrt werden.
Beim Mikroskop handelt es sich um das einzige uns bekannte, gut erhaltene Exemplar aus der Werkstatt von Carl Oechsle. Es besteht ebenfalls aus Messing. Auf seinen aufklappbaren, dreiteiligen Fuß ist eine runde Säule geschraubt, die den kreuzförmigen Tisch des Mikroskops trägt. An ihr befinden sich eine Bohrung zur Aufnahme des drehbaren Beleuchtungsspiegels und der dreieckige Tubusträger mit der Rack- und Pinion Verstelleinrichtung. Der Tubus des Mikroskops ist mit der Zahnstange verschraubt; mit einer Rändelschraube wird das Objekt fokussiert.
Der Hersteller der beiden optischen Preziosen ist der 1782 in Esslingen geborene Carl Oechsle. Über seine Lehr- und Gesellenjahre ist nahezu nichts bekannt, eventuell ging er bei dem Stuttgarter Hofmechaniker Jakob Heinrich Tiedemann in die Lehre. 1809 eröffnete Oechsle eine Werkstatt in Esslingen. Das Vermögen seiner Ehefrau Katharina Barbara Schweizer investierte Oechsle, der selbst über kein über Eigenkapital verfügte, in seine Werkstatt. Das Paar hatte 1810 geheiratet, noch im gleichen Jahr erhielt er das Bürgerrecht der Stadt. Dass das Vermögen der Braut für den wirtschaftlichen Erfolg des Mannes entscheidend war, ist ein immer wieder zu beobachtender Umstand in der Industriegeschichte Esslingens.
Oechsle erhielt 1812 den Titel Hofopticus und Mechanicus, nachdem der württembergische König Friedrich ein Fernrohr aus seiner Werkstatt erstanden hatte. Das Leistungsportfolio seiner Werkstatt umfasste optische und physikalische Instrumente, wie Fernrohre und Mikroskope. Optisches Glas, das Oechsle aus dem Ausland importierte, war nur schwer zu beziehen und sehr teuer. Deshalb musste er zum Ankauf der Gläser mehrere Darlehen aufnehmen. Einer seiner Geldgeber war der Stuttgarter Verleger und Unternehmer Johann Friedrich Cotta, mit dem Oechsle intensiv in Briefkontakt stand.
Auf der Kunst- und Gewerbeausstellung in Stuttgart 1823 erhielt Carl Oechsle für eines seiner Fernrohre den königlichen Preis. Als Zeichen der Anerkennung und als Ausdruck der „Freude, einen solchen Künstler unter der Bürgerschaft Esslingens zu besitzen" zeichnete ihn der Esslinger Stadtrat mit einer Prämie von 50 Gulden aus.Später nahmen Oechsle und sein Sohn Gottlob, der in der Werkstatt mitarbeitete, regelmäßig an Ausstellungen teil. 1830 erweiterten sie das Sortiment um silberne und goldene Uhren mit einem neuen Aufziehmechanismus. Dieser Geschäftszweig wurde jedoch nicht nennenswert weiterentwickelt. Oechsles Frau starb 1831 nach langer Krankheit. Durch die hohen Arztkosten war Oechsle hoch verschuldet. Einen Teil seiner Schulden übernahm das Waisengericht, einerseits aus Fürsorge für die Kinder, andererseits um die Arbeit des Künstlers weiter zu unterstützen. 1833 heiratete Carl Oechsle die Bäckerstochter Rosina Louisa Kirn. Sie brachte ebenfalls ein größeres Vermögen in die Ehe ein, das Oechsle erneut in seine Werkstatt investieren konnte.
Auch danach nahm er an einer Industrieausstellung teil, ebenso an Ausstellungen des Gewerbevereins Esslingen. Carl Oechsle arbeitete wohl bis zuletzt in seiner Werkstatt. Er starb im Oktober 1855. Aus dem nach seinem Tod erstellten Vermögensverzeichnis geht hervor, dass er über ein Gesamtvermögen von 3798 Gulden und 37 Kreuzer verfügte. Es bestand aber vor allem aus Werkzeugen, Rohmaterial sowie fertigen und halbfertigen Instrumenten. Sein Sohn Gottlob, der selbst hoch verschuldet war, schlug das Erbe aus, es fand sich auch sonst keiner, der die Werkstatt übernehmen wollte. Daher verkaufte die Erbengemeinschaft sämtliche Instrumente, Werkzeuge und Materialien.
Oktober 2019 - Slany Desgin: Thermoskanne "Vivatherm"
Slany Design, Esslingen:
Thermoskanne „VIVATHERM“
für Firma Leifheit, Nassau/Lahn
Kunststoff, Glas
1980er Jahre
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006504)

Die Thermoskanne „VIVATHERM“ besteht aus einem silbrig glänzenden, bauchigen Kunststoffgehäuse und einem Glaseinsatz. Der konische Deckel ist kreisförmig abgetreppt und endet in einem Knauf. Er besitzt einen Ausgießmechanismus, der mit einem Druckhebel bedient wird. Die Kanne war u.a. auch in den Farben Weiß, Blau und Rot erhältlich. Hergestellt hat sie der Haushaltsgerätehersteller Leifheit aus Nassau an der Lahn. Den Entwurf erstellte der in Esslingen lebende Designer Professor Hans Erich Slany (1926-2013).
Slany wurde in Böhmisch-Wiesenthal (heute: Loučná pod Klínovcem) im tschechischen Erzgebirge geboren. Er besuchte seit 1941 die Staatsgewerbeschule in Eger (heute: Cheb), eine Ingenieurschule für Maschinenbau. Wegen seiner Einberufung zum Kriegsdienst 1944 konnte er dort aber die Ausbildung nicht abschliessen. Nach Kriegsende gelangte er über München und Nürnberg nach Ulm, wo er in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet. Schließlich kam er nach Esslingen und beendete hier 1948 sein Studium an der Maschinenbauschule.
Anschließend arbeitete Hans Erich Slany als Entwicklungsingenieur für Aluminium Ritter.Schon 1953 unterhielt er Kontakte zur Hochschule für Gestaltung in Ulm. Aufsehen erregte das von ihm für Ritter entwickelte Geschirrprogramm, das 1957 auf der Triennale in Mailand vorgestellt wurde. Seine nächste Station war 1954 die Styling-Abteilung von Daimler-Benz, wo er in der Karrosserieentwicklung tätig war und an der Konstruktion des legendären Flügeltürers 300 SL Roadster mitwirkte. Gleichzeitig arbeitete er weiterhin freiberuflich als Designer für die Firma Ritter.
Der große Erfolg des von ihm entworfenen Geschirrprogrammes führte schließlich dazu, dass Hans Erich Slany seit dem 1. März 1956 ein eigenes Designbüro in Esslingen betrieb, das eines der ersten in der Bundesrepublik war. Hier entstanden nicht nur Entwürfe für Industriemaschinen und Werkzeuge sondern vor allem Konsumgüter des täglichen Bedarfs und Haushaltsartikel. Viele dieser Produkte gelten noch heute als Designikonen ihrer jeweiligen Zeit und fehlten damals in kaum einem Haushalt, wie beispielsweise der Teppichkehrer „rotaro“ (seit 1960) oder der „Sicomatic“ Schnellkochtopf von 1974. Im Lauf seiner Berufstätigkeit arbeitete Hans Erich Slany für zahllose Firmen, u.a. Bosch, Weishaupt oder Leitz, und erhielt über 900 Auszeichnungen.
Nach und nach wuchs die Firma und es wurden Mitarbeiter eingestellt, deren Stamm durch freie Mitarbeiter ergänzt wurde. Der Erfolg seines Gestaltungsbüros führte zu steigender Kundennachfrage und der Umwandlung des Unternehmens in eine GmbH 1986. Aus ihr schied Hans Erich Slany 1997 aus. Das von ihm gegründete Designbüro existiert bis heute, mittlerweile unter dem Namen TEAMS Design. 1965 unterstützte Hans Erich Slany die Gründung der op-art-Galerie in Esslingen. Auch gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des „Verbands Deutscher Industrie Designer e. V.“ (VDID). Von 1983 an war er Lehrbeauftragter (seit 1985 Honorarprofessor) an der Hochschule der Künste, Berlin; seit 1986 auch Begründer und Leiter des Studiengangs Investitionsgüterdesign an der Akademie der bildenden Künste in Stuttgart.
Seine Ausbildung als Designer erhielt Hans Erich Slany bei Heinrich Löffelhardt. Sein Gestaltungsziel war die Verbindung von Technik und Funktionalität mit einem „ansprechenden Äußeren“. Gute Gestaltung war für ihn ein wesentliches Qualitätsmerkmal, das er in allen Bereichen der Konsum- und Investitionsgüterindustrie anwand, da er der Ansicht war, dass sich optisch ansprechende Produkte in allen Bereichen besser verkaufen ließen. Eine Meinung, die bis in die 1980er Jahre v.a. beim Industriedesign, noch wenig verbreitet war. Seine Grundsätze für gut designte Produkte waren darüber hinaus „Zeitlosigkeit“, „Funktion“, Einpassung in das Corporate Design des Herstellers, Ergonomie und gute Bedienbarkeit, „rationelle und wirtschaftliche Fertigung“ und die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Menschen, die sie verwenden sollten.
September 2019 - Metallwarenfabrik Quist: Stahlhelm Modell 35
Metallwarenfabrik F. W. Quist:Stahlhelm Modell 35Molybdänstahl, Leder1930er Jahre (Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006588)

Am 1. September 1939 - vor genau 80 Jahren - begann mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Er kostete bis zu seinem Ende am 8. Mai 1945 (in Europa) bzw. 2. September 1945 (in Asien) knapp 65 Millionen Menschenleben. Von ihnen wurden rund 13 Millionen Menschen zu Opfern deutscher Kriegsverbrechen.
Das wohl markanteste Ausrüstungsstück des deutschen Wehrmachtsoldaten war der Stahlhelm. Dieser wurde während des Ersten Weltkrieges angesichts der hohen Zahl an Kopfverletzungen durch Artilleriegeschosse unter der Bezeichnung M 16 eingeführt und erstmals 1916 bei der Schlacht um Verdun getragen. Obwohl man bei Kriegsende zahlreiche Helme an die Alliierten abgeben musste, reichten die vorhandenen Bestände noch für die Ausrüstung der neu geschaffenen Reichswehr mit 100.000 Soldaten aus.
Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurde das Erscheinungsbild der Helme vereinheitlicht. Hatten sie bis dahin noch Kokarden in den jeweiligen traditionellen Landesfarben getragen, erhielten sie nun ein Wappenschild in den Farben Schwarz-Weiß-Rot. 1934 kam der Reichsadler als Hoheitszeichen hinzu. Dies zeigt die nun deutlich zentralistische Ausrichtung der Armee bei gleichzeitiger Übernahme der Symbolik der Nationalsozialisten.
Zu Beginn der 1930er Jahre erfolgten einige Modifikationen an der Innenausstattung, aber auch am äußeren Erscheinungsbild des Helmes. Sie lehnten sich an der bisherigen Erscheinung des M 16 an, auch war an der Entwicklung dessen Erfinder Professor Friedrich Schwerd (1872-1953) beteiligt. Dieser neue Helm wurde im Juni 1935 unter der Bezeichnung „Stahlhelm 35“ eingeführt. Später erhielt er als M 40 und M 42 nur noch geringe Veränderungen.Nachdem man in Deutschland im März 1935 die Wehrpflicht wieder eingeführt hatte, bestand ein hoher Bedarf an diesen Ausrüstungsgegenständen. Er wurde nicht nur bei der Wehrmacht eingesetzt, sondern auch an die SS, die Polizei und an ausländische Truppen geliefert.
Der M 35 ist wie kein anderes Ausrüstungsstück zum Symbol des nationalsozialistischen Militarismus geworden. Er stellte die Wehrmacht in die Tradtion der kaiserlichen Armee und verkörperte als Sinnbild das deutsche Soldatentum und dessen von den Nationalsozialisten postulierten Heldenmut und Siegeswillen. In den von der Wehrmacht besetzten Ländern stellte er allerdings das negative Symbol deutscher Schreckensherrschaft dar. Daher wurde er auch nicht mehr bei der neu gegründeten Bundeswehr verwendet, sondern war lediglich noch bei der Bereitschaftspolizei und im Katastrophenschutz im Einsatz. Der auf der Glocke liegende Helm mit Blume ist dagegen ein seit der Weimarer Zeit bekanntes Zeichen der Friedensbewegung. Erst die modernen Gefechtshelme der Bundeswehr aus Kunststoff griffen die Formgebung des deutschen Stahlhelms wieder auf.
Der gezeigte Helm wurde bei der Esslinger Metallwarenfabrik F. W. Quist hergestellt, deren Kerngeschäft die Produktion versilberter Metallwaren für den festlich gedeckten Tisch war. Sie hatte schon während des Ersten Weltkrieges Stahlhelme gefertigt. Bereits 1935 begann die Firma mit der Wiederaufnahme der Rüstungsproduktion; Quist reichte in diesem Jahr auch ein Patent für ein neues Herstellungsverfahren ein, 1938 folgten Gebrauchsmuster für Feuerwehr- und Luftschutzhelme. Auch bei der Entwicklung des M 45 bei Kriegsende, der aber nicht mehr zum Einsatz kam, war Quist vermutlich beteiligt. Während des Zweiten Weltkrieges wurden neben Stahlhelmen auch andere Rüstungsgüter produziert, sodass die Rüstungsproduktion im Jahre 1942 97 Prozent der Fertigung umfasste. Auch nach 1945 stellte man noch Stahlhelme her, u.a. für die Bundeswehr. Die militärische Produktion endete vermutlich Ende der 1950er Jahre, Helme für die Feuerwehr wurden seit den 1960er Jahren nicht mehr hergestellt. Auch hier machte sich, ebenso wie im eigentlichen Kerngeschäft, Kunststoff als Konkurrenzmaterial bemerkbar.
August 2019 - Julie Textor: Alt - Eßlingen
Julie Textor:
Alt-Eßlingen
Öl auf Leinwand
1897
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006436)

Im Mittelalter hatte es genügt, wenn man eine Stadt darstellen wollte, dass man eine Ansammlung von Häusern und Türmen zeichnete. Das überzeugte die Zeitgenossen, dass dies kein Dorf, sondern eine echte Stadt war. Damit war man in der Neuzeit nicht mehr zufrieden.
Vor gut 400 Jahren gab es dann die ersten Abbildungen von Städten, die die gesamte Stadt in einem einzigen Bild so darstellten, dass sie zumindest wiedererkennbar war. Berühmt wurden etwas später die Kupferstiche von Matthäus Merian aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Er zeigte nicht nur sehr viele Städte von ihrer Schokoladenseite, sondern wurde auch hundertfünfzig Jahre lang fleißig kopiert. So produzierte man auch seinen Blick auf das wehrhaft ummauerte Esslingen durchs ganze 17. und 18. Jahrhundert immer von der Südseite über den Neckar mit der Burg im Hintergrund, die über allem thronte. Alle wichtigen Gebäude sollten zumindest erkennbar sein: jeder Turm und jede Kirche waren wichtig.
Erst mit der Wende zum 19. Jahrhundert kam Bewegung in den Bildermarkt. Nun wagte man neue Ansichten aus anderen Blickwinkeln, wie etwa in Esslingen die beliebte Aussicht von den Weinbergen der Neckarhalde auf die Stadt. Diese neue Perspektive hat mit Erfolg etwa Eberhard Emminger (1808-1885) detailreich und großformatig lithographiert. Vor allem mit seinen Nahansichten von einzelnen Gebäuden und Plätzen hat Johannes Braungart (1803-1849) das Innenleben der Stadt Esslingen ins Bild gesetzt.
Ein halbes Jahrhundert später hat Julie Textor (1848-1898) in ihrem großformatigen Ölgemälde „Alt-Eßlingen“ von 1897 eine vorher wie nachher sehr selten gestaltete Detailansicht der Esslinger Altstadt dargestellt. Mit ihr schaut man den Wehrneckarkanal aufwärts entlang der rechts liegenden Wehrneckarstraße auf den südlichsten Bogen der Inneren Brücke. Dahinter beherrschen die hohen und sommerlich grünen Bäume der Maille die Szenerie.
Wer die Situation östlich der Agnesbrücke oder an der Wehrneckarstraße in Richtung Rossmarkt kennt, weiß, dass die Krümmung der Straße beileibe nicht so stark ist, die Gärten fehlen und die Häuser anders aussehen. Textor nutzte für ihr Bild eine 1897 bereits vergangene Situation. Schon damals war die hier sehr schmal dargestellte Reihe der Gärten durch lauter Neubauten vollständig überbaut. Die Malerin hat an dieser Stelle – ihrem programmatischen Bildtitel „Alt-Eßlingen“ folgend – eine lange Reihe äußerst spitzgiebelige hohe Häuser gemalt. Das sind die Rückseiten der Häuser am Roßmarkt. Dieses historische Genre wirkt ganz naturalistisch, ist aber recht frei gestaltet und nur durch die Anbindung an die Innere Brücke überhaupt räumlich nachzuvollziehen. Die rückwärtsgewandte Phantasie war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weit verbreitet und wurde zur Erhöhung einer romantischen Stimmung verwendet. Die gebildete Julie Textor stellte sich so das mittelalterliche Esslingen vor und setzte es in derart überzeugender Weise um, dass genau dieses Gemälde wohl ihr berühmtestes ist.
Julie Textor, in Ellwangen als Kaufmannstochter geboren, studierte nach ersten Lektionen beim dortigen Zeichenlehrer August Benz 1885 bis 1889 in Stuttgart bei zwei Professoren der dortigen Kunstschule, Albert Kappis und Jakob Grünenwald, zwei ausgewiesenen Landschaftern. Danach erhielt sie bis 1894 weiteren Unterricht in München unter anderem bei den Kunstprofessoren August Fink und Bernhard Buttersack. In der kurzen Zeit bis zu ihrem frühen Tod 1898 malte sie, das geschätzte Stuttgarter Mitglied im Württembergischen Malerinnenverein, unter anderem diese äußerst dekorative Ansicht. Es sollte ihre einzige Darstellung von Esslingen bleiben.
Juli 2019 - Fotoalbum: "Album von Zwittau"
Eduard J. Topitsch, Mähr. Neustadt:
„Album von Zwittau"
mit 20 s/w-Fotografien
Anfang 20. Jahrhundert
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006665)

Das kleinformatige Fotoalbum mit Pappeinband und teilweise silbernem Prägedruck enthält 20 Fotografien aus Zwittau (heute: Svitavy, Tschechien) im Sudetenland aus der Zeit um 1900. Ursprünglich waren diese zu einem Leporello zusammengestellt, doch ist mittlerweile die Verklebung durchtrennt worden, es sind aber offensichtlich noch alle Fotografien enthalten. Die Abbildungen zeigen neben wenigen Stadtansichten und dem Marktplatz vor allem zentrale und bedeutende Gebäude in der Stadt. Diese reichen von privaten Wohnhäusern, öffentlichen Einrichtungen bis hin zu Industriebetrieben. Aufgenommen und gebunden wurden sie von dem Fotografen und Buchbinder Eduard J. Topitsch aus Mährisch Neustadt, das immerhin rund 60km von Zwittau entfernt ist.
Das Album stammt aus dem Bestand des „Heimatarchivs Zwittau". Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Esslingen, die infolge der Vertreibung von insgesamt rund 12 Millionen Deutschen aus Ost-Mitteleuropa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs seit 1946 nach Esslingen gelangt waren, sammelten hier Erinnerungsstücke an die alte Heimat; bis 2008 hatten sie im Pliensauturm eine Heimatstube. Die dort aufgebaute große Weihnachtskrippe kam bereits 2007 in die Sammlung des Stadtmuseums im Gelben Haus; 2018 folgten die restlichen Objekte. Ein Grund für diese Übergabe war, dass die aktiven Vereinsmitglieder inzwischen ein hohes Alter erreicht haben. Auch ist die jüngere Generation mittlerweile in Esslingen zuhause und das Interesse an der Herkunft der Eltern und Großeltern ist nicht mehr von so großer Bedeutung. Die Übergabe der Bestände des Heimatarchivs Zwittau an die Städtischen Museen dokumentiert daher auch, dass mittlerweile die einstmals Vertriebenen Esslingen ebenfalls als ihre Heimat sehen.
Dies war bei der Ankunft von vier sogenannten „Antifa"-Transporten (mit etwas besseren Rahmenbedingungen für Personen, die sich nach der Ansicht der Tschechen nach 1938 nichts hatten zuschulden kommen lassen) zwischen Juli und Oktober 1946 mit insgesamt 1104 Menschen in Esslingen nicht zu erwarten. Es ist eines der großen „Nachkriegswunder" der jungen Bundesrepublik, dass hier die Integration von bis 1950 mehr als 8 Millionen Vertriebenen, begünstigt durch das „Wirtschaftswunder" und die Regelungen des Lastenausgleichsgesetzes in einem langwierigen und für alle Beteiligten emotional belastenden Prozess gelang. Dieser verlief – auch wenn man es lange anders darstellte – nämlich alles andere als reibungslos und unkompliziert.
Dies kommt auch durch die Wahl des sudetendeutschen Priesters und Vertriebenenpolitikers Franz Ott zum ersten direkt gewählten Bundestagsabgeordneten in Esslingen im Jahr 1949 zum Ausdruck, die seinerzeit bundesweit für Aufsehen sorgte. Er erreichte nicht zuletzt aufgrund der unbefriedigenden Situation der von den Behörden euphemistisch als „Neubürger" bezeichneten Vertriebenen die Mehrheit der Stimmen.
Bis zur Vertreibung der deutschen Bevölkerung 1946 war Zwittau die größte Stadt in der deutschen Sprachinsel Schönhengstgau in Mähren. Sie wurde um die Mitte des 13. Jahrhundert gegründet und war durch die Textilherstellung geprägt. 1910 hatte Zwittau 9.649 Einwohner. Nach 1918 gehörte die Stadt zur Tschechoslowakei. Im Oktober 1938 kam es infolge der „Münchner Konferenz" zur Eingliederung des Sudetenlandes in das „Deutsche Reich" . Im Mai 1945 wurde Zwittau durch die sowjetische Armee besetzt, im Juli 1945 wurde die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus Ost-Mitteleuropa auf der Potsdamer Konferenz beschlossen. Die planmäßige Ausweisung der Deutschen aus der Tschechoslowakei begann im Januar 1946, der erste Transport aus Zwittau und Umgebung verließ die Stadt am 27. Januar 1946. Die Vertriebenen gelangten von dort nach Hessen, Bayern und Württemberg. Hier waren neben Esslingen vor allem Göppingen, Nürtingen und Backnang das Ziel.
Juni 2019 - Wilde + Spieth: Armlehnstuhl von Paul Schneider von Esleben
Paul Schneider von Esleben:
Armlehnstuhl
Wilde + Spieth
um 1960
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006226)

„Kinderchen, könnt ihr auch Stühle bauen?“ Mit diesen Worten soll die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Egon Eiermann (1904-1970) und dem Unternehmen Wilde + Spieth 1948 begonnen haben. Fortan konzentrierte sich die Firma auf die Herstellung von Stühlen.Das Objekt des Monats Juni ist ein Designerstuhl jener Firma, der aus der Zeit um 1960 stammt. Er besteht aus einem geschweißten Metallgerüst, das mit hochwertigem Tropenholz (Teak) veredelt wurde. Dabei wurden die metallenen Stäbe gebogen und schwarz eingefärbt. Für einen weiteren dunklen Akzent sorgen die dunkelbraunen sowie abgerundeten Teakholzarmlehnen.
Durch die dunkle Farbwahl erscheint der Stuhl noch edler, als er alleine durch seine Materialwahl und Formensprache schon wirkt. Markant ist zudem das Rohrgeflecht, das sich bei der Sitzfläche sowie bei der Rückenlehne trapezförmig ausbreitet und mit seiner hellen Farbe für einen Hell-Dunkel-Kontrast sorgt.Der kantige Armlehnstuhl spielt auch weiterhin mit Gegensätzen, indem die Stahlstäbe rund gestaltet sind. Auch die an die stark ausgestellten Rückbeine angeschraubten Armlehnen sind leicht gerundet. Die vorderen Beine haben runde, tellerförmige Füßchen, die hinteren nicht.Bei der Firma Wilde + Spieth begann alles im Jahr 1831, als der Schreinermeister Wilhelm Ludwig Spieth das Unternehmen als Handwerksbetrieb gründete. 1912 stieß kurzfristig der Ingenieur Richard Wilde hinzu. Seitdem führt der Betrieb den heutigen Namen. Hauptgeschäftsfeld nach dem Ersten Weltkrieg war der Bau von Klapp- und Rollläden, was nach 1945 einige Jahre fortgeführt wurde.Die ersten Nachkriegsjahre waren für diese Firma nicht einfach. So kam es, dass sich Wilde + Spieth neu orientierte, wodurch kurzzeitig auch eigene Holzspielwaren im Sortiment angeboten wurden. Aus dem Unternehmen ging eine weitere Firma hervor, die zu den bekanntesten Sportgeräteherstellern weltweit zählt: Spieth Gymnastics. Ihren endgültigen Durchbruch hatten Wilde + Spieth jedoch als der Produktionsschwerpunkt auf Stühle verlagert wurde, von denen die Kreationen Eiermanns am berühmtesten sind. Er kreierte bis 1970 einige Designklassiker, die bis heute in der aktuellen Produktpalette enthalten sind.Das Unternehmen besteht bis heute und legt noch immer hohen Wert auf Handarbeit. Dennoch hat die Firma auch schwere Zeiten hinter sich. 2004 musste Wilde + Spieth Insolvenz beantragen. Die Kaufgewohnheiten hatten sich bei einigen Großkunden geändert. So setzten Behörden vermehrt auf Billigmöbel anstatt auf hochpreisiges Qualitätsmobiliar. Heute hat sich die handgefertigte Qualität erneut etabliert und der Firmensitz in der Plochinger Straße 156 in Oberesslingen ist erhalten geblieben. Produziert wird mittlerweile weit von Esslingen entfernt in Stendal (Sachsen-Anhalt).Als kreativer Kopf hinter dem vorliegenden Armlehnstuhl steckt Paul Schneider (von) Esleben (1915-2005). Er entstammte einer Architektenfamilie. Seine Hauptwirkungsstätte hatte der Düsseldorfer in Nordrhein-Westfalen. Er war einer der Architekten, welche die Nachkriegsmoderne insbesondere in den 1950er und 1960er Jahren nachhaltig prägten. Als eines seiner berühmtesten Werke gilt der heutige Terminal 1 des Flughafens Köln-Bonn von 1970.Neben Möbeln und Gebäuden entwarf er auch Schmuck. Seine kreative Ader vererbte Schneider-Esleben an seine Kinder, die allesamt im gestalterischen Bereich tätig sind. Eines seiner Kinder schrieb Musikgeschichte: Sein Sohn ist Florian Fischer, der Mitbegründer der weltberühmten deutschen Band Kraftwerk, die als Väter der elektronischen Popmusik gelten.
Mai 2019 - Seifenfabrik Friedrich Gruner: Grunella - "Seifenmühle"
Seifenfabrik Friedrich Gruner:
Grunella-"Seifenmühle"
2. Hälfte 20. Jahrhundert
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 005702)

Am 05. Mai 2019 jährt sich zum elften Mal der Welttag der Handhygiene. Welcher „Historische Schatz" könnte daher in diesem Monat geeigneter sein als eine Seifenmühle aus dem Hause Gruner.
Bereits 1805 setzte Jakob Friedrich Gruner in Calw den Grundstein des Unternehmens. Etwa 50 Jahre später verlegte sein Sohn den väterlichen Betrieb in die damals aufblühende Industriestadt Esslingen.
Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte Gruner sich dann auch international einen Namen. Das aufstrebende Unternehmen erhielt Auszeichnungen bei Weltausstellungen wie in Paris 1867 und Moskau 1872. Damals zog das Unternehmen von der Milchstraße 2 in ein neues großes Fabrikanwesen in die städtebaulich neu erschlossene Pliensauvorstadt auf der anderen Neckarseite. Die Friedrich Gruner „Seifenfabrik und Oelhandlung" befand sich fortan in der Nellingerstraße 8.
Ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte war das im Jahr 1905 erfundene Gruner Waschmittel. Es gilt als das erste selbsttätige Waschmittel der Welt – und das bereits zwei Jahre vor dem Waschmittelklassiker PERSIL! Auch in Russland und Asien fanden die Produkte aus dem Hause Gruner reißenden Absatz. Aber nicht nur Seifen befanden sich im Sortiment von Gruner. Selbst „Dr. Heiners antiseptische Wundsalbe" war ein bedeutendes Produkt des Hauses. Bis 1972 bestand die Firma Gruner, dann fusionierte sie mit Enzian in Metzingen. Erst vor wenigen Jahren beendete auch dieses Unternehmen seinen Betrieb.
Die Grunella Seifenmühle selbst wurde 1952 unter dem damaligen Gruner-Chef Walter Scherieble entwickelt. Schnell stieg die Nachfrage des Seifenspenders und er war seither jahrzehntelang auf vielen bundesdeutschen Toiletten zu finden. Sie gelangte aber auch zu weit über die deutschen Grenzen hinausragendem Ruhm. Der spektakulärste Geschäftspartner war ein arabischer Scheich, der die Seifenmühle bei einem Stuttgarter Automobilkonzern sah und davon so begeistert war, dass er gleich einige Seifenmühlen bestellte. Dabei handelte sich um Einzelstücke, die eigens für ihn vergoldet wurden.
Die vorliegende Seifenmühle besteht aus drei Teilen: Der etwa 19cm hohe Seifenspender ist aus verchromtem Gussmetall hergestellt. Der obere Teil ist zylinderförmig und dient zur Aufnahme der ebenfalls zylindrisch geformten Trockenseife. Unten befindet sich eine Kurbel aus schwarzem Kunststoff, mit der die Seife gemahlen wird. Das Rohr lässt sich mit einem Deckel verschließen. An ihm hängt eine Kette mit einem Gewicht, das die Seife nach unten drückt. Das Innere der Seifenmühle bezeugt die häufige Nutzung des Gerätes: Es befinden sich noch immer Seifenreste darin. Die Mühle konnte mit vier Schrauben an der Wand befestigt werden. Zur Befestigung diente eine Blende aus Kunststoff, die wiederum schwarz ist. Darauf klebt ein ebenfalls schwarzer Aufkleber mit weißer Schrift, der über die Produktbezeichnung und den Hersteller aufklärt. Die gezeigte Seifenmühle tat ihre Dienste in einer Allgemeinarztpraxis. Dort hing sie seit etwa 1970. Spätestens seit 2000 wurde sie dort nicht mehr verwendet. Die Anforderungen an die medzinische Handhygiene hatten sich doch zu sehr geändert. Schließlich wurde sie während einer Renovierung abmontiert und kam als Geschenk in den Besitz des Stadtmuseums.
Auch wenn die Firma Gruner nicht mehr existiert, ist dieser Klassiker noch heute erhältlich. Bis zu ihrem Produktionsende vertrieb die Seifenfabrik Enzian den Produktstamm um Grunella weiter. 2011 übernahm die Firma Sapor aus dem Ruhrgebiet den Designklassiker. Dort kostet die Seifenmühle stolze 120 €. Beschrieben wird die Grunella Seifenmühle mit den drei Worten: langlebig – umweltfreundlich – kinderleicht.
April 2019 - Carl Wahler: Sirnauer Hof
Carl Wahler: Sirnauer Hof
Kohlezeichnung und Gouache
1920er Jahre
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006282)
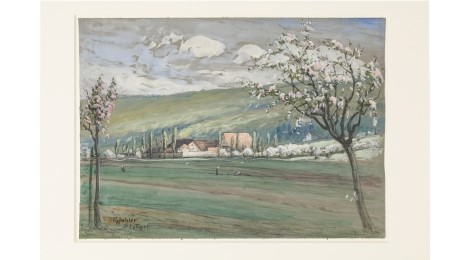
Während heute die Talauen des Neckars über allergrößte Strecken dicht bebaut und besiedelt sind, lässt eine höchstens hundert Jahre alte Ansicht des Hofguts Sirnau ahnen, dass vor der Industrie und der Siedlung Sirnau hier eine weitläufige ländliche Idylle bestanden hat.
Durch archäologische Grabungen im Jahr 1936 wissen wir, dass am Ostrand der heutigen Siedlung ein großer alemannischer Friedhof gelegen hat. Auch keltische Funde, so ein faszinierend ausgestattetes Grab einer jungen Frau aus dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert, sind damals ausgegraben worden.
Auch wenn eine Vorgängersiedlung der Alemannen erschlossen werden kann und es im Mittelalter die Weiler Ober- und Untersirnau gegeben hat, wurden erst mit der Gründung eines Nonnenklosters 1241 Ort und Name aktenkundig. Eine Schwesternsammlung aus Kirchheim unter Teck hatte damals das Gut von einem Albert von Altbach erworben, der damit seine Teilnahme am Kreuzzug gegen die Tataren finanzieren wollte. Vier Jahre später wurde das Kloster in den Dominikanerorden aufgenommen.
Das hielt aber weder Adelige noch Esslinger Bürger davon ab, die Sirnauer Dominikanerinnen juristisch und auch ganz handfest immer wieder zu bedrohen und sogar Klostergebäude zu zerstören, bis die Frauen 1292 die Erlaubnis erhielten in die Esslinger Vorstadt Pliensau umzuziehen, wo heute noch die Sirnauer Straße an sie erinnert. Vom ehemaligen Kloster Sirnau aus wurden nun die umliegenden Felder bewirtschaftet wurden. Da der Klosterhof einsam fernab der Stadt Esslingen lag, war er 1449 und 1519 Ziel württembergischer Angriffe.
Dies ändert sich im Grunde auch nicht, nachdem er an das Esslinger Katharinenspital verliehen und im Bauernkrieg 1525 großteils abgebrannt worden war. Die Dominikanerinnern übergaben danach ihren Klosterhof endgültig an das Spital, wodurch er nach der Reformation um 1535 reichsstädtischer Besitz wurde.
Zwischen 1544 und 1576 wurde der Hof weitgehend so wiederaufgebaut, wie er sich heute darstellt. Der Besitz an Grund und Boden konnte in den nächsten beiden Jahrhunderten deutlich vergrößert werden und erreichte Ende des 18. Jahrhunderts über 350 Hektar Acker-, Wiesen- und Waldland.
Im Jahr 1800 errichtete westlich des Sirnauer Hofes im benachbarten Friedenstäle Jakob Zink eine Hammerschmiede. 1802 wurde Sirnau mit Esslingen zusammen württembergisch und 1828 der Markung Deizisau zugeschlagen, was einen hundert Jahre langen Streit zwischen der Stadt Esslingen und dem Staat Württemberg nach sich zog. Die Sirnauer Wiesen, auf denen heute die Siedlung Sirnau liegt, wurden Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend für sportliche Aktivitäten genutzt. Ein Schießhaus und später auch ein Forsthaus wurden errichtet. Die 1889 aufgenommene Fährverbindung mit der Fähre „Cimbria“ blieb vor allem durch ein schreckliches Unglück nach einem Fußballspiel im April 1918 mit 21 Todesopfern lange Zeit im Gedächtnis der Bevölkerung.
In den 1920er Jahren begannen die Neckarbegradigung und –kanalisierung. Aus dieser Zeit stammt wohl die kleine frühlingshafte Ansicht von Carl Wahler, der 1863 in Esslingen geboren worden war, in den 1880er Jahren nach einer Lithographenlehre an der Stuttgarter Kunstschule bei Friedrich von Keller Malerei studiert hatte und ab 1889 lange Jahre eine Lithographiewerkstatt in Stuttgart betrieb. Seine eigentliche Leidenschaft galt aber der Industrie- und Landschaftsmalerei. Berühmt wurden seine Darstellungen von Hammerschmieden. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg bis zu seinem Tod 1931 widmete er sich ganz der Malerei.
Er stellt die Situation bei einem Ausflug in die Umgebung seiner alten Heimatstadt so dar, wie sie sich auch den erwerbslosen ersten 50 Siedlern der „Stadtrandsiedlung“ Sirnau wohl noch geboten hat, die im Frühjahr 1932 mithalfen, ihre staatlich geförderten Häuser zu errichten: Mitten im ergrünenden Neckartal liegt zwischen blühenden Bäumen und vor dem bewaldeten Hang das ummauerte Hofgut mit den mächtigen Bauresten der ehemaligen Klosterkirche aus dem 13. Jahrhundert. Es ist so einsam und wehrhaft wie seit 400 Jahren. Die Felder und Wiesen und die vor den Winden schützenden Pappeln sind auch für den heutigen Spaziergänger noch gut zu sehen, wenn er am Ostrand der Siedlung Sirnau mit der dröhnenden B 10 im Rücken nach Süden schaut und die belebten Straßen rundherum und das Industriegebiet zu seiner Rechten ausblendet, das sich bis nach Deizisau hinzieht. Stille gibt es hier, wie fast überall am mittleren Neckar, kaum mehr, aber immer noch strahlt das Hofgut etwas von seiner vorindustriellen Bedeutung und der längst vergangenen Einsamkeit in der Talaue aus.
März 2019 - Hafnerfirma Christian Geiger, Teetasse mit Untertasse
Hafnerfirma Christian Geiger
Teetasse mit Untertasse
Porzellanmanufactur Bauer & Pfeiffer, Schorndorf
1920-1934
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 005862)

Die Gestaltung der Tasse ist schlicht, aber dennoch fällt ihr farbiges Blumenmuster auf. Die Formensprache der Blumen nähert sich dem Stil des Art déco (1920er-1930er Jahre), ohne dabei zu modern zu wirken. Dabei ist ein prächtiges Farbarrangement der Porzellanmalerei zwischen Gelb, Orange und Blau entstanden. Goldränder am Ohrenhenkel, am oberen Tassenrand und am äußeren Untertassenrand veredeln den stimmigen Gesamtauftritt des Keramikproduktes. Die Farbe Gold findet sich ebenfalls auf der Unterseite der Tasse wieder. Dort stehen in goldenen Lettern die Signatur des Herstellers und des Verkäufers. Es ist ein Logo von zwei ineinander geschlungenen und bekrönten Buchstaben („bekrönte Ligatur“), die unter sich ein und-Zeichen beherbergen: B&P. Darunter wird die Herkunft klar deklariert: WÜRTTEMBERG. Zusätzlich ziert darüber der Namensschriftzug eines Esslinger Händlers namens Christian Geiger die Unterseite der Keramiktasse. B&P – das steht für die Porzellanmanufactur Bauer und Pfeiffer in Schorndorf, die von 1904 bis 1934 bestand. Im Verlauf nannte sich das Unternehmen in „Württembergische Porzellan-Manufactur“ um und wurde zu einer Aktiengesellschaft. Da in der Zeit des Ersten Weltkrieges die Porzellanproduktion zum Erliegen kam und sich das Tassendesign am Art déco orientiert, stammt es vermutlich aus den 1920er bis frühen 1930er Jahren. Die Teetasse wurde anscheinend nur selten benutzt. Teetrinken, im Gegensatz zum Kaffee, war in Süddeutschland zur damaligen Zeit eher unüblich.
Der Händler des Porzellanproduktes Christian Geiger war zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Küferstraße 28 in Esslingen sesshaft. Als Hafnermeister bot er Glas, Porzellan, Steingutwaren, Öfen und Herde an. Darüber hinaus führte er ab 1933 ein Haushaltsgeschäft, das seinen Sitz in der Küferstraße 13 hatte. Es scheint so, als hätte Geiger bei der Schorndorfer Manufaktur das Porzellan in Auftrag geben lassen und die Manufaktur hat im Gegenzug die Häfnerei oberhalb ihres Logos hinzugefügt. Das ist sehr wahrscheinlich, da die Signatur des Herstellers und des Händlers aus einem Guss zu stammen scheinen. Heute mutet der Beruf des Hafners gerade für die junge Generation fremd und exotisch an. Die Arbeit lässt sich grob in die Bereiche des Ofen- und Kaminbauens und der Töpferei einordnen. In Geigers Familie hatte die Beschäftigung als Hafner nachweislich eine Tradition. Es war bereits die dritte Generation seiner Familie, die als Hafner ihr Geld verdiente. Seinen eigenen Laden gründete er um das Jahr 1894. Auch sein Sohn Otto Geiger sollte ab 1934 die Familientradition fortführen. Da dieser allerdings keine Nachkommen hatte, führte er den Betrieb bis zu seinem Ableben 1953. Nach seinem Tod wurde das Familienunternehmen von seiner Gattin unter dem Namen „Hedwig Geiger, Ofen- und Herdgeschäft“ (Neulieferungen, Reinigungen, Reparaturen sowie Ersatzteile) bis 1960 weitergeführt. Da kein geeigneter Nachfolger gefunden werden konnte, kam es daraufhin zur endgültigen Schließung des Ladens.
Porzellangeschirr kann heute in Deutschland auf eine verhältnismäßig kurze Tradition zurückblicken. Die Feinkeramik stammt aus China, wo sich Porzellan im heutigen Sinne schon seit 600 n. Chr. belegen lässt. Etwa zeitgleich lassen sich dort die ersten Tassen nachweisen. Es sollte bis in das 17. Jahrhundert andauern bis die ersten Keramiktassen in Folge der ersten Teelieferungen durch portugiesische Händler nach Europa importiert wurden. Das Wort „Tasse“ hat sich über das Französische als arabisches Lehnwort auch im Deutschen eingebürgert (tas, tas(s)a = Schälchen, Napf). Erst Anfang des 18. Jahrhunderts etablierte sich im deutschen Raum ein selbst vor Ort hergestelltes Porzellan, das zu Beginn vor allem in Dresden und Meißen hergestellt wurde. Im 20. Jahrhundert gelang dem Porzellan – je nach Sichtweise – der Aufstieg oder Niedergang zur Massenware. Somit ist Porzellan heutzutage nicht mehr allein den wohlbetuchten Leuten vorbehalten, sondern ist für die breite Masse erschwinglich geworden.
Februar 2019 - Glaskaraffe von Friedrich Wilhelm Spahr
Friedrich Wilhelm Spahr:
Silberbelegte Glaskaraffe
Spahr & Co. Silberbelagwaren-Fabrik, Schwäbisch Gmünd
um 1955
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 005866)

Eine kleine grünliche Glaskaraffe, im Corpus weit ausladend und mit geschwungenen Silberstreifen verziert. Wahrscheinlich für ein Achtel Liter Hochprozentiges.
Die nur 11,5 cm hohe Likörkaraffe mit dem eingeschliffenen Glasstöpsel ist von acht s-förmig geschwungenen und asymetrisch geteilten an- und abschwellenden Silberbändern umschlungen, die unten in einem Bodenring enden und oben in den Hals und die Schnauze der Karaffe münden. Diese sind, wie der gläserne Henkel der Karaffe auf seiner Außenseite, aus Silber.
Schaut man ein wenig genauer hin, sieht man, dass der Silberüberzug nicht über das Glas gezogen, sondern fest mit ihm verbunden ist. Solche Silber-verzierten Gegenstände aus Porzellan oder Glas, die man heute als Silberoverlay bezeichnet, waren ab Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland unter der Bezeichnung Silberbelagware schick geworden. Der Pforzheimer Friedrich Deusch hatte sie maßgeblich entwickelt und ab 1901 in Schwäbisch Gmünd vervollkommnet, wo er auch 1912 seine – bis heute existierende – Metallporzellanfabrik Deusch & Co. für derartige Luxusartikel gegründet hat.
Einer seiner begnadetsten Lehrlinge war vermutlich der am 31.3.1900 in Esslingen geborene Friedrich Wilhelm Spahr, Sohn des aus Schwaikheim stammenden Kaufmanns Wilhelm Spahr aus der Mettinger Straße 101.
Die Schwierigkeit bei der Herstellung dieser aus zwei völlig unterschiedlichen Materialien bestehenden Objekte bestand darin, das Silber in einem galvanischen Bad mit der gläsernen Oberfläche zu verbinden. Das geschah, indem man die Glasflächen ganz präzise genau dort aufraute, die nachher mit Silber überzogen werden sollten. Danach bestrich man diese Flächen mit einer metallhaltigen Paste, die fähig war Strom zu leiten. Alle anderen Flächen musste man dabei perfekt abdecken. Die Genauigkeit dieser Vorarbeit entschied über die Qualität des Resultats, das dann in einem bis zu 30stündigen galvanischen Bad in einer Silberlösung erreicht wurde und den fühlbar dicken reinen Silberauftrag bewirkte. Die Muster konnten so frei sein, wie sie wollten, mussten aber zusammenhängen, damit der Stromfluss durch alle Teile und damit ihr gleichmäßig starker Aufbau garantiert waren.
Die wegen des Aufwandes an Präzision und Sorgfalt in der Regel ziemlich teuren und daher oft in Juweliergeschäften verkauften Vasen, Schalen oder Geschirrteile hatten großen Erfolge ab der Zeit des Art déco im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Die flächige und klare moderne Gestaltung lässt sich auch an der kleinen Karaffe ablesen. Sie vermied Zwischentöne, indem auf den Porzellan- oder Glasuntergrund das damit in Materialität und Farbe kontrastierende Silbermuster flächig aufgebracht wurde. Es gab keine Materialvermengungen. Bei manchen Gegenständen ist die Silberfläche zusätzlich zart graviert worden. Eine besondere Schwierigkeit stellen auch die gewölbten und kleinen Flächen dar, die eine Übernahme eines Rapports aus einer Vorzeichnung auf Papier schwer machen.
Friedrich Wilhelm Spahr hatte sich 1937 in Schwäbisch Gmünd in der Gemeindehausstraße 6 selbständig gemacht und vier Jahre lang mit etwa 40 Mitarbeitern – Galvaniseure, Graveure, Email- und Porzellanmaler - produziert, bevor seine Firma um 1940 herum aus den Akten verschwand; vermutlich war sie als nicht kriegswichtig eingestuft und geschlossen worden.
Spahr ist 1953 rückwirkend als am 31.3.1945 verstorben erklärt worden – wahrscheinlich ist er im Zweiten Weltkrieg umgekommen. Seine Witwe Erika, geb. Daibler, hat die Firma nach dem Krieg bis 1959 weitergeführt. Dabei hat sie viele von Spahrs Entwürfen weiter produziert, aber auch neue ins Sortiment gebracht. Die kleine Karaffe gehört mit ihrem schräg abschließenden Hals mit hoher Wahrscheinlichkeit in diese zweite Phase der Spahr’schen Manufaktur.
Januar 2019 - Metallwarenfabrik Quist: Geschenkset "Variomaster"
Geschenkset „Variomaster“-Kerzenständer
3 Kerzenständer mit Originalverpackung
Metallwarenfabrik F. W. Quist
um 1970
(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 005551)

Gerätschaften für den festlich gedeckten Tisch waren in der über 100jährigen Zeit ihres Bestehens DAS Produkt der Metallwarenfabrik F. W. Quist. Gegründet wurde sie als „Lackier- und Metallwaarenfabrik“ 1866 durch Jakob Schweizer (jun.). Als die Firma 1886 in „Actien-Plaqué-Fabrik“ umbenannt wurde, war einer der Firmeninhaber schon der in Holstein geborene Friedrich Wilhelm Quist (1831-1903), der ab 1896 Alleininhaber war. Von nun an blieb die Metallwarenfabrik F.W. Quist bis zu ihrem Konkurs 1981 in Familienbesitz.
Die Jahre seit 1966 sind durch den Versuch gekennzeichnet, mit Hilfe neuer Produktlinien und risikofreudigen unternehmerischen Entscheidungen die Zukunft der Firma zu sichern. Dabei sorgte 1971 die Ankündigung der Firma Quist, dass sie mehr als 25 Prozent der Anteile an der Geislinger Konkurrenzfirma WMF erworben hatte, für große Überraschung. Mit diesem Schritt wollte die Esslinger Firma eine Kooperation erzwingen, beispielsweise um ihre Waren in den Markenläden der WMF verkaufen und gemeinsam Material einkaufen zu können. Diese Strategie ging allerdings nicht auf, da sich die Rahmenbedingungen für die Einflussnahme im Nachhinein als deutlich anders herausstellten, als man beim Erwerb der Aktien angenommen hatte. Auch eine geplante Verlegung der Produktion nach Fernost konnte nicht realisiert werden.
Gleichzeitig hatte sich der Markt für die bisherigen Produkte aus versilbertem Metall einschneidend verändert. Die seit Jahrzehnten eingeführten Firmenerzeugnisse fanden seit Ende der 1960er Jahre immer weniger Absatz, da sie den geänderten Geschmacksvorstellungen der Käufer nicht mehr entsprachen. Hinzu kam die Konkurrenz durch billige Importe aus Fernost. Dieser allgemein in der Branche spürbaren Entwicklung entging beispielsweise die italienische Firma „Alessi“, indem sie konsequent auf gutes Design setzte und sich dank dieser Strategie zu einer Weltmarke entwickelte.
So zeigt die Produktpalette der Firma Quist in dieser Zeit einen starken Wandel. Die angebotenen Artikel wurden immer vielfältiger, aber auch beliebiger. So gibt es neben eher rustikal anmutenden Erzeugnissen aus Zinn und firmeneigenen Metalllegierungen wie „Quistal“, durchaus auch Designentwürfe auf hohem gestalterischem Niveau, wie beispielsweise der Kugelaschenbecher „Smokny“ oder die kugelförmigen Salz- und Pfefferstreuer. Daneben finden sich zahlreiche reine Geschenkartikel im Sortiment. Verstärkt griff man jetzt auch die seit den 1950er Jahren sich immer weiter verbreitende „Partykultur“ auf und produzierte unter dem Namen „Quist-Party-Geräet“ Produkte vom Cocktail-Shaker über den Erndnussspender bis zum „Party-Apfel“.
Zu diesen Lifestyle-Produkten gehört auch der als „Variomaster – das moderne Leuchter-Stecksystem“ bezeichnete Kerzenständer. Diesen gab es „vernickelt“, „verkupfert“ und „versilbert“. Im zeitgemäßen Design konnte der stolze Besitzer mit Hilfe eines einfachen Stecksystems je nach Anzahl der zur Verfügung stehenden Kerzenständer unterschiedlichste Leuchter-Kreationen zusammenfügen. Ähnlich wie bei einem Modelleisenbahn-Starterset ermöglicht die gezeigte aufwendige Geschenkpackung mit drei Kerzenständern erste einfache Leuchter-Kombinationen. Vermutlich spekulierten die Hersteller bei diesem Produkt auch darauf, dass der Sammeltrieb der Kunden geweckt wurde und sie noch viel mehr dieser Kerzenständer besitzen wollten. Dies suggeriert schon allein das auf der Verpackung abgebildete Foto, das eine glückliche Besitzerin hinter einer Leuchter-Installation mit deutlich mehr als nur drei Steckleuchtern zeigt. Damit der Spaß auch sofort beginnen konnte, lagen der Packung noch passende Kerzen aus zeittypischem orangenem Wachs bei.
Wie viele andere Gegenstände der späten Quist-Produktion fand die Geschenkpackung ihren Weg über das Internet ins Stadtmuseum. Auffällig ist dabei, dass viele dieser für wenig Geld erworbenen Produkte der 1970er Jahre durchaus auch Hinweise auf ihre Akzeptanz beim Kunden geben können. So zeigte sich bei vielen dieser Neuanschaffungen, die sich sicher niemals hätten träumen lassen einmal in einer Museumssammlung zu sein, dass sie noch in der originalen Verpackung und häufig sogar in Kunststoff eingeschweißt verkauft wurden. Auch zeigen sie oft keinerlei Gebrauchsspuren und auch im Fall des Geschenksets sind weder Wachsreste auf den Kerzenständern vorhanden noch fehlt eine der neun mitgelieferten Kerzen. Dies zeigt deutlich, dass der Vorbesitzer, der dieses Set vermutlich – vielleicht sogar zu Weihnachten – geschenkt bekommen hatte, nur wenig Begeisterung aufbringen konnte und keine Verwendung dafür hatte. Doch das Geschenk umzutauschen – wie jetzt nach den Festtagen häufig geschehen wird – war anscheinend auch keine Alternative. Erst die Möglichkeit, es im Internet zu versilbern, brachte diesen Gegenständen wohl erstmals einen praktischen Nutzen für ihre Besitzer.
Nach dem Konkurs der Metallwarenfabrik F. W. Quist 1981 erwarb die Bayerische Metallwarenfabrik in Nürnberg die Marke „Quist“ und damit auch die Berechtigung, bisher von der Esslinger Firma hergestellte Produkte zu fertigen. Zu diesen gehören in leichten Abwandlungen auch Steckkerzenleuchter.
Dezember 2018 - Irma von Pfannenberg: Vom Christkind und seinen Trabanten
Irma von Pfannenberg:
Vom Christkind und seinen Trabanten
Verlag J. F. Schreiber, Esslingen und München
5. Auflage, um 1950
(J. F. Schreiber-Museum, JFS 000189)

Eine verschneite Innenstadt, Sterne, ein festlich geschmückter Tannenbaum mit brennenden Kerzen, singende und Trompete spielende Engel sowie das Christkind. Schon während des Betrachtens der Titelseite „Vom Christkind und seinen Trabanten“ wird eine feierlich weihnachtliche Stimmung allgegenwärtig. Aufgebaut ist das um 1915 entstandene Kinderbuch mit jeweils einer Textseite links und einer Bildseite rechts. Der Erzähltext wurde in Paarreimen verfasst. Blau und Gelb akzentuieren durchweg die Komposition der farbigen mit Feder gezeichneten Bilder. Die Handlung des 18 seitigen Buches aus dem J. F. Schreiber-Verlag spielt in der Weihnachtszeit: das Christkind macht sich auf, die Weihnachtsgeschenke zu verteilen. Dabei wird es durch Engel in Kindergestalt unterstützt: die „Trabanten“. Zu Beginn der Geschichte lauscht Petrus an der Himmelspforte den ersten Weihnachtswünschen einiger Kinder und erklärt ihnen, dass alle Kinder ihre Wunschzettel schreiben sollen. Nachdem die Engel die Zettel von der Erde abgeholt haben, liest das Christkind sämtliche Wünsche. Nun bringen die Boten die Geschenke auf die Erde herab. Seite für Seite werden gewöhnliche Spielwaren aber auch Kriegsspielzeug vorgestellt. Schließlich treffen die himmlischen Boten auf der Erde ein. Kaum ist ihr Werk getan, begeben sie sich wieder gen Himmel. Am Ende des Rückwegs hilft ihnen Petrus zurück und die Sonne, verkörpert als Frau, bemuttert die emsigen Boten. Das Buch zeichnet sich durch liebevoll gezeichneten Figuren und passend kindgerechte Kolorierung aus. Der gebürtigen Ostpreußin Irma von Pfannenberg (1876-1950) ist es gelungen, mit ihren Illustrationen und Versen in einfacher Sprache ein weihnachtliches Flair zu versprühen. Über die Autorin ist nur weniges bekannt. Pfannenberg, eigentlich auf Landschaftsmalerei spezialisiert und Malereilehrerin für Akt, hatte ihren Wirkungsort in Weimar. An der Großherzoglichen-Sächsischen Kunstschule wurde sie u.a. von Sascha Schneider (Illustrator der ersten Karl-May-Bücher) unterrichtet. Pfannenbergs „Christkind“ wurde mehrmals wiederaufgelegt (das Exponat stammt aus der 5. Auflage). Der Sprung in die Riege der literarischen Weihnachtsklassiker gelang dem Buch dennoch nicht.Die Erzählung spiegelt den Zeitgeist um 1900 wider. Debatten, ob Kriegsspielzeug pädagogisch verwerflich ist, gab es damals noch nicht. Zugleich wirkt die verwendete Sprache bei Worten wie „Aeroplan“ für ein Flugzeug überholt. Was jedoch heute am meisten befremdet: Keines der Geschenke in der Erzählung wurde eingepackt. Angesichts der aktuellen Müllflut weltweit, könnte das Buch eine Anregung für einen bewussteren Umgang mit Verpackungen sein. Viele Kinder von heute dürfte verwirren, dass nicht der Weihnachtsmann die Geschenke verteilt. Doch selbst in der Vergangenheit war das Christkind nie der einzige Gabenbringer im deutschen Sprachraum. Das Christkind als Geschenkeverteiler entstand nach der Reformation, da die Protestanten Heiligenverehrungen klar ablehnten. Zuvor gab es Geschenke in der Weihnachtszeit nur für Kinder, die der Heilige Nikolaus verteilte. Der Christkindsbrauch wurde in den letzten Jahrhunderten von den Katholiken übernommen, wogegen in protestantischen Gegenden wie Mittel- und Norddeutschland der Weihnachtsmann seinen Siegeszug antrat. Die Bedeutung des Christkindes hat jedenfalls in den vergangenen Jahrzehnten spürbar nachgelassen. Kurzum, das Buch ist unterhaltsam und ein kostbares Zeitzeugnis, aus einer Zeit, in der Weihnachtsmann und Massenkonsum in Deutschland noch keine nennenswerte Relevanz besaßen.
Die Objekte des Monats von August 2014 bis November 2018 unter dem Motto "52x Esslingen und der Erste Weltkrieg" finden Sie im "52x-Archiv".
Juli 2014 - Brief von Johan Schmid anlässlich der Pestepidemie 1521
Brief von Johann Schmid als einziges Zeugnis der Pestepidemie 1521
(Stadtarchiv Esslingen, Bestand Reichsstadt, Fasz. 223 Nr. 2)
Pestepidemien gab es seit dem ausgehenden Mittelalter in regelmäßigen Abständen. Ihren Ausgang nahmen sie im 14. Jahrhunderts mit der Pandemie des Schwarzen Todes. Ihr fiel rund ein Drittel der damaligen Bevölkerung in Europa zum Opfer. Welche Krankheit die Menschen tatsächlich befiel, ist meist nicht mehr zu ermitteln. Es muss nicht die heute bekannte Pest gewesen sein. Die Menschen nutzten den Begriff auf andere Weise. Er galt als Oberbegriff für ein schweres Sterben wie auch eine Seuche sui generis, die eine spezielle Ursachendeutung erfuhr. Man sah als Krankheitsursache eine Strafe Gottes für den sündhaften Lebenswandel der Menschen. Auch Ursachen aus der Natur gab es: Bestimmte Planetenkonstellationen riefen verunreinigte, krankmachende Luft (Miasma) hervor. Stinkende Dinge wie Mist, heimliche Gemächer oder Leichen vergifteten die Luft. Auch sei eine Ansteckung durch Krankheitskeime (Contagien) möglich.
Für die Auseinandersetzung mit Epidemien in der Geschichte ist diese Sichtweise zu berücksichtigen. Die damaligen Vorstellungen waren die Grundlage für das Handeln der Menschen. Die Obrigkeit versuchte mit Seuchenordnungen die Ausbreitung der Seuchen zu verhindern. Dies hatte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen. Aber auch unabhängig davon versuchten sich die Menschen vor der Pestilenz zu schützen. Sie reinigten die Luft mittels Räucherungen oder verließen verseuchte Orte. Diese war eine typische Verhaltensweise bei Epidemien. Insbesondere Kinder sollten durch einen Ortswechsel geschützt werden.
Esslingen, wo es seit 1472 regelmäßig Epidemien gab, wurde bei Seuchen von den Menschen zur Vorbeugung einer Infektion ebenfalls gemieden. Der neue Schulmeister der Lateinschule, Johann Schmid, berichtet im Herbst 1521 in einer Bittschrift an den Rat über die Zustände in der Schule und das Verhalten einiger Bürger. Zugleich gibt er einen Blick auf seine Einschätzung der Lage. Dieses Gesuch ist der einzige direkte Beleg für die Epidemie in Esslingen 1521.
Bevor er seinen Dienst antrat, hatte er erfahren, dass eine Seuche in der Stadt grassierte. Über ihr Ausmaß lässt sich nur spekulieren; das Seuchenjahr 1521 gilt jedoch allgemein als vergleichsweise schwere Heimsuchung. Aufgrund der Krankheit liege die Schule brach und die Auswirkungen der Seuche behinderten den Schulbetrieb. Viele Familien waren aus Esslingen geflohen. Der Schulmeister sah aber vor allem eine Gefahr für die eigene Gesundheit. Seine Begründung beruht auf der Vorstellung, dass die Luft in der Stadt vergiftet sei und eine krankheitserregende Wirkung habe. Daher bedeute eine Übersiedlung nach Esslingen ein besonderes Risiko. So ersuchte er den Rat, ihn bis zur Besserung der Lage außerhalb der Stadt wohnen zu lassen. Problematisch war der Umstand, dass nicht alle Schüler der Schule fernblieben oder geflohen waren. Einige Eltern bestanden weiter auf dem Unterricht. Um dies zu ermöglichen, schlug Johann Schmid vor, für die Dauer seiner Abwesenheit einen Stellvertreter einzustellen. Ob es hierzu kam, ist ungewiss. Der Rat entsprach aber dem Gesuch und stellte ihn frei.
Die Freistellung von Amtsträgern sollte sich nach 1521 ändern. Nun durften Amtsträger in Seuchenzeiten die Städte nicht mehr verlassen.
Juni 2014 - Großes ABC-Buch, um 1850
Großes ABC-Buch, Mitte des 19. Jahrhundert
Druck und Verlag von J.F. Schreiber, Esslingen
(JFS 000918)
Dieses großformatige, 18-seitige Buch ist ein wahrhaft unbeschwert unterhaltsames Exemplar eines ABC-Buches. Die wenigen und kurzen Texte sind durchweg harmlos bis lustig und selten moralisch gemeint. Das Zielpublikum muss man sich sehr jung vorstellen und in Begleitung eines allwissenden Erwachsenen.
Auf einer Doppelseite findet der angehende Leser und Schreiber drei kolorierte Abbildungen und auf der anderen Seite Worte, Schreibübungen und Reime. Die Schreibübungen sind in der damals üblich deutschen Kurrentschrift zu sehen. Diese Übungsseiten haben immer einen Schmuckrahmen. Die 26 Buchstaben des Alphabets werden einzeln mit dem kolorierten Bild erläutert. Gerne sind es Tiere, einheimische wie exotische, aber auch so ungewöhnliche Dinge wie „Chinese“, „Quarz“, oder „Vulkan“ kommen vor. Das kleine Erläuterungsbild wird umrahmt mit dem farbig gestalteten Buchstaben in Fraktur-, deutscher Kurrentschrift und lateinischer Druckschrift zusätzlich in Groß- und Kleinschreibung. Gegenüber wird dann geübt: Die Anlautierungen wie „d o“, „o-der“, „mo-de …“ helfen den Leseanfängern ein Gefühl für das gelesene Wort zu bekommen. Die meist drei Zeilen werden dazu genutzt, die deutsche Kurrentschrift zu lernen. Die Schreibzeile wiederholt die obere Zeile, aber nicht in der vollständigen Länge. Mit kurzen Reimen, Rätseln oder kleinen Scherzen wird die Lerneinheit abgeschlossen.
Das Prinzip des ABC-Buchs ist die Kombination von schriftlicher Darstellung von Anlauten und bildlicher Darstellung von einem oder mehreren Gegenständen, Tieren oder Personen. Anhand des ABC-Buchs sollten Kinder Lesen, Schreiben und Verstehen lernen. Die Anlautiermethode ist eine Überlegung der Pädagogen des 19. Jahrhunderts. Es ist eine bis heute viel diskutierte Methode des Lernens.
Die Geschichte der ABC-Bücher beginnt schon im 16. Jahrhundert. Damals wurden die ersten ABC-Bücher als Lernmittel gebraucht oder auch zur religiösen Unterweisung eingesetzt. Oft moralisierende Holzschnitte veranschaulichten damals schon Begriff und Text. Das ABC-Buch verliert mit der Einführung der Schulpflicht seine eigentliche Funktion und wird ab diesem Zeitpunkt in der Vorschule oder im privaten Unterricht eingesetzt. Erkennungszeichen bleibt aber die alphabetische Anordnung. Im 19. Jahrhundert lösen sachliche Texte mit unterhaltenden Reimen, die moralisierenden Reime ab. Seit den 1830er Jahren wurden die Kinder von den Erwachsenen angewiesen so Schriften zu entschlüsseln und aus Texten zu lernen. Die Jungen und Mädchen sollten über die gelesenen Texte die Sprach- und Denkfähigkeit schulen, Sachwissen erwerben und eine moralische Orientierung erhalten.
Das Prinzip des ABC-Buchs findet man bis heute in den Fibeln der Grundschulen, es wird immer noch zum Lesenlernen verwendet.
Mai 2014 - Albert Benz, Entwurf zur Esslinger Burg, um 1904
Albert Benz,
Entwurf zum Ausbau der Esslinger Burg, ca. 1904
(Stadtarchiv Esslingen, NL Benz 9)

Der Architekt Albert Benz (1877-1944) hat eine ganze Reihe Esslinger Gebäude zu Beginn des 20. Jahrhunderts in historisierendem Sinn restauriert, u.a. das Kessler-Haus und die ehem. Franziskanerkirche. Auch für die sog. „Burg“ hat er ein Projekt erarbeitet. In seinem Nachlass, der im Stadtarchiv verwahrt wird, findet sich eine hübsche aquarellierte Federzeichnung, die dieses Projekt in einer Vogelschauansicht zeigt. Benz wollte die teilweise ruinösen Befestigungsanlagen im Sinne einer spätmittelalterlichen Festung rekonstruieren. Auf dem Kanonenbuckel, einer Artilleriestellung im Norden der Anlage, plante er ein großes steinernes Gebäude. Es sollte eine neue Burggaststätte beherbergen und hätte in seiner erhöhten Position in der Fernansicht die „Burg“ deutlich dominiert. Schon 1887 hatte man den Dicken Turm als Aussichtsturm mit einem neuen Abschluss versehen. Benz, der seine Idee 1908 in der „Bauzeitung für Württemberg, Baden, Hessen, Elsass-Lothringen“ publizierte, sah einen umfassenden Restaurationsbetrieb vor. Die heutige Burgschänke sollte durch eine Kegelbahn mit dem Oberen Turm verbunden werden, dieser über den rekonstruierten Wehrgang mit dem Dicken Turm. Dass Benz die Burg nicht nur als Tourismusmagnet, sondern auch als Naherholungsraum für die Esslinger verstand, zeigt die Einzeichnung eines Tennisplatzes. Solche Tennisplätze unter freiem Himmel erfreuten sich um 1900 großer Beliebtheit, einer der ersten auf dem Kontinent war 1898 für englische Kurgäste in Bad Homburg entstanden.
Benz sucht sich in seinem Entwurf in den Geist der Anlage einzufühlen, möglichst exakt die Befestigungsanlagen des 16. Jahrhunderts in ihrem angenommenen ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Wie sein ungleich berühmterer Zeitgenosse, der Berliner Architekt und Burgenforscher Bodo Ebhardt, hatte er sich einem wissenschaftlichen Historismus verschrieben, der bis ins Detail historische Bauformen nachahmte. Die Rekonstruktion von Burgen war um 1900 nicht ungewöhnlich. Die Hohkönigsburg Ebhardts im Elsass ist eines der vielleicht bekanntesten Beispiele. Dahinter stand ein zeittypisches Burgenbild, das eine vermeintlich heroische Vergangenheit heraufbeschwören wollte und ein eigenständiges Mittelalterbild in der Tradition der deutschen Romantik entwarf.
Auch Benz versuchte sich, u.a. auf Hohenbeilstein, an solchen Bauprojekten. Beilstein blieb allerdings unvollendet, weil der Auftraggeber verstarb, und dem visionären Esslinger Entwurf dürften die Stadtväter skeptisch gegenüber gestanden haben. Er hätte die Burg um das ergänzt, was ihr so offensichtlich fehlt: ein herrschaftlicher Wohnbau, den Benz in den Formen des frühen 16. Jahrhunderts mit hohem Staffelgiebel entwarf. Tatsächlich aber war die 1314 erstmals erwähnte Burg nie Adelssitz, sondern lediglich ein stark ausgebauter Bereich der Esslinger Stadtbefestigung an der besonders gefährdeten Nordseite der Stadt.
